mich geschlagen.
Autor: Elli_April
Februar 2026 – Den Pinguin im Kopf
Leute, das könnt ihr nicht machen! Ihr könnt doch nicht im schlimmsten Winter seit langem vom Videoclip eines Pinguins berichten, den wer wohl, Werner Herzog dabei gefilmt hat, wie er sich von der Gruppe abwendet und in Richtung der Berge aufmacht wo der sichere Tod ihn erwartet, ohne Triggerwarnung davor und die Nummer der Suizid-Hotline dahinter!
Dieser Winter macht mich fertig. Die Kälte stört mich nicht so. Auch mit der nicht aufreißenden Wolkendecke käme ich irgendwie zurecht. Oder mit dem stinkenden Feinstaub, der in der nassen Luft festhängt und hereinzieht, beim Lüften. All dem könnte ich davonlaufen, ins Büro, zum Einkaufen, ins Cafe. Warm eingepackt könnte ich dagegen anschreiten, anatmen, irgendwo an einem Uferweg, im Park, bei einem kleinen Ausflug. Aber die seit inzwischen zwei Wochen permanent auftretende Glättegefahr, die schaffe ich nicht. Die schafft mich. Sie löst panische Angst in mir aus, ich könnte fallen. Ein weiteres gebrochenes Körperteil davontragen, das Handgelenk splittern hören, den Oberschenkelhals gebrochen sehen oder womöglich die angeschlagene Wirbelsäule. Der Gedanke an Notaufnahmen, Schmerzen, Operationstischen und Heilungsprozesse, die Zeit, Geduld und Geld kosten, macht mich krank. So werde ich unbeweglich, bleibe zuhause, teste ab und zu mit einem Fuß die Konsistenz der Eiskrusten vor der Haustür, auf denen festgetretener Schnee liegt und verharzter, überfrorener Regen, um, schon voll angezogen und mutig besser nochmal umzukehren, und mich so unfassbar E I N G E S P E R R T zu fühlen in dieser Wohnung, dieser Stadt, diesem Leben. Danke dafür, Senat. BVG. WBM, die ihr alle dazu beitragt, dass es so bleibt. Und die Angst nicht unbegründet ist, siehe Berichte aus der Notaufnahme. Noch reichen Dosenfutter, Klopapier, Teebeutel, Kerzen. Der Winter als Übungsrunde für den Stromausfall, den Drohnenangriff oder was immer da kommen wird. Mein Suchverlauf läuft über von meinen immer gleichen Fragen, wann wird es besser, wo ist es besser und wie komme ich dahin. Die Antworten bieten bei genauer Betrachtung keinen Ausweg oder kosten zu viel Geld.
Also schreibe ich Prosa am Herd der Schreibküche, mache drei bis viermal täglich Youtube Sport, denn alles hat ja auch sein Gutes. Und wenn ich rausgehe, watschele ich im Pinguin-Gang übers Eis.
Januar 2026 – Sag mal Ich
Sag mal Ich
Diesen Satz höre ich gerade fast jeden Tag. Von der Online-Trainerin, einer sogenannten Internet Persönlichkeit, die bei Youtube Kurseinheiten zwischen 10 und 30 Minuten anbietet, von denen ich jeden Tag mindestens eine mache. Wer Ich sagt, stärkt sein Powerhouse, wer Ich sagt, steuert und spannt die Core-Muskulatur an. Von da aus starten alle weiteren Übungen zu Mobilität und Stabilität ohne diese stabile Mitte je aus den Augen zu verlieren.
Doch das ist noch nicht alles. Sag mal Ich ist in Zeiten von Achtsamkeit und Selbstfürsorge natürlich auch als Element zur Ich-Stärkung gedacht. Denn auch mental müssen und sollen wir uns trainieren. Nur wer ab und zu mal Ich sagt, kann, das ist bekannt, in Job, Familie, Beziehung effektiv sein.
Ein Schelm, wem da beim Besuch beim Vater der Satz in den Sinn kommt. Der Vater nämlich, sagt praktisch ständig Ich. Niemand muss ihn zu Trainingszwecken dazu auffordern. Er macht das ganz von alleine und ganz locker aus dem Bauch heraus und ohne irgendeine Core Muskulatur anspannen zu müssen. Er sagt mehrfach am Tag Ich, er sagt in allen Gesprächen Ich, alle Themen sind dazu da beim Ich zu landen. Er sagt Ich solange bis man nicht mehr sicher ist, ob es wichtig ist, ob sonst noch jemand anwesend ist. Außer vielleicht zur Anregung fürs Ich.
Warum alle Frauen um den Vater herum inklusive mir denken, er habe im Grunde eine schwache Tiefenmuskulatur und man müsse ihn immer wieder dazu ermuntern, Ich zu sagen, um sein Powerhouse zu stärken, man müsse ihn beständig beim Ich sagen eskortieren, weiß ich nicht. Noch weniger weiß ich, weshalb diese Strategie bis heute problemlos aufgeht.
Vielleicht jedenfalls liegt es daran, dass die Aufforderung Sag mal Ich auch nach jahrelangem Training einen gewissen Widerwillen in mir auslöst, was natürlich ein Dilemma ist. Denn so falsch ich das ständige Ich sagen finde, so gerne würde ich Ich sagen, ohne Angst haben zu müssen, verlassen zu werden.
Januar 2026 – writer
Ich schreibe im Café am Fenster. Thats a great spot to work on a book, sagt ein Typ, der am anderen Ende der Fensterbank gesessen hat und sich jetzt zum Gehen aufmacht. Ich schaue ein bisschen erschrocken auf, weil ich so ins Schreiben vertieft war. First I thought, its an odd place to work for a writer, but then I thought, its a perfect place. Yes, lache ich, there is heating, und deute auf die Heizung unter mir, people walking by, you are in the middle of it but still at work. I’m on vacation, erklärt er fast ein bisschen entschuldigend, I just talk to people. Thats very nice, sage ich. Have a great stay.
Hat er recht? Am I a writer?
Januar 2026 – unverzagt verzagt
1
Ich hatte schon viele Namen. Namen, die ich mir gegeben habe. In dem peinlichen, zu belächelndem Versuch, jemand anderes zu sein, als ich bin. Mit den Namen ziehe ich einen Abstand ein zwischen mir und meiner Identität, verschaffe mir ein wenig Luft von mir, wende mich anderen Aspekten meines Selbst zu, ich verstecke mich hinter den Namen, ich zeige mich mit ihnen.
Ich habe früh erlebt, dass andere bestimmen, wie ich heiße, dass sie von einem Tag auf den anderen behaupten können, Ich sei löschbar und ab sofort unter einem anderen Klingelschild zu subsumieren. Ab diesem Moment war unklar, wer ich bin, was mein Name damit zu tun hat, und wie das Zwischenreich aussieht, in dem ich mich seitdem aufhalte. Mir selbst einen Namen zu geben ist also jedes Mal ein kleiner Akt der Selbstbestimmung. Ich, nur ich, bestimme wie ich heiße. Ich, nur ich, behaupte Mich.
Auf Webseiten oder Datingplattformen, bei bestimmten Projekten oder in verschiedenen Lebensphasen habe ich mir andere Namen gegeben. So kann ich mich selbst besser von mir unterscheiden. Die Namen beschützen mich. Unter ihrem Namen habe ich die Möglichkeit, etwas zu sein oder zu werden, das ich nicht bin. Ich lerne mich kennen unter neuem Namen.
Digital machts möglicher. Benutzernamen, Nicks, Aliasse statt Klarnamen, das ist nichts besonderes, das machen alle, das sind alle gewohnt. Aber wehe, es wird ernst bei der Account-Eröffnung, beim Bürgeramt, an der Grenze oder in Verträgen, da versteht keiner mehr einen Spaß. Ich entkomme mir nicht.
2
Es muss in meinen frühen Zwanzigern gewesen sein, Ich habe sehr lange nicht daran gedacht, da gab ich mir den Nachnamen Unverzagt.
Das erstaunt mich. Unverzagt.
Zeugt das nicht vom Wissen um die eigene Verzagtheit? Erzählt es nicht vom Antrieb, sich der Verzagtheit nicht ergeben zu wollen? Stellt der Name nicht schlicht die trotzige Behauptung auf, Unverzagt zu sein. War ich das mal? Unverzagt? Wenn ja, warum bin ich es nicht mehr? Heute würde ich mir den Namen nicht mehr geben. Ich weiß nicht, ob ich das Gegenteil, also verzagt bin, vielleicht eher etwas anderes, abgegessen, abgefuckt? Worn out.
Verzagt und Unverzagt tragen schon den Schmerz in sich, das Kämpfen zwischen den Polen. Aber noch nicht die Härte, die Bitterkeit, die Müdigkeit.
Januar 2026 – minus degrees
Zu kalt
Sagt der RE80 immer wieder.
Bis ich begreife
Er sagt
Zug hält.
Januar 2026 – Frauen
Im ICE Restaurant entdeckt die uniformierte Bahnmitarbeiterin das Cover des Buches, das ich lese (Elena Ferrante, Meine geniale Freundin). Oh, das ist so toll, sagt sie, ich hab alle gelesen. Es gibt weitere drei Bände über die Lebenswege zweier ungleicher Freundinnen im Neapel ab den 60er Jahren. Auch ich plane, weiterzulesen. Ja, sage ich, ich finds auch super. Aber auch ganz schön traurig, sagt sie. Ja, sage ich, und die Bahnmitarbeiterin und ich schauen uns für einen Moment an, im wissenden Einverständnis darüber, dass das, was den Frauen in diesem Buch passiert, passiert, weil sie Frauen sind. Und wir sinds auch.
Januar 2026 – neues Jahr
Ich komme ruhig an, im neuen Jahr.
Die Welt nicht, sie ist verzerrt und laut.
Der Schnee macht eine Decke drüber.
Das Anderswo sein auch.
Dezember 2025 – Silvester
Es war ein schlimmes Jahr.
Deshalb schreibe ich auf, was gut war.
Die Blicke aus dem Zug in der Schweiz, das Hotel in Lugano und ich im Pool, die Freunde in meiner Küche, die Freunde im Haus, die vielen Ausstellungen (vor allem Roman Signer), die Weiterbildung, die vielen Bücher (vor allem Die Holländerinnen, Was nicht gesagt werden kann und Meine geniale Freundin), die vielen Artikel, der Besuch bei H., der Besuch in HH, die Zusammenarbeit mit K., die Zusammenarbeit mit H., der Film Sirat, C., die immer spürt, wanns drauf ankommt (Swinemünde, Weihnachten).
Dezember 2026 – Only Fan
Mein Weihnachtsgeschenk:
Eine Mail von jemand, der mein Hörspiel gehört hat und mir schreibt, es habe alles, was es braucht, Tiefgang, Humor und Wärme.
Dezember 2025 – Weihnachten
Weihnachten wieder mal allein.
Ich finds beeindruckend gemein.
Wie immer unterschätze ich die Wucht.
Oder meinen Zustand.
Natürlich weiß ich, was zu tun ist.
Vielleicht ist das das Traurigste.
Dezember 2025 – der dussMann
Bei dussmann im Café sehe ich einen Mann. Er ist etwa so alt wie ich. Er hat das gleiche bestellt wie ich. Parallel beißen wir in dieses komische Panini. Ich sehe es, er nicht. Wie ich liest er in seinem Handy herum. Er ist schmal, nicht allzu hübsch, aber nett, nicht besonders interessant angezogen, aber weder nachlässig noch geschmacklos, er braucht eine Brille, um lesen zu können, er krümelt auf seinen Pulli, er fegt die Krümel mit der Hand weg, er wischt den Käse an seinem Mundwinkel mit der Serviette ab, und nichts daran, nichts, ist mir unangenehm. Ich muss sogar lächeln darüber. Er genießt wie ich seine Zeit hier im Café, allein, lesend, das Licht, draußen langsam dunkel, der Verkehr, die Stadt. Mit dem würde ich mich unterhalten, denke ich, mit dem würde ich schlafen. Vielleicht würde er sich sogar freuen darüber. Irgendwann schaue ich wieder mal vom Handy hoch und zu ihm rüber. Seine Frau sitzt ihm gegenüber. Sie war wohl stöbern, er hat sich schon mal hier hingesetzt. Sie ist ganz anders als ich.
Vorbei.
Dezember 2025 – Die Stadt
verbraucht.
Alles was
schon immer zweifelhaft charmant war,
heruntergekommen. Elend gar.
Menschen, die man kennt, Menschen, die man ignoriert. Hier hat sich einer umgebracht und dort, hier hat der gewohnt und dort. Wenn der kommt, komm ich nicht, wenn ich die einlade, kann ich den nicht einladen.
Wie erst muss es sein, wenn man tindert oder grindert oder eine der, wie der Tagesspiegel nicht müde wird zu berichten, ständig stattfindenden Sex-Partys besucht, sich durch die Menschen der Stadt gepflügt hat
wie durch Ackerland.
Bye bye, Berlin
wohin haben sie uns nicht verraten.
Der Abschied bleibt. Die Frage
offen
Dezember 2025 – geblähte Nasenflügel
Ich gehe zu einer Veranstaltung mit Dorothee Ellmiger. Ich bin Fan, irgendwie. Das hab ich selten. Sehr selten. Der Saal ist fast voll, als ich ankomme. Ich finde nur noch einen Platz, von dem aus ich sie nicht sehen werde. Nur manchmal verschiebt sich die Menge so vor mir oder bewegt sie sich auf dem Podium für einen Moment so, dass ich einen Eindruck von ihrem ebenmäßigen Gesicht bekomme und ihren immer wie gebläht wirkenden Nasenflügeln. Meine Vorstellung fliegt zu ihr.
In meiner Tasche liegt das Buch, das sie geschrieben hat, oben und an der Seite gucken kleine Post-its raus, die ich mit Notizen versehen habe. Ein Gütesiegel. Das Buch sieht aus wie ein Aktenschrank. Man kann mit den Fingern hineinfahren, an den Stellen wo die Post-ist sind, und sich angucken, was ich merkenswert fand. Ich habe mir vorgestellt, dass ich mich nach der Lesung in die Schlange zum Signieren stellen und ihr das Buch hinlegen werde. Ich werde mich dafür bedanken und sagen, dass man ja sehen kann, wie anregend ich es fand. Am Ende der Veranstaltung, die eigentlich eine Radiosendung ist, wird sie gar nicht signieren.
Sie liest zwei Auszüge und dazwischen gibt es interessante Fragen und Gedanken zum Buch von zwei namhaften KritikerInnen und einer Autorin. Nach der Veranstaltung verlasse ich schnell den Saal, weil es schon spät ist und der Weg zurück vom Wannsee weit und ich zudem wie schon im Vorfeld von dem Gedanken erfasst werde, dass U da sein könnte, womöglich auch noch mit Freunden oder seiner Freundin oder gar Dorothee Ellmiger selbst seine neue Freundin sein könnte, denn sie ist ja aus der Schweiz und passt auch sonst krass ins Beuteschema.
Ihre Geschichte besteht aus Geschichten und entwickelt eine atmosphärische, existentielle Düsternis, die ich in vielen aktuellen Produktionen wahrnehme (Sirat, In die Sonne schauen, Am Samstag gehen die Mädchen in den Wald). Die Frauen in Die Holländerinnen bewegen sich sehr selbstverständlich durch die Welt, als gingen sie davon aus, sie könnten sich dort bewegen und aufhalten und gehörten überallhin. Sie sagen zu, allein auf eine Herde Schafe aufzupassen. Sie nehmen den mühsamen Weg in einen Dschungel auf sich und begeben sich auf eine Wanderung bei der sie leicht in Gefahr geraten können. Es ist nicht so, dass alles klappt, was sie da machen, aber sie begeben sich auf eine wie mir scheint männliche Weise in diese Situationen, also ohne sich mit Bedenken oder Irritationen aufzuhalten. Sie scheinen keine Angst zu haben und dementsprechend nicht einmal Mut zu brauchen. Und doch erzählen die Geschichte und viele der Geschichten in der Geschichte, von der Gewalt in der Frauen leben.
Zuhause schaue ich mir ihr Foto auf der Zeit-Sonderausgabe an, ihr Gesicht scheint mir von einem klaren, klugen Menschen zu erzählen, der Mut hat.
Ich muss an das denken, was U gesagt hat über seinen Eindruck von den Schweizern. Endlich mal Menschen ohne diese ganzen historischen Belastungen wie in Deutschland immer, oder in Polen.
Ich wäre so gerne zusammen mit ihm zu dieser Lesung gegangen.
Dezember 2025 – Verlauf
Das dringende Bedürfnis, den Verlauf zu speichern,
den Gedankenverlauf, den Leseverlauf, den Gefühlsverlauf, den Bewegungsverlauf, den Internetverlauf, den SocialMediaverlauf, den Konsumverlauf, den Caféverlauf, den Watchverlauf.
Der Verlauf scheint mir unendlich wichtig, als sei eine Wahrheit in ihm, ein Wissen, das nirgendwo sonst zu finden ist. Es macht mich verrückt, dass ich nicht track keepen kann über den Verlauf.
Wenn ihr wüsstet, denke ich.
Ihr müsst das doch wissen, denke ich.
Wie oft ich durch meine Wohnung gehe und diejenigen vor mir sehe, die sie ausräumen werden, den Transporter vor der Tür. Die nicht eine einzige Geschichte wissen, keine Liebe sehen, keinen Schmerz, keinen Gedanken. Das ist der Lauf der Dinge.
Der Verlauf hat keine Zeugen. (Außer den Tec-Companies)
Er geschieht im Geheimen.
In der Abgeschiedenheit.
Dezember 2025 – Überall diese
verpanzerten jungen Frauen
mit ihren aufgespritzten Lippen, den stundenlangen Nägeln und dem megaharten Talk,
die Nina Chuba hören,
weil die so schön singt
über das Verletzlichsein.
Dezember 2025 – Gen X heute
Ich bin
ein performative male
im Körper einer performative woman.
Dezember 2025 – was mitbringen
Sollen wir dir was mitbringen? fragen die Freunde einer jungen Frau, die am Bahnhof auf einer Bank sitzt und beim Gepäck bleiben wird.
Nur ein bisschen Liebe und Glück, sagt sie.
Dezember 2025 – performative male
Seid auf der Hut, die faken nur, warnt Tiktok. Sie tun, als würden sie lesen, sie tun, als hätten sie Gefühle. Am Ende kippen sie dir doch nur k.o.Tropfen ins Glas oder sind zumindest:
emotionally unavailable.
Dezember 2025 – there’s a limit to your meds
Es gibt ein Antidepressivum gegen die Depression und die Angst,
aber keins gegen das Unglücklichsein.
Dezember 2025 – Ich sehe
einen winzigen, kastenartigen Innenbalkon in einem heruntergekommenen Neubau, dicht an einer viel befahrenen Straße.
Auf dem Balkon installiert und gen Himmel ausgerichtet:
ein riesiges Teleskop.
Dezember 2025 – Kann ich dich mal penetrieren?
Ich schiebe es tagelang vor mir her, dann erst spreche ich A. auf die sexistische Bemerkung an, die er mir gegenüber gemacht hat.
Boomer geprägt, Gen X sozialisiert und in der Ironie-Falle der 90er Jahre erwachsen geworden, bin ich ja allzeit bereit, diese Art von Scheiße zu ignorieren, beziehungsweise sie direkt ins innere dark hole zu verschieben, das, dehnbar wie es ist, voller wird, je länger man lebt, liest und leidet. Aber irgendwas hat diesmal Knacks gemacht. Mehrfach ertappe ich mich dabei bei ebay-Kleinanzeigen nach einer anderen Bürogemeinschaft zu suchen, während ich parallel ausgiebig über die ganze Sache nachdenke und sie mit anderen (als A.) bespreche.
Natürlich habe ich im Moment des Moments nichts gesagt, sondern das getan, was gut trainierte, unproblematische Elasti-Girls wie ich so tun, wenn die Scheiße auf sie zufliegt, ausweichen, auffangen, abfedern, und die Wut – noch bevor sie auftritt, ach, diese weiblichen Superkräfte! – in ein rosa Zuckerwattebällchen verwandeln. Hat ja gar nicht weh getan.
Es dauert vier Tage, dann spreche ich ihn darauf an. Ich weiß, es kommt jetzt vor allem auf eins an: Seine Reaktion. Während ich vor ihm stehe halte ich mich innerlich an zwei imaginären Armlehnen eines imaginierten Sessels fest, um ruhig und entspannt zu bleiben einerseits, um mich von dort abstoßen, aufspringen und auf den Tisch hauen zu können. Oder ihm eine rein.
Ich schildere ihm die Situation auf die ich mich beziehe und als ich beim entsprechenden Moment angekommen bin, frage ich ihn – ein bisschen Cop-Style zugegebenermaßen, aber jetzt ists eh schon egal mit der High Road – ob er sich an den Satz erinnern kann, den er zu mir gesagt hat? Nein. Sagt er. Und ich bin mir sicher, dass das keine Taktik ist, sondern stimmt. Warum auch sollte er sich daran erinnern? In meinem Kopf hat der Satz viel Raum eingenommen in den letzten Tagen, mich hat die Situation mit all den ihr anhängenden Aspekten beschäftigt, ihn nicht.
Ich zitiere seinen Satz. Oh, sagt er. Und entschuldigt sich. Umgehend.
Ich spreche noch ein bisschen weiter. Versuche zu beschreiben, dass es nicht das erste Mal war, dass ich Bemerkungen von ihm herabwürdigend fand. Maus, Mäuschen, habe ich schon von ihm gehört, und als einzige Reaktion auf meine Schilderung einer Ausstellung, die ich besucht habe: Du bist ja auch so ein Kulturhäschen. Das würdest du doch zu keinem Mann der Welt sagen, sage ich. Da hat sich was aufgestaut, sage ich.
Es gibt noch eine andere Sorte Bemerkungen, die er macht. Die oben Beschriebenen gehören zur ersten Gruppe, sie treffen mich oder andere direkt. Zur zweiten Gruppe gehören die Witze, die er gern macht, anzügliche Witze, mal eben so rausgehauene Sprüche, die sexuelle Anspielungen enthalten und die er gerne fallen lässt, wenn die Runde größer ist. Dad-Jokes könnte man sie nennen, weil sie eher peinlich und lahm sind. Aber oft verbreitet er damit eine klamme Atmosphäre, erzeugt ein cringe-Gefühl, über das alle aktiv hinwegsehen müssen, schnell weiter im Text, vielleicht mal ein halber Lacher von irgendwo. Man fängt es, man fängt ihn auf. Den armen Mann. Ein schützenswerte Wesen.
Ich erinnere ihn an eine Situation am Tisch, die wir kürzlich hatten, in der er in netter Runde mitten im Gespräch von zwei Frauen (!) eines dieser Witzchen gerissen hat. – Niemanden hat die Bemerkung direkt getroffen. Wie immer haben ihn alle ignoriert. Bei allen landet die Bemerkung im Dropbox-Ordner „Der A. halt mal wieder“. Ist es das, was er will, der Stromberg des Büros sein? Das denke ich nur, das sage ich nicht. –
Er ist verständnisvoll meinem ersten Punkt gegenüber, also der Beschwerde über den an mich gerichteten Satz. Sagt, ja, kann er verstehen und beschreibt nochmal, wie der Satz, um den es geht, gemeint war. Er wollte fragen, ob er mich mal kurz stören, belästigen, mit einer Frage nerven darf. Also eigentlich was ganz Nettes, Respektvolles, Defensives. Das hab ich auch so verstanden, sage ich ihm. Dass du das nicht literally gemeint hast, das war mir klar. Ich finde es trotzdem unangemessen. Er entschuldigt sich nochmal, sagt, ja, okay, und dass er es echt sehr gut findet, dass ich es anspreche. Dann weiß er ja jetzt, dass er da achtgeben muss, weil ich da überempfindlich bin.
Ich bin nicht überempfindlich, protestiere ich prompt und halte mich an den imaginären Armlehnen fest, er rudert rasch zurück, Sensibel, schlägt er vor, das ist ja was Positives, Nein, sage ich, ich bin weder überempfindlich noch sensibel, dein Verhalten ist unangemessen! Dann schildere ich nochmal die Sache mit dem Witz und versuche ihm zu sagen, dass ich finde, dass er damit manchmal einfach eine bestimmte Atmosphäre im Büro erzeugt und Gespräche kaputt macht.
Jetzt protestiert er. Sieht er nicht so. Sein witziger Spruch, den ich als Beispiel für Kategorie II angeführt habe und der aus der Unterhaltung am Tisch heraus entstanden ist, Besser zwei Streicher in der Familie als zwei Stricher, sei einfach ein Wortspiel gewesen. Das ist halt Humor.
Als ich später über das Gespräch nachdenke, wird mir klar, dass er die beiden all time classics männlicher Abwehrreaktion gegen solche Art von Beschwerden ins Feld geführt hat. 1. Du bist überempfindlich. Heißt so viel wie: Psycho halt, wie die Frauen so sind, da muss man aufpassen, was man sagt, zumal heutzutage, wo die alle so woke sind, und immer gleich denken, sie werden diskriminiert, dabei wars doch nur nett und witzig gemeint. 2. Das ist Humor. Heißt so viel wie: Du hast keinen. Kennt man ja, weiß man ja von diesen ganzen emanzipierten, sauertöpfisch dreinschauenden Zicken, die nicht lächeln, keinen Spaß verstehen und mit ihrer Spielverderber-Attitüde die lockere Atmosphäre kaputt machen.
Am Ende des Gesprächs bin ich froh, dass ich es geführt habe, weiß aber auch, er hat es nicht verstanden. Ich weiß, er wird Rücksicht nehmen in nächster Zeit, auf meine Überempfindlichkeit und meine Humorlosigkeit. Er wird, wie ich erfahren werde, den anderen sagen, dass es mir ja gerade auch nicht so gut geht (Trennung, underfucked, keine Tage mehr). Dass sich sein nett gemeintes Wortspiel, seine dumme kleine Bemerkung, Kann ich dich mal penetrieren, in meinem Kopf am Ende des Jahres Zweitausendfünfundzwanzig mit den Zahlen zur Häuslichen Gewalt verbindet, mit dem Fall Gisèle Pelicot, den Epstein Files und so weiter und so weiter und so weiter, das kann er ja nicht wissen.
Oder?
In jedem anderen Office bei der Bahn oder der Bank wäre das möglicherweise schon ein Compliance Fall, aber hier im ach so achtsamen Büro in Kreuzberg toleriert man das, genau wie den Müll und die Ratten, und hält die Fahne von Freiheit und individuellem Lifestyle hoch. Gut, A. hat keinerlei Macht über mich. Er ist nicht mein Chef, nicht mein Kollege, nur ein Mitbewohner, okay, er hat den Mietvertrag, aber sonst. Ich kann jederzeit gehen, wenn es mir nicht passt. Egal, was ich tue und wie ich mich entscheide.
Er wird bleiben.
Dezember 2025 – Minderheitsverhältnisse
Vor mir auf der Straße gehen zwei junge Frauen, ich höre ihr Gespräch mit an. Es geht um die Alten, die überall sind, die alles bestimmen und gegen die man sich nicht wehren kann, weil sie, die Jungen, in der Minderheit sind.
Dezember 2025 – Kontext
Eine der Frauen von Pussy Riot erzählt in einem Artikel von einer der Aktionen der Gruppe. Damit hatten sie gegen die Sperrung von Telegram durch die russische Regierung protestiert. Der Besitzer, Pawel Durow, hatte sich geweigert, Chats an die Behörden weiterzugeben.
Pawel Durow hier also ein Freigeist, der sich gegen ein autoritäres Regime auflehnt, sein Messenger-Dienst eine zensurfreie Plattform für offenen Meinungsaustausch. Pawel Durow andererseits ein Angeklagter in Frankreich, das er nicht verlassen darf, weil er sich nicht an die Regulierungsauflagen für Social Media-Unternehmen hält, mit denen die EU versucht, die Verbreitung von Hass, Hetze, Rechtsextremismus, Gewalt, Kinderpornografie und Geschäften der organisierten Kriminalität einzudämmen.
So ist das mit der Freiheit und dem Aktivismus. Kontext is key.
November 2025 – Vorfahrt
Ich gehe frühmorgens die Linienstraße entlang, auf dem Weg zu einem Termin und denke über etwas nach, was mich in letzter Zeit in verschiedenen Verkehrssituationen beschäftigt hat: Wenn ich als Fußgängerin eine Nebenstraße überquere, müssen mich von der Hauptstraße abbiegende Verkehrsteilnehmer vorlassen? Ich frage Chat. Chat sagt zu meinem Erstaunen Ja.
Ich weiß, dass ich das so in der Fahrschule gelernt habe, aber das ist lange her und ich dachte, es sei vielleicht irgendwie veraltet, denn: In ganz Berlin. Macht das kein Mensch. Nie. Nie, nie, niemals, alle Autofahrer und Radlerinnen biegen in die Nebenstraßen ein, selbstverständlich davon ausgehend, dass sie Vorfahrt haben. Sie sind ja auf der Straße. Du nur auf dem Gehweg. Auf der Straße wird gefahren, auf dem Gehweg wird gestanden, sie fahren, du guckst dich vorsichtig nach allen Seiten um, bis die Bahn frei ist. Ich schau vom Handy hoch und betrete die Nebenstraße. In diesem Moment zieht ein Mann auf einem Lastenrad mit Kind drin dicht an mir vorbei, so dicht, und mit so hoher Geschwindigkeit, dass ich zurück auf den Gehweg springen muss. Dabei pfeift er. So ein langes Pfeifen, das mich warnen soll.
Nee, schrei ich ihm nach, ich hab hier Vorfahrt, du Arsch! Frag mal Chat GPT!
Das Ganze ist natürlich hochkomisch. Überfahren werden beim Vorfahrtsregeln recherchieren.
Was ich aber gar nicht witzig finde. Das ist das Pfeifen. Das bringt mich noch die ganze restliche Linienstraße entlang zur Weißglut. Ich meine, was bin ich, ein Hund?! Benutz deine Klingel oder ruf Vorsicht, du beschissener Öko-Papi (Vollbart, Helm) mit deinem Macho-Lastenrad-SUV-Gehabe! Kompensier woanders.
Pfeifen, ey, würdeloser gehts echt nicht. Und dann noch von Mann zu Frau.
Aber klar, die kleine Tochter im Lastenrad, die hier gerade gelernt hat, dass man Leute anpfeift, damit man ja nicht die krass hohe Geschwindigkeit drosseln muss, die man so schön drauf hat, und womöglich vorsichtig und defensiv fahren muss wie der letzte Schwächlings-Loser, die muss in die Kita und du in deine Öko-Fabrik.
Wahrscheinlich arbeitest du bei einer NGO, die sich für mehr Radwege einsetzt und wir kennen uns eigentlich irgendwo her.
November 2025 – ups
Die Regierung beschließt die „Aktivrente“: 2000 Euro steuerfrei bekommt, wer nach Renteneintritt weiter arbeitet. Die Aktivrente gilt nicht für Selbständige. Ich rege mich ziemlich darüber auf, bin damit natürlich nicht die einzige, und entdecke kurze Zeit später irgendwo eine Petition gegen diese Regelung. Erwerbstätige zweiter Klasse? lautet der catchy Empörungstitel.
Ich unterschreibe die Petition und schicke sie sogar im Bürokontext (alles Solo-Selbständig auf dem Weg in die Altersarmut) herum. Sowas mach ich höchst selten. Richtig wohl ist mir auch diesmal nicht dabei. Die Petition an sich erscheint mir ein komisch abgekartetes Business, ähnlich der Großdemo und dem Bürgerentscheid und mit ähnlichen Problemen der Unterkomplexität behaftet, sowie der Abhängigkeit von irgendwie unsichtbaren OrganisatorInnen, die es aber braucht, weil die sich damit auskennen, wie man sowas professionell macht und auf die man sich verlassen muss.
Ich werde von den PetitionsbetreiberInnen, die auf Social Media schon recht aktiv zum Thema sind, darüber informiert, dass nun in einem nächsten Schritt alle Abgeordneten befragt wurden, wie sie denn so zur Fragestellung stehen.
Ich klicke auf den Button, der das Parlament abbildet, alle Abgeordneten sind jeweils als kleine leere Kreise markiert. Nur ein erster und einziger Abgeordneter, der offenbar blitzschnell auf die Anfrage reagiert hat, hat sich bisher geäußert, man erkennt es am mit seinem Bild ausgefüllten Kreis. Er unterstützt die Petition. Er gehört zur AfD.
Na toll. My personal Brandmauer, eingerissen von mir selbst. Das wird erstens ne Menge Leute davon abhalten, die Petition zu unterschreiben, zweitens fühlt es sich natürlich gleich mal höchst beunruhigend an, mit der AfD einer Meinung zu sein. Wobei die bei Selbständigen natürlich an den Handwerksbetrieb oder den Sanitärfachhandel denkt und nicht an irgendwelche elenden Kulturarbeiterinnen. Liegts an mir, hab ich was nicht durchdacht, bin ich auf irgendwas reingefallen, sind die PetitionsbetreiberInnen auch aus der Ecke? frage ich mich nervös. Was, wenn die anderen, mit denen ich die Petition geteilt habe, das sehen und sagen, Ey, bist du AfD oder was, machst dich da mit deren Positionen gemein und schickst mir diese rechtsradikale Scheiße auch noch?
So ist sie, die AfD, gewieft und schnell. Position besetzen und schon sind wieder Fische im Netz. Na, seht ihr, ist doch gar nicht so schlimm.
Ist die Position jetzt also nicht mehr beziehbar, kann ich nicht mehr fordern, dass die Aktivrente auch für Selbständige gilt, weil die AfD dieselbe Haltung dazu hat? Sind die Beweggründe, die die AfD hat, eine Position zu vertreten, egal, Hauptsache man bekommt hinten raus das Gesetz, das man haben möchte? Und wenn es dieselben Beweggründe sind, wie hier, ist es dann okayer als wenn nicht?
Here we are, in the middle of dilemma, und das nur Zuhause am Rechner. Und alles bloß, weil ich mal wieder den Fehler begangen hab, meine Bürger-Empörung am Frühstückstisch mit einem Klick auf einen Button in einen demokratischen Mikro-Einsatz zu verwandeln?
November 2025 – Verlorene Tochter
Ah, die verlorene Tochter, scherzt mein Vater, als ich ihn zum Geburtstag anrufe. Die Umkehrung ist so unverschämt, das Missverständnis so groß, dass es mir wie immer die Sprache verschlägt.
Im Verlauf des Gesprächs erzähle ich ihm beiläufig, dass ich ihm zweimal eine Mail geschrieben habe, frage, ob ihn die erreicht haben. Nein, das vergisst er immer, dass er das überhaupt hat, das Mail. Aber dann kann er da ja mal wieder reinschauen, meint er.
Im Hintergrund spricht seine Frau, die er immer mithören lässt, bestätigend mit. Ja, du hast Mail, ja, da guckst du manchmal lange nicht rein, genau, da kannst du ja jetzt mal wieder reingucken.
Ein paar Tage später schreibt er mir tatsächlich zurück. Meine Frage war persönlich, sie bezieht sich auf meine Geburt, die ersten sechs Wochen als Säugling und seine Erinnerungen daran.
Er schreibt mir genau das, was er, in den seltenen Momenten, in denen ich danach gefragt hat, schon immer dazu gesagt hat, was ich also schon immer darüber weiß, und was er nun, so scheint es mir, rasch, im Modus des Erledigens, ohne eine Nuance zu verändern, wiederholt wie einen erlernten Text. Auch diesmal nichts Neues, nichts Anderes. Nichts Persönliches. Doch genau danach habe ich, meinen Mut zusammen nehmend, in diesen seinen späten Jahren noch einmal zu forschen versucht.
Er reicht mich weiter an seine Frau, weil die, wies der Zufall will, den Namen der Klinik kennt, in der ich geboren wurde. Auch das war eine meiner Fragen. Ich versuche, das Gespräch mit ihr knapp zu halten, doch es kommt, wie es immer kommt, am Ende schildere ich ihr auf ihren Vorschlag hin, die damalige Situation und meine Fragen. Denn, so sagt sie, sie könne ja nochmal mit ihm sprechen, vielleicht bekomme sie ja noch etwas aus ihm heraus.
Er ist zu diesem Zeitpunkt längst wieder in seinem Zimmer verschwunden. Seine Empfehlung, bevor er das Telefon an seine Frau weitergereicht hat, war, einfach ihr eine Nachricht zu schreiben. Eine Empfehlung, die sie jetzt am Ende unseres Gesprächs noch einmal wiederholt: Ich solle doch einfach ihr texten, dass ich ihm eine Mail schicke, bevor ich ihm eine Mail schicke. Denn sie sei ja immer erreichbar.
November 2025 – gescheiterte
Existenz
November 2025 – Unnötige
Eskalation
Oder
nötige Eskalation?
Woher soll man das wissen.
November 2025 – Progress
Mich irritieren die Progress-Erzählungen älter werdender Menschen, die in Artikeln, Literatur oder am Tisch das größer werdende Wissen preisen, die zunehmende Gelassenheit, die wachsende Zufriedenheit. Die den Werdegang als Vorwärtsgang beschreiben, klar gabs mal einen Rückschlag, aber der war eigentlich ein Vorschlag, die den Gleichmut schildern, der die Sorge ablöst, die von der Freiheit sprechen, die Ängste hinter sich zu lassen. Ich begreife das nicht. Mir geht es anders. Ich habe den Eindruck, ich weiß gar nichts mehr, ich verstehe immer weniger. Was ist gut, was schlecht, wie soll man sich verhalten, wie nicht, wer hat recht, wer nicht, was ist wichtig, was nicht, ich habe keine Ahnung. Die Dinge beginnen, sich zu wiederholen, die Ratlosigkeit nimmt nicht ab. Reingehen oder abwarten, weich sein oder hart, offen oder verschlossen, annehmen oder ankämpfen. Nichts wird leichter, alles wird schwerer. Weil die Last größer wird, die sich summiert. Und ich bin müder. Nichts öffnet sich, alles wird enger, nichts wird klarer, alles verschwimmt, wird langweiliger, erschöpfender, sinnloser, egaler. Genau deshalb wächst die Angst. Der Druck. Die Rigorosität.
November 2025 – Ich bin CEO
von Sachen schwer machen.
Diesen Satz klaue ich mir von einer GenZ-Vertreterin, die neben mir im Café mit einer Freundin ein intensives Gespräch über Selbsteinschätzung (sie machts sich schwer) und Gefühle in Job, Beziehung, Freundschaft spricht, so schnell, dass ich den Eindruck habe, ein Tiktok-Video zu sehen oder bei Youtube auf dreifache Geschwindigkeit geklickt zu haben.
Love it.
November 2025 – Nein,
ich finde nicht allein raus.
November 2025 – Keeping up
appearances.
November 2025 – Das Jahr
wird bald enden.
Schreibe ich aus einem Buch ab.
November 2025 – Migräne
Mein rechtes Auge tropft. Von innen wird es von kleinen Piranhas angefressen, die drücken gegen das Auge, den Augapfel, sein surrounding, als wollten sie raus. Aber da sind Knochen. Meine ganze rechte Seite druckvoll, die Nase geschwollen, Nasenspray hilft, auch die Nase tropft, die Zähne tun weh, das Zahnfleisch wie geschwollen. Die Kopfhaut, die Haut auf der Stirn, die Augenbrauen, die Nasenwurzel, die Schläfen, haben sich zusammen gezogen, alles hat sich zusammen gezogen, der Schmerz hört nicht auf, nachts nicht, tags nicht, ein hartnäckiges Da, hat sich reingegraben, reingefressen in meinen Schädel, dem man das ansieht. Das Schädelige. Noch einen Tag, noch eine Nacht, noch einen Morgen, bitte geh, geh Jetzt, du stiehlst mir meine Zeit, meine Lebenszeit, die Geräusche zu laut, viel zu laut, die Lichter zu laut, viel zu laut. Was soll man tun, mit all der schlaflosen dumpf brummenden Zeit, ich kann mich nicht konzentrieren, ich bin dumm, in meinem Kopf nimmt der zum Platzen gespannte Ballon zu viel Platz weg, ich gehe spazieren, ich atme. Atme. Atme. Durch die Nase, kalte Luft, ein, durch den Mund, aus. aus aus. Thomapyrin Koffein Paracetamol. Nichts funktioniert so wirklich. Nehm ich zu wenig, nehm ich zu viel, verstärken sie die Übelkeit?
November 2025 – Vogelkunde
Früh am morgen, ich liege im Bett. Die Sonne scheint. Durch den Spalt zwischen meinen Vorhängen sehe ich einen winzigen Vogel vor meinem Fenster. Er krallt sich mit seinen Beinchen am Waschbeton meiner Hauswand fest und schaut misstrauisch zu mir herein. Ich wage nicht, mich zu bewegen. Eine Kohlmeise, Leute! Dass sie da ist, ist eine Sensation!
In unserem Hof regieren die Krähen, kein Wildvogel hat sich hier je länger aufgehalten, schon gar nicht wegen ein paar Meisenknödeln oder sonstigen Fütterungsversuchen. Ich beschließe, nachher augenblicklich zu Rossmann zu gehen, und mal wieder zu schauen, was sich in Sachen Vogelfutterentwicklung so getan hat. Dass die Vögel für das bisherige Vogelfutter auch so gar nicht ins Risiko gehen wollten, kann ich verstehen, es sieht mega trocken und langweilig aus und das Fett in den Knödeln wie vom Fettdiscounter, eklig und cheap. Oder mal zu Manufactum?
Die Meise hängt noch eine Weile am Steinchenuntergrund der Betonwand herum und zeigt mir ihren Bauch. Dann fliegt sie weg. Ich stehe auf und öffne das Fenster, um zu sehen, ob da noch mehr sind oder wo sie hinfliegt oder keine Ahnung warum. Da sehe ich, dass die Fensterbank über die ganze Länge vollgekackt ist.
Ich überlegs mir nochmal mit dem Anfüttern.
Am nächsten Abend. Ich trete aus dem Haus, gehe ein paar Meter die Häuser entlang. In einer Einbuchtung zu einem Kellerfenster liegt ein toter Vogel. Es ist eine Kohlmeise. Sie liegt auf der Seite, ihr kleiner Bauch leuchtet gelb. Sie sieht so zart aus. Jemand muss sie vom Asphalt hochgehoben und hier hingelegt haben. Kinder vielleicht?
Neben ihr liegt wie bei einer Trauerfeier ein kleiner Zweig mit hellen trockenen Blüten.
November 2025 – Das ist
ein schwieriges Alter.
Sagt jemand am Nebentisch. Ich weiß, weder ich noch mein Alter sind gemeint, aber es stimmt trotzdem.
November 2025 – Geister
Da drüben am Fenster habe ich mit dir gesessen. Ich weiß nicht mehr, wie die Stimmung war. Ich glaube gut. Wir haben geschrieben, wie so oft, jeder für sich, du auf deinem Laptop, ich auf meinem, ihre Rücken haben sich berührt am oberen Rand. Wir haben gegessen, gesprochen. Was soll daran schlecht sein? Heute bin ich alleine da. Es ist viel los. Ich schaue rüber zu dem Tisch. Da sitzt eine Familie. Im Hintergrund sieht man das Riesenrad.
Immerzu sehe ich Geister.
Ihr vergesst. Überschreibt. Löscht. Ich sehe Geister.
Auch dieser Ort ist dein Ort geworden. Dabei war es mal meiner. Ich habe ihn mit dir geteilt. Das war nett von mir. Was gehört mir eigentlich noch? In dieser Stadt? Auf dieser Welt?
November 2025 – Fashion-Gringe
Weihnachten, Silvester, modetechnisch die schrecklichste Zeit,
auf H&M Plakaten hässliche Glitzer-Jacketts, grüne Samthosen und bordeauxrote Kleider, ansonsten Kuscheljacken aus Teddyfell, Kuschelhosen aus Flanell, Mützen mit Rentieren, Lingerie aus klebriger Kunstseide, das alles wird in den nächsten Wochen die Kleiderständer und Regale der Läden verstopfen, bis es ab Januar endlich interessant wird mit der Wintermode.
November 2025 – la valise
Im ICE Restaurant stehe ich kurz auf und gehe zur Gepäckablage hinter mir, um etwas aus meinem Koffer zu holen. Der Koffer ist weg. Die Leerstelle, die er hinterlassen hat, verblüfft mich. Für einen Moment füllt mein Hirn sie mit dem vertrauten schwarzen Rollkasten auf, sogar der zuletzt auf Stufe 1 herausgefahrene Griff erscheint deutlich. Dann realisiert es, das Hirn: Die Lücke bleibt. Ich spreche unseren eher unsympathischen Kellner an, der am Tisch hinter mir hantiert. Haben Sie meinen Koffer gesehen? Er schaut auf die Lücke, ebenso irritiert wie ich, und dann zu dem Koffer, der an der anderen Wand der Gepäckablage steht, meinem verschwundenen Koffer quasi gegenüber. Oh nein, sagt der Kellner, jetzt hat der Franzose den falschen Koffer mitgenommen.
Der Franzose. Der Franzose war nur kurz im Restaurant. Ein Mann um die siebzig, der, wie so viele Franzosen, nur Französisch sprach, und ein, zwei Sachen bestellt und rasch verzehrt hat. Er saß mit dem Rücken zu mir. Ich bekomme Panik: Hatten wir einen Halt seit er das Restaurant verlassen hat, ist er mit meinem Koffer ausgestiegen, ich war so vertieft ins Lesen, im Koffer ist mein Laptop, fällt mir siedend heiß ein, wie soll ich die nächsten Tage arbeiten, wegen der Klamotten gehts ja vielleicht, aber mein Schlüssel!?, wie soll ich zuhause reinkommen, ha!, den Schlüssel habe ich vor der Fahrt noch in meine Umhängetasche getan, damit es später vor der Haustür schneller geht, mein Geldbeutel, mein Handy sind zum Glück auch da drin. Der Kellner läuft augenblicklich los, den Gang hinunter, ich ihm nach, verblüfft, dass er das macht, er scannt mit den Augen links rechts die Reihen ab. Ich komme mir ein bisschen dumm vor, ein Abteil, noch ein Abteil, noch ein Abteil, das ist ein langer Zug, der Kellner macht Tempo, ich sehe wenig Aussicht auf Erfolg, ich glaube nicht, dass ich den Mann wieder erkennen würde, und der Zug hält gleich an der nächsten Station, wo ist er bloß hingelaufen, jedenfalls nicht zu seinem Koffer! Ich bleibe bei der Zugbegleiterin stehen, an der wir vorbeikommen, frage, ob sie vielleicht eine Durchsage machen kann. Sie lässt sich nicht beirren bei ihrer Fahrkartenkontrollarbeit, antwortet erstmal gar nicht. Ich beschließe zu warten, was passiert. Irgendwann kommt der Kellner zurück: Er hat’s gemerkt, sagt er, er ist schon auf dem Weg zu Ihnen, er hats selber gemerkt, dass er den falschen Koffer hat, Puh, sage ich erleichtert, da ist mein Laptop drin, Ja, sagt er, kann ich nichts für. Komischer Typ.
Da kommt der Franzose mit meinem Koffer durch den Gang gewankt, er redet irgendwas auf Französisch, ich verstehe leider nur valise, aber wir freuen uns beide. Wir gehen gemeinsam ins Restaurant zurück. Er nimmt seinen Koffer, (wie man die beiden verwechseln kann, versteht kein Mensch, seiner ist ein ausgemergelter Toplader aus Stoff in Hellgrau.) Ach, was wäre das Ganze doch für ein supernices Meet Cute, wenn er ein bisschen jünger und weniger verpeilt wäre. Er nimmt seinen Koffer, excuséd sich nochmal und haut ab.
Die vier Männer am Nachbartisch, interessierte, bierstoische Zeugen des ganzen Dramas, sagen, dass sie auch lieber meinen Koffer genommen hätten. Ich bedanke mich nochmal herzlich beim Kellner, den das nicht tangiert, er erwartet ein hohes Trinkgeld, bekommt er auch.
Ein bisschen, nur ein winziges, bedaure ich, dass ich nun nicht mit dem Koffer des Franzosen nach Hause gehe, also niemals erfahren werde, was da so drin ist.
Oktober 2025 – schlafen
Ich besuche für ein paar Tage N, die gerade für ein paar Wochen in einer anderen Stadt ist. Die Wohnung, in der sie wohnt, hat zwei Zimmer, eines mit zwei Betten, eines mit einer Schlafcouch. Ich bin überrascht, dass sie das zweite Bett im Schlafzimmer für mich vorgesehen und bezogen hat. Für einen Moment weiß ich nicht, wie ich diese Nähe finden soll und überlege sogar zu sagen, dass ich lieber auf der Couch schlafen würde. Wir schaun mal, ob das geht, sagt sie, bevor ich was sagen kann und denke, ach, recht hat sie.
Ich schlafe neben ihr, ruhig und lange, und ohne aufzuwachen vor Angst.
Im Grunde ist das also alles, was es braucht, seit Stunde Null.
Oktober 2025 – Millenial-Party
Eine Millenial Party. Da Oktober ist, ein Motto: Was hat euch gehauntet in den vergangenen Dekaden?
Auffallend viele dieser Endzwanziger/Anfang Dreißiger kommen als irgendwas mit Internet bzw. Social Media. Als Smartphone zum Beispiel: Ganzkörperpappe um den Hals, oben nur noch ein Akkubalken, (Panik überträgt sich sofort), die Vorderseite übersät mit Apps, die DB-App prominent unten rechts für schnellen Zugriff platziert, was ich witzig finde. (Viele hier kommen aus der Theaterwelt, so die Selbstbeschreibung, die sind ständig unterwegs). Oder als Kommentarspalte: Pappe um den Hals mit einem aus Social Media gezogenem Kommentar (she looks like a girl who acts all sweet but when she gets criticism she goes home and microwaves her hamster; keine Großbuchstaben). Oder mit einer aus zwei Handys gebastelten Brille bzw. Brett vorm Kopf. Dieser Gast allerdings ist kein Millenial mehr, die um den Kopf geschnallten Handys sind aus den zehner Jahren, ein iPhone-Early-Adopter. Auch andere beklagen auf unterschiedliche Weise den Internet- und vor allem den SM-Wahnsinn.
Ich unterhalte mich in der Küche mit einem der Millenial-Gäste darüber, teile meinen Eindruck, dass das Thema hier viele zu haunten scheint. Ja, sagt er, und nickt wissend und ein wenig bekümmert. Ich frage ihn, wo er denn so ist, auf Insta, Tiktok? Insta kannst du vergessen, sagt er fauchend, das ist nur noch Werbung. Also, Selfmarketing, fügt er hinzu und wischt mit seinem Blick über die versammelten Theaterwelt-Angehörigen. Du bist da nicht?, frage ich. Doch, ich war da, super viel, und schon immer noch, hab ständig Stories gepostet, aber … er macht eine wegwerfende Handbewegung. Fragt stattdessen, ob ich bei TikTok bin. Ich hab die App, sage ich. Nutz die aber nur zu Recherchezwecken, wenn ich mal was nachgucken will, wie irgendwas funktioniert. NPCs, Booktok, Tradwives oder sowas.
Ich erzähle ihm, wie geschockt ich mal über die ersten zehn Vorschläge war, die Tiktok mir nach langer Abwesenheit gemacht hat, und die doch bestimmt voll mein Ding wären und die ich gerne direkt hier mal anklicken könnte. Das Harmloseste waren zwei non-thematische InfluencerInnen, die berühmt waren, weil sie berühmt waren und von denen ich peinlicherweise noch nie gehört hatte, ansonsten Pornos, aber gleich so im Stil von: „cute Dreizehnjährige Höschen“, und so, dass man sich fragt, wieso ist das eigentlich nicht verboten, und dann noch offensichtlich rechte bis rechtsradikale Seiten. Offenbar ist TikTok bei den Vorschlägen davon ausgegangen, ich sei ein durchschnittlicher junger, männlicher Nutzer, den das statistisch erwiesenermaßen brennend interessiert. Er nickt wieder, in dieser Mischung aus bekümmert und wissend. Sagt, er habe sich seinen Algorithmus inzwischen ganz gut zurecht gebaut und erzählt mir, dass TikTok einfach viel schneller ist und viel näher dran als alles andere. Er bezieht seine Informationen und Nachrichten praktisch nur noch von dort. Er beschreibt Videos von ICE-Razzien und -Festnahmen, die man dort so unmittelbar und authentisch verfolgen kann, wie nirgendwo sonst. Oder Videos aus Gaza. Oder aus der Ukraine. Bis das beim 55-jährigen SZ-Redakteur angekommen ist, der das dann eventuell in einem Artikel zwei Wochen später aufgreift, sei alles längst vorbei und die Welt woanders. Gegen Tiktok kann man das echt voll vergessen, schnaubt er und schüttelt den Kopf. Ich nicke, wissend und bekümmert wie er, denn dazugehören will man ja schon.
Dieses Gespräch beschäftigt mich noch länger. Zunächst frage mich natürlich, was er eigentlich dachte, wie alt ich bin. Ich glaube nicht, dass er davon ausgegangen ist, dass ich in etwa so alt bin wie der SZ-Redakteur, (irgendwie hat er mich im Kontext für alt, aber doch ein wenig jünger gehalten, wer lädt auch schon Menschen in Muttis Alter auf seine 30er Party ein), und ich hatte auch überhaupt kein Interesse daran, ihm diesbezüglich reinen Rotwein aus der Toscana einzuschenken, ha ha. Zum einen erfährt man undercover mehr. Vor allem aber hätte ich mich geschämt. Denn immerhin bin ich im selben Alter wie der geschmähte SZ-Redakteur, und deshalb wie ebendieser verdächtig, mich in meiner Dinosaurierhaftigkeit zu suhlen und den Meteoriteneinschlag nicht gehört zu haben. Und da ist ja auch definitiv was dran. Gleichzeitig spüre ich während des Gesprächs Widerspruch im Bauch heranwachsen, getriggert vielleicht einerseits durch die pauschale Abfälligkeit gegenüber dem SZ-Redakteur, mit dem ich mich ja doch vielleicht auf kleiner Flamme identifiziere und solidarisiere. Ich meine, der könnte theoretisch ein Freund von mir sein. Wenn er ein freier, armer Journalist wäre zumindest. Andererseits vielleicht auch durch sein zwar waches und herrlich kategorisches, denn wach und kategorisch ist ja immer catchy, aber wenig durchdachtes Statement.
Hat er Recht damit, dass Tiktoks Unmittelbarkeit und Ungefiltertheit, der Eindruck jetzt und hier dabei zu sein, so viel wahrhaftiger und glaubwürdiger ist als der gediegene Journalismus der deutschen Printmedien. Natürlich ist da was dran, das ist nicht von der Hand zu weisen. Wenn ich ein verwackeltes Video sehe, auf dem jemand selbst um sein Leben rennend, einen Bombeneinschlag, Tote und Verletzten filmt, um der Welt da draußen zu zeigen, was hier wirklich los ist, dann bin ich natürlich auch von so etwas berührt wie der „Echtheit“ des Moments. Ich verstehe die Verzweiflung und die Wut, die im Auslösen des Bildes steckt, ich sehe den Versuch, mit so einem Clip an den klassischen Medien und ihren Gesetzen vorbeizukommen, eine andere Art von Öffentlichkeit zu erreichen, ein Dokument abzuliefern, vom himmelschreienden Ereignis, einen Beweis, hinter den doch Bitteschön jetzt aber wirklich niemand mehr zurück kann.
Doch zu glauben, dass ein Bild im Kontext von Social Media irgendwie wahrhaftiger ist, immer schon mehr weiß und mehr sagt, als ein SZ-Artikel je sagen könnte, scheint mir fatal. Die Bilder sind gerade auf Social Media nicht unmittelbar, nicht ungefiltert und schon gar nicht unschuldig. Sie sind den Gesetzen der Social Media unterworfen, der immer kürzer werdenden Gewinnspanne zwischen Auftauchen und im Ozean ersaufen. Kaum sind sie hochgeladen, verkommen sie.
Die Bilder werden gejagt, sie jagen einander, sie jagen uns. Sie werden geliked (!) und geteilt, manchmal werden sie zum Bild der Sekunde. Sie reihen sich ein in Tausende und Abertausende von Bildern. Sie sind banal, weil sie zu ihrer eigenen Banalisierung beitragen. Sie sind obszön, weil sie mit ihrer Unmittelbarkeit um Gewinn buhlen. Sie behaupten Aussagekraft, ohne aussagekräftig zu sein.
Ich bin jedenfalls froh über jeden old school Redakteur, der von einem noch existierenden Printmedien bezahlt wird und sich hinsetzt, um die Bilder anzuhalten, und den Atem, und das alles ein bisschen einordnet. Dass er schlecht recherchiert und niemanden vor Ort interviewt und sich zu fein ist für die Tiktok-Clips, das kann man ihm zu Vorwurf machen, wenn es denn so ist. Aber zu sagen, man könne diese Art von Medialität echt vergessen, weil nur noch Tiktok Wahrheit und Erkenntnis liefere, da geh ich alte weiße Frau echt nicht mit. Abgesehen davon, dass das auch nicht weit weg ist von Lügenpresse. Dem Schlagwort, das ja immer auch die Konkurrenz aufmacht zwischen Boomer-Journalismus und freshem Social Media.
Ist gehauntet sein von Social Media lediglich eine gewinnbringende Akademo-Kunstszene-Behauptung auf der Millenial-Party? Den Pinzipien entgegentreten oder aus ihnen heraustreten, das geht nicht? Nein, irgendwie nicht. Leiden und im Leiden überleben sind eben zwei verschiedene Sachen.
Oktober 2025 – Kontakttasse
Manchmal gehe ich abends noch in eines dieser Ketten-Cafés, einen angenehmen kleinen Spaziergang weit weg von mir. Man kann dort im Fenster sitzen und auf die Feierabendstimmung schauen, die sich in der jetzt früh beginnenden Dämmerung ausbreitet. Ich trinke eine Tasse heiße Schokolade mit laktosefreier oder Hafermilch, lese ein Buch und daddle auf dem Handy herum.
In dieser Kette gibt es seit kurzem eine Aktion. Wer mag, bekommt eine andere Sorte Tasse als sonst, eine mit speziellem grünem Design, irgendwelche stilisierten Menschen, die Gruppen bilden oder so. Diese Tasse soll signalisieren, dass man offen und bereit ist für ein Gespräch mit anderen. Das soll gut sein gegen die laut Feuilleton und empirischer Soziologie grassierende Einsamkeit und die (Dating)plattformen, die uns alle quälen, weil das analoge In-Kontakt-Treten quasi zu etwas Pathologischem verkommen ist. Das Café beteiligt sich mit seiner Tassenaktion jedenfalls aktiv an der Lösung dieser gesellschaftlichen Problematik.
Schon mehrfach habe ich, wenn ich abends da war, von ein und demselben Barista mein Getränk ungefragt eine dieser Kontakttassen bekommen. Ich frage mich natürlich, warum. Denkt er, Alter, die sieht so depri aus, die kann das dringend mal gebrauchen, dass sie jemand anquatscht? Denkt er, wieso ist die immer allein da, die ist doch ganz nett, kann man die nicht mal mit einem der vielen älteren Männer, die hier abends auch immer solo rumsitzen, verkuppeln? Vielleicht spricht sie ja ermutigt durch die Tasse mal einer an, und auch wenn sie vielleicht zuerst gar nicht kapiert, dass es wegen der Tasse ist, die ich ihr untergejubelt habe, kommen sie ins Gespräch und werden ein Paar und ich werde der Initiator von Glück und Liebe gewesen sein und eines Tages zur Hochzeit eingeladen und in gerührten Dankesreden erwähnt werden, als Teil der romantischen, witzigen Kennenlerngeschichte der beiden und darüberhinaus auch noch mit meiner Band gegen Geld auftreten?
Vielleicht sind die neutralen Tassen aber auch einfach immer nur alle in der Spülmaschine.
Oktober 2025 – Bauarbeiter
In der Wohnung über mir Baustellenlärm. Ausgerechnet jetzt, ich hab grade Schreibkurs und verstehe kein Wort von dem, was die Leute in ihren vielen Adventskalender artigen Zoom-Fensterchen sagen.
In der Pause gehe ich hoch, klopfe. Ein Mann öffnet, breit, kräftig, guckt um die Ecke, ein zweiter guckt vom Boden hoch auf dem er werkelt. Beunruhigte Mienen. Die Wohnung hinter ihnen leer, ein Renovier-beiger Eindruck aus Folien, weißer Farbe, hellem Laminat durch die halb geöffnete Tür.
Ich sage mein Sprüchlein auf, will wissen, wie lange sie heute arbeiten und ob noch die nächsten Tage. Dann könnte ich gegebenenfalls ins Büro umziehen.
Er signalisiert, dass er nichts versteht. Ah, sage ich. Englisch? frage ich. Rumania, sagt er. Oh, sage ich, das kann ich nicht. Er greift zum Handy, tippt routiniert, hält es mir hin. Ich spreche in irgendein Übersetzungsprogramm, die KI schreibt synchron mit, während ich rede, der Screen füllt sich rasch mit meinem Sprechen, was mich nervös macht, hübsch siehts aus, so rumänisch, getupft mit kleinen Akzenten oben und unten, es wird immer länger, komplizierter, ich bekomme so auf die Schnelle keine Klarheit in meine Sprache, so langsam wird’s peinlich, er liest mit. Mit einem Nicken beendet er meinen Wortschwall. 18 Uhr sagt er, in dem er mit den Fingern eine Sechs zeigt. Dazu wedelt er mit der waagerechten Hand: ungefähr. Und morgen? Nu.
Nu. Nein auf Rumänisch, ich recherchiere es später. Nu, ist das nicht wundervoll?
Okay, sage ich und gehe wieder runter.
Ich hätte gerne den Text gehabt, den die KI so eifrig hat mitfließen lassen. Mein Gequatsche auf Rumänisch. Ich hätte es rückübersetzen können, um zu schauen, was ich da geredet habe und was sie verstanden hat.
Nachts höre ich in den nächsten Tagen wie jemand abends oben wäscht, herumläuft, leise. Einmal eine zweite Männerstimme, einmal eine Frauenstimme. Vielleicht pennen sie da. Die Bauarbeiter. Eine leere Wohnung. Ein Luxus in Berlin. Vielleicht besser als in der Unterkunft, in der sie sonst sind.
Was sind das wieder für Geschichten. Arbeit und Wahnsinn im Kapitalismus natürlich.
Oktober 2025 – Der Anrufbeantworter
Wenn ich Zuhause anrufe – denn so sagt man, wenn man sich bei den Menschen meldet, bei denen man aufgewachsen ist – und keiner da ist, geht der Anrufbeantworter dran. Dann höre ich die Stimme meiner Mutter.
„Guten Tag“, sagt meine Mutter. „Sie haben den Anschluss von Vorname ihres Mannes und ihr Vorname, gemeinsamer Nachname in Wohnort gewählt: Ziffern der Hauptnummer. Leider sind wir im Moment nicht erreichbar, bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton. Vielen Dank.“
Es muss kurz nach der Jahrtausendwende gewesen sein, als sie und ihr Mann, mein Zweitvater, den AB eingerichtet haben. Er löste damals den Anrufbeantworter ab, den sie jahrelang gehabt hatten, eine Box aus grauem Plastik mit einem Kabel, das in einer sehr speziell aussehenden Schnittstelle in der Steckdose endete, und mit einem Lichtpunkt, der blinkte, wenn jemand darauf gesprochen hatte. Sein Nachfolger war kein Apparat mehr, sondern ein digitaler Anrufbeantworter der Telekom, eine Mobilbox.
Sie muss den Text vom Blatt abgelesen haben, so klingt es zumindest. Ihre Stimme ist klar und deutlich. Meine Mutter spricht gut, eine ihrer Stärken. Der Text ist eher nüchtern, neutral gehalten. Doch wenn ich den Text höre, höre ich noch etwas anderes. Ich höre, wie genervt meine Mutter ist.
Ich kann mir vorstellen, wie es war. Ihr Mann hatte, weil es längst an der Zeit war, einen neuen Telefonvertrag abgeschlossen, der die Einrichtung einer sogenannten Mobilbox erforderte. Ganz einfach sollte das sein, hatte der Telekom-Mitarbeiter im Laden gesagt, und wie immer war es das nicht. Meine Mutter klingt, als hätte sie den Text mehrfach sprechen müssen, bis es geklappt hat. Ihre generelle Frustration über „die Technik“, die nicht funktionieren will, ist ihr anzuhören, vielleicht auch über den Mann, der neben ihr stand, und von dem sie heimlich erwartet hat, von diesen „technischen Dingen“ nicht überfordert zu sein, der es aber war – und ihr sicher dennoch Anweisungen erteilte.
Bestimmt hat ihr Mann, selbst unter Druck, die Anleitung laut vorgelesen, an den entsprechenden Stellen die entsprechenden Tastenbefehle eingegeben und ihr mit einer abrupten Geste – Jetzt! – den Hörer gereicht, damit sie den vorher gemeinsam festgelegten Text aufsprechen konnte.
Wieder und wieder hat es nicht geklappt, wieder und wieder hat sie gelesen. Man musste im richtigen Moment reagieren und durfte sich nicht verlesen, und das auffordernde Signal im Hörer, das diesen Moment markierte, verbreitete einen gewissen Bühnendruck. Die Technik, digital genannt und neu, war nichts, was ihr annähernd verständlich war, wie ihr schon das Gerät vorher nicht wirklich verständlich gewesen war, das aber immerhin Knöpfe gehabt hatte und damit ein echtes Gegenüber gewesen war, und keine weltweite Welt, von der nun alle redeten und die ihr ein unsichtbares, unbegreifliches Feenland zu sein schien.
Von Versuch zu Versuch ist sie gereizter geworden, gestresster, denn an ihr: Lags nicht. Womöglich haben sie sich gezankt, die Sache abgebrochen, neu angesetzt. Als es endlich geschafft und der Spruch aufgenommen war, haben sie genommen, was sie hatten, auch wenn es nicht allzu freundlich klang. Es erfüllte seine Funktion. Sie haben die Ansage nie wieder verändert. Über 20 Jahre nicht.
Gleich zu Beginn der Ansage, ein Mü vor dem „Guten Tag“, gibt es diesen kleinen abrupten An-Atmer, der, anders als beim üblichen Anlaufnehmen vor einem Satz etwas tiefer zieht, ein wenig schärfer klingt. Als habe meine Mutter ein kleines, feines ts- davorgestellt, das vom Beginn der Aufnahme abgeschnitten wurde. Das gibt dem „Guten Tag“ einen etwas zu deutlichen, leicht Augen rollenden Einschlag. Dieser gereizte Ton – es sind alles Nuancen, feine Striche auf einer Geige – zieht sich über den nächsten Satz bis zur Telefonnummer, sie spricht ihn dicht, ohne große Pausen, als reiche es jetzt aber auch mal. Zwo, sagt sie bei den Ziffern, statt zwei. Meine Mutter ist Jahrgang 1939.
Das „Leider“ vor „Leider sind wir gerade nicht erreichbar“ kommt noch ein Mü patzig, dann beruhigt sich die Sache. Ihre Stimme entspannt sich, klingt friedlicher, es ist ja auch gleich vorbei. Beim abschließenden „Vielen Dank“ geht ihre Stimme ins Versöhnliche, es ist geschafft und der Mist nun aber auch mal erledigt.
Wie oft habe ich diesen Text gehört? Hunderte Male? Tausend Mal?
Ich habe nicht oft Zuhause angerufen.
Meine Mutter hat eher mich angerufen. Und in den meisten Fällen ist sie auf meinem AB gescheitert. Ich bin nicht drangegangen. Aber manchmal war es an der Zeit und wir haben telefoniert. In meinem Fall – die anderen kann ich nicht beurteilen – lief das so ab: Sie sprach. Sie sprach und sprach. Sie berichtete von Menschen aus der Nachbarschaft, von Verwandten, Freunden oder deren Angehörigen, über Schulabschlüsse, Umzüge, Schwangerschaften, Krankheiten, Todesfälle, von Menschen also, von denen es Neues gab, oder denen irgendetwas widerfahren war, und die ich zum großen Teil nicht kannte. Sie sprach ohne Unterlass, ohne etwas zu fragen und ohne Lücken zu lassen.
Ich probierte herum, was passierte, wenn man aufhörte „Mhm“ oder „Ja“ zu sagen. Meistens merkte sie es lange nicht. Ich dachte darüber nach, das Telefon wegzulegen, das Geschirr zu spülen, aufs Klo zu gehen oder einzukaufen. Ich legte das Telefon weg. Mein Herz klopfte bis zum Hals vor schlechtem Gewissen. Ich nahm das Telefon rasch wieder auf und sie sprach noch immer.
Ich klemmte sie mir ans Ohr und legte zumindest nebenher die Wäsche zusammen, versuchte, ein paar Mails zu erledigen, ging tatsächlich aufs Klo. „Bist du noch da?“, fragte sie, wenn man zu lange ausgesetzt hatte mit dem „Mhm“ und dem „Ja“, oder ihr eine Raumveränderung wie eine technische Störung vorkam.
„Ich bin noch da“, sagte ich artig, ohne zu wissen, ob das stimmte. Sie hatte mich ja längst aufgelöst.
Es schien nie einen Unterschied zu machen, mit wem sie sprach oder ob sie überhaupt mit jemandem sprach, sie sprach in den Äther.
Mein Schweigen, das ich gegen ihr Sprechen setzte, und das sie nicht beeindruckte, entsprang einer so enormen Wut, es war eine solche Protestnote gegen die Wand, die sie zwischen uns gebaut hatte, gegen die Indifferenz, die sie mir entgegenbrachte, dass es mir zu gefährlich schien, es zu durchbrechen. Wer weiß, was herausgekommen wäre.
Manchmal, so nach einer Stunde bis anderthalb, das war gefühlt mein Deal mit ihr, versuchte ich ihr zu sagen, dass ich jetzt Schluss machen müsse. Sie sprach dann im Ton so, als würde sie das Telefonat jetzt rund machen, verlor sich aber oft erneut in ihrem Sprechen. Man musste es ihr nochmal sagen. Einmal, so erinnere ich mich, habe ich nach drei versuchten Abmoderationen einfach aufgelegt. Auch da klopfte mein Herz.
Manchmal fragte sie mich am Ende des Telefonats, wie es mir gehe. Es war schwer, nicht aufzulachen. Und führte dazu, dass ich, auch wenn sie mich am Anfang unseres Telefonats danach fragte, oder auch, wenn wir uns sahen, formelhaft und ausweichend antwortete.
Ich weiß nicht, bis heute nicht, ob sie nur versucht hat, die Leere zu füllen, die es zwischen uns gab, oder ob sie versucht hat, die Sprachlosigkeit, mit der ich sie trotzig zu bestrafen versuchte, an sich abperlen zu lassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihr Sprechen am Telefon als Ausdruck unserer Verbindungslosigkeit verstand, so wie ich es tat.
Ich glaube einfach, das Telefon und der unsichtbare Mensch dahinter, ermöglichte meiner Mutter ein Sprechen, in dem sie sich mit sich selbst wohl fühlte, mit dem sie ihre Welteindrücke teilen, ihre Wahrnehmung ausdrücken konnte.
Meine Mutter hat klar und artikuliert gesprochen. Das habe ich von ihr. In Gruppen war sie schüchtern, so wie ich. Sie wurde still, wenn große Reden geschwungen, Witze gemacht oder die eigene Meinung präsentiert werden musste. Anders als die Männer in ihrem Leben, ihr Vater und ihre beiden Ehemänner, die damit sehr gut zurechtkamen.
Sie bevorzugte den intimen Raum des Zweier- oder Kleingruppengesprächs mit Frauen, mit ihren Schwestern oder Freundinnen, oder eben dem noch intimeren Raum des Telefons, in dem sie mit sich selbst und einer verbundenen Person allein war.
Mich haben die Telefonate mit ihr oft in destruktiver Verzweiflung zurückgelassen. Ich wusste nicht, ob ich mir ein Messer in den Arm rammen oder das Telefon in hohem Bogen aus dem Fenster werfen sollte. Beides habe ich nach Telefonaten mit ihr getan.
Doch es ist nicht so, dass ich ihren Erzählungen nicht auch gern gefolgt wäre. Sie hat mit Verve gesprochen, auch wenn sie keine dramatische Erzählerin war, sie berichtete eher. Meist recht Äußerliches, doch sie liebte das Seufzen über tragische Schicksale, das Soap Opera-artige, sie war empathisch, interessiert an den Leben der anderen, sie ging mit. In ihrer Welt lebten ProtagonistInnen, die dem Schicksal ausgeliefert waren, die Dinge erlitten und erfuhren. Genau wie in den Welten, die ich schrieb. Sätze wie „Wie das Leben so spielt“ oder das badische „Da kannsch halt nix mache“ zitierte sie gern.
Während ich schreibe, liegt sie im Pflegebett eines Heims. Meine Mutter spricht nicht mehr. Die Diagnose Alzheimer hat sie vor über zehn Jahren bekommen, zu einem Zeitpunkt an dem aufgrund ihrer Symptome allen und ihr selbst klar war, dass sie daran erkrankt sein musste.
In dem langen und langsamen Verlauf, den ihre Krankheit genommen hat, hat sie immer weniger verstanden. Gesprochen hat sie immer. Geschickt und sprachgewandt wie sie war, hat sie Lücken gefüllt und Klippen umschifft. Wenn ihr ein Wort auf der Zunge lag, das dort einfach nicht wegwollte, benutzte sie ein inhaltlich oder klanglich ähnliches. War ihr in der Mitte eines Satzes nicht mehr klar, worauf sie hinauswollte, nahm sie eine Abzweigung und erzählte im dramaturgisch selben Tonfall einfach von etwas anderem.
Als sie irgendwann keine Sätze mit Sinn mehr sagen konnte, sagte sie trotzdem welche. Sie setzte Versatzstücke zusammen und intonierte so, als handele es sich um einen Satz. In diesen klingenden Sätzen empörte sie sich, trug etwas zum Gespräch bei, fragte, erzählte, schimpfte und lachte.
Ich liebte diese Sprache, bei all der Tragödie, die sie ausdrückte. Sie kam mir gewieft vor, witzig, lebendig. Das Sprechen meiner Mutter wurde originell. Pur. Anarchisch. Es scherte sich nicht. Sie beharrte darauf. Es gehörte ihr.
Ihr Sprechen war keine undurchlässige Wolke mehr, die sie zwischen uns auftürmte. Ich konnte sie, die mir von Stunde Null an ferngeblieben war, sehen.
Ihre Sätze wurden kürzer. Dann löchrig. Die Worte stachen aus ihnen hervor wie Kieselsteine im Sand. Als sie immer weniger davon fand, ersetzte sie sie durch Laute. Sie wiederholte Silben, machte mal nachdrücklicher, mal sanfter sch-sch-sch oder ta-ta-ta-ta.
Einmal, so erinnere ich mich, habe ich Zuhause angerufen. Es war zu einer Zeit, in der ihre Erkrankung schon so weit fortgeschritten war, dass sie mich nicht mehr erkannte. Ich hatte ihren Mann, meinen Zweitvater, der inzwischen ausschließlich ans Telefon ging, gebeten, sie mir zu geben. Sie nahm den Hörer. „Hallo Mama“, sagte ich, „was machst du, wie war dein Tag?“ Sie lauschte meiner Stimme. Sie versuchte zu verstehen, wer ich war und war sich sicher, dass man etwas von ihr wollte. Etwas, das sie nicht mehr leisten konnte. „Ja, wer sind Sie denn“, rief sie barsch ins Telefon, „ich kenne Sie ja nicht.“
Noch heute muss ich lachen, wenn ich daran denke. Es ist, als habe sie eine Wahrheit über uns ausgesprochen, die ich, obwohl sie schmerzhaft ist, erfrischend finde.
Natürlich frage ich mich heute manchmal, ob ihr unaufhörliches Sprechen am Telefon ein frühes Anzeichen ihrer Erkrankung war. Doch sie hat schon so mit mir telefoniert, als die Erkrankung noch Dekaden entfernt war. Ob sie auf Vorrat gesprochen hat?
Ich habe mir oft vorgestellt, wie es sein würde, die Stimme meiner Mutter auf dem AB auch dann noch zu hören, wenn sie gestorben ist. Ich dachte daran, wie traurig es sein würde, dieses Dokument aus einer vergangenen Zeit zu hören, aus einem Leben, das mit ihrem jetzigen schon so lange nichts mehr zu tun hatte und das dann ganz zu Ende sein würde. Wie unheimlich es sein würde, die Anrufbeantworteransage einer toten Person zu hören. Und vor allem, wie schrecklich es sein würde, sie zu löschen.
Kürzlich hat eine vertragliche Umstellung des Telefonvertrages es nötig gemacht, die Mobilbox neu einzurichten. Die Anrufbeantworteransage meine Mutter ist verschwunden. Stattdessen ist eine freundliche Maschinenstimme zu hören.
Ich bin froh, dass die Ansage jetzt verschwunden ist und nicht nach ihrem Tod. Meine Mutter lebt. Morgens holen die Pflegekräfte sie, die seit kurzem vollkommen immobil ist, aus dem Bett, versorgen sie, und setzen sie in den Rollstuhl an einen Tisch im Gemeinschaftsraum. Doch die meiste Zeit liegt sie in ihrem Bett. Sie schläft viel. Sie isst noch immer gern. Sie reagiert manchmal auf Stimmen, auch auf meine, auf das Licht im Raum, auf Berührungen, aufs Radio, auf Musik. Sie ist in ihren Stimmungen. Hell, dunkler.
Manchmal flüstert sie.
Oktober 2025 – Vom Mantel abgeputzt
wie Dreck.
Nein, wie eine Fluse.
Ganz leicht.
Oktober 2025 – Prügel
Das Eckige muss ins Runde. Oder andersherum? Ich prügel auf mich ein, aber passend wird’s nicht. Ich versuche es mit Ja, ich versuche es mit Nein. Ich verstehe einfach nicht, wie es geht und warum nicht. Es ist mir ein Rätsel.
Ich mache lange Listen von Dingen, die ich mag. Die ich machen, versuchen, können will. Ich betrachte die Listen. Dort ist alles gut aufgehoben. Die Erfahrung zeigt. Es hilft nicht, sie lebendig werden zu lassen. Das Ende ist immer das nichtsnutzige gleiche.
Schmerzen. Angst. Einsamkeit. Alles enorm. Ich lese Artikel über assistierten Suizid und staune, dass man inzwischen nur Geld braucht und eine Kapsel. Das beruhigt mich. Ich hoffe, sie räumen einen danach auch auf.
Oktober 2025 – Rechnung
So geht die Rechnung: zu zweit macht alles doppelt so viel Spaß. Alleine nur halb so viel. Was ist dazwischen? Wer ist das oder: Wo? Und wie kommt man dorthin?
Oktober 2025 – Verlorene
Liebesmüh
Oktober 2025 – Es lohnt sich immer
mich zu verlassen.
Es gibt den Leuten Kraft und Schwung.
Oktober 2025 – Ich sitze
in meiner Wohnung. Ich weiß nicht, wer die Person ist, der sie gehört.
Oktober 2025 – Die Alternative
ist das Nichts.
Oktober 2025 – zu was
soll das führen?
Oktober 2025 – Game of Drones
Ich bin mittendrin. Nicht, dass ihr denkt. Ich kann alles sehen. Drohnen über zehn europäischen Ländern. Trump, der den muxmäuschenstillen, aus aller Welt zusammen getrommelten US-Generälen sagt, sie mögen doch gerne lachen, applaudieren. Überhaupt könnten Sie tun und lassen, was sie wollten. Sie müssten nur damit rechnen, dass sie möglicherweise entlassen werden. Ich kann es hören. Nicht, dass ihr denkt. Es gibt zwei N-Words, sagt Trump, die man nicht sagen sollte. Das zweite heißt Nuclear, verrät er der versammelten Mannschaft.
Oktober 2025 – lost
not found.
Oktober 2025 – Sieger
Noch so ein strahlender Sieger.
Mein Penisneid könnte nicht größer sein.
You win, I lose.
Lose, Loser, am Losersten.
vs. Freiheit und Lebenslust.
Es tut den Menschen immer gut, wenn sie mich hinter sich lassen können.
Wär ich nur einer von ihnen.
Oktober 2025 – Merke:
Wenn dir jemand sagt, er will allein sein, bedeutet das, dass er mit jemand anderem zusammen sein will.
Oktober 2025 – Verlust:
Das, was helfen würde, gibt es nicht mehr.
September 2025 – Ich führe ein
Lotterleben.
September 2025 – Insta-Life
Im Mitte-Cafe. „You are such a beautiful family“, sagt eine Frau zu einem Paar mit zwei kleinen Kindern und Hund. Das stimmt. Nichts wurde hier dem Zufall überlassen.
September 2025 – Lehnin
Ich mache zwei Tage Schreiburlaub in Lehnin. Der See ist herrlich. Ruhe, Graureiher, besonders am Morgen sind die Blicke wundervoll. Ich mag das kleine Strandbad mit der sehr leise sprechenden jungen Frau. Mit einem großen Besen schrubbt sie die Entengrütze vom Steg und macht den Kindern die Rutsche an.
Ich schwimme! Sonne, Spätsommer, herrlich, das Wasser schon kalt, so gut es geht mit der Schulter. Fordere sie ein bisschen, fühle mich gut danach.
Das Zimmer ist einfach, aber nett mit roten Stühlen, die Brandenburger Ortschaft verläuft links und rechts einer Durchgangsstraße. Das beste Cafe am Platze war einst eine Prachtskonditorei, heute nicht mehr. Alles, was in der Vitrine liegt, sieht aus wie aus dem Backshop, der Magenweh-Cappuccino tropft auf Knopfdruck aus der Saturn-Maschine.
Diese Bräsigkeit der Leute. Man dumpft hier so rum, hat keinen Bock, abends warten Männer mit hochgetuneten Autos vorm Asia-Imbiss auf ihre Bratnudeln. Alle wollen nur eins: ihre Ruhe. Wer hier fordert, dass sich was ändern muss, meint genau das Gegenteil.
Die große Entdeckung ist die Tankstelle. In einem schmalen Durchgang zwischen Verkaufsraum und Parkplatz esse ich am Hochtisch den besten Kartoffelsalat und die beste Bulette meines Lebens. Dazu natürlich Filterkaffee. Dabei Blick auf den Parkplatz, Truckerromantik. Mahlzeit, sagen die Männer, die hier reinlaufen zu mir, und bestellen Gulasch, Soljanka und Bratkartoffeln bei der Frau hinterm Tresen. Mit Ketchup? Ja. Ein junger Mann putzt die Karosserie seines Autos mit einem Mikrofasertuch. Der putzt sonst nichts.
Die etwas überorganisierte Leiterin des Gästehauses bezichtigt mich am Ende des Frühstücksbetrugs. Bis dahin war es eigentlich ganz schön.
P.S. Später erzählt mir U, inzwischen grandios zurück, dass er oft in Lehnin war. Als er spricht, fällt mir das alles wieder ein. Warum habe ich nicht mehr daran gedacht, obwohl ich es so oft gehört hatte, warum habe ich es nicht mit diesem Ort verbunden, warum habe ich mich ausgerechnet mit diesem Ort verbunden.
September 2025 – Regionalzug
Ein Reh. Ich sehe es aus dem Fenster des Regionalzugs. Es steht ganz allein auf einer Lichtung und frisst.
Nur ein paar Meter danach, ohne dass sie voneinander wissen, ein junger Mann in einem Wäldchen. Er steht Richtung Bahnschienen ausgerichtet und spielt Trompete. Ich höre nichts. Sein Rad lehnt an einem Baum. Warum spielt er hier?
Ich staune über die Geschöpfe. Wie vergnügt sie sind, wie klar, beschäftigt, ohne Angst.
September 2025 – undankbar
H. erzählt mir von ihrem Dankbarkeitsheft.
Vielleicht sollte ich sowas auch mal machen, denke ich.
Oder ich mache ein Undankbarkeitsheft!
Aber das hab ich ja schon.
Es heißt Wackelkandidatin.
September 2025 – ohnOrt
Ich will nur noch weg
und es gibt
kein Wohin
September 2025 – oben bleiben
Ein obdachloser Mann, viele Beutel links und rechts über den Schultern. Alle von Supermärkten. Um seinen Hals trägt er, wie eine überdimensionale Kette, einen dieser Schwimmgürtel, die aus mehreren Blöcken bestehen.
So bleibt er oben.
September 2025 – das Buch der Götter
Immer öfter finde ich in Buchläden Bücher von Menschen, die ich kenne. Warum meins da nicht liegt,
das wissen die Götter.
September 2025 – Knast
Ich ist ein Gefängnis.
August 2025 – Groucho
Ein junges Paar, seltsam verzerrt, ich sehe sie von oben.
Er schaut sie von der Seite an, berührt ihren Oberschenkel, küsst sie auf die Wange, streichelt sie, während sie miteinander sprechen.
Warum macht nie einer der Männer das mit mir? Ist das nicht das große Narrativ, Männer begehren Frauen und wollen sie haben und sind wahnsinnig froh, wenn sie jemanden gescored haben? Warum ist nie einer der Männer froh darüber, dass er mich gefunden hat, warum will mich keiner berühren, immer ist es anders herum, ich wende mich zu, ich küsse, ich streichle. Stattdessen tun sie cool. Ist das ihr Muster oder meins? Mag ich Männer, die mich mögen, die bei mir sein wollen, einfach nicht, frei nach Groucho Marx?
August 2025 – wovor
Ich weiß nicht wovor ich mehr Angst habe, vor dem was kommt oder vor dem was nicht kommt.
August 2025 – W eats W
Word frisst Wackelkandidatin. Über viele, extra dafür freigeräumte Tage hinweg, schreibe ich wegen Wieder-mal-Rücken im Stehen und unter höchstem Schmerzaufgebot, Beiträge, die rückwirkend einen Zeitraum von etwa einem Jahr erfassen.
Word killt eine große Anzahl von ihnen durch ein von mir unvorsichtigerweise spontan durchgeführtes Update. Ich schreie vor Wut, als die Texte weg sind, es kann sein, dass ich heule, das Messer verstecke ich schnell in der Schublade, bevor es mit der Spitze voran in meiner Hand landet.
Ich frage mich, ob das ein Zeichen ist, die W aufzugeben. Wiederholt sich ja eh alles.
Ich schreibe die Beiträge nochmal.
August 2025 – And just like that
1
Ich bin wirklich gespannt zu erfahren, wie es Carrie am Ende ergeht. Wie sie sich und uns aus ihrer Geschichte entlässt. Ich warte darauf, wie auf eine Gebrauchsanweisung: Wie soll man es nehmen, das Leben ab 50.
Ich staune, wie viel Raum sie mir immer zur Identifikation geboten hat, bei größter augenfälliger Distanz Wie sehr auch Carrie immer auf der Hut sein musste, sich nicht zu verlieren, weil sie die Liebe ernst genommen hat.
In And Just Like That hat Carrie wie gehabt Erfolg, Geld und haufenweise Freundinnen. Sie war und ist, auch jetzt, wo sie älter wird, ein netter offener Mensch. Sie war und ist immer geblieben, ein erzählerisch herrlich elternloses Wesen, das eine Therapie versucht, aber als Nicht-ihr-Ding abgebrochen hat. Am Ende lebt sie nicht mehr in ihrem geliebten Apartment, sondern in einer riesigen Eigentumswohnung in einem soliden Viertel (in das sie für eine Perspektive mit Aiden gezogen ist) mit einer Katze und einem Garten. Zum ersten Mal schreibt sie an einem fiktionalen Buch, einem historischen Roman, einer Liebesgeschichte aus der Perspektive einer Frau.
Sie hat in ihrem Leben eine große Liebe mit viel Schmerz, viele Glück und vor allem einem Haufen Auf und Ab gehabt, sie hat einen einschneidenden Verlust hinter sich – nicht durch Trennung, sondern durch Tod – und sie hat trotz allem Aiden (nochmal) in ihr Leben gelassen, und sich viel Mühe gegeben, die Dinge für sich, ihn und die Beziehung besser oder richtiger zu machen. Um am Ende feststellen zu müssen, dass er ihr und der Beziehung in seinem Leben einfach keine Priorität einräumen kann. Nun schaut sie, nach einer kurzen Affäre mit einem Mann, der sich entfernt wie alle anderen zuvor, dem nächsten Lebensabschnitt allein entgegen, und damit der Frage, wo sie steht. Wie also, soll sie ihren Roman beenden?
Sie lässt ihre Protagonistin allein an einem Tisch sitzen. Angefüllt und zufrieden mit dem, was sie erlebt hat und was sie umgibt. Doch die Lektorin ist nicht zufrieden. Sie denkt sogar, Carrie habe vergessen, ihr das eigentliche Ende zu schicken. Carrie ist irritiert. Und fragt sich – eine klassische Carrie-Frage aus der Kolumnen-Zeit von Sex and the City –
Was ist so schlimm an einer Frau, die allein ist?
Irgendwann, nach Thanksgiving, wo sie all ihre Freunde erlebt, ihnen auf ihre helle, humorvolle Weise beisteht und sieht, wie sie alle ihre gewählte Leben leben, sich dabei aber auch um sie sorgen, sie kennen, schätzen und mögen, schreibt sie den letzten Satz ihres Romans neu.
She was not alone – she was on her own.
Ich verstehe, dass on her own sein was anderes ist, was Gutes und Großes. Sie ist erwachsen und selbständig und weiß, wie das geht, sie ist unabhängig, auch davon, sich über die Beziehung zu einem Mann zu definieren. Sie hat sich eine Arbeit, ein Umfeld, einen Wohlstand erschaffen, ein Leben, in dem sie sich frei bewegen kann, weil es ihr darin auf die für sie beste Weise gut geht. Denn sie kennt sich gut.
Dennoch macht mich das Ende traurig.
Es ist so, als habe sie das, was sie sich gewünscht und wonach sie gesucht hat, nicht bekommen. Nämlich jemanden, der bei ihr ist. An ihrer Seite. Obwohl sie sich nicht geschont hat dafür, obwohl sie gelernt und verstanden und sich entwickelt hat, obwohl sie so mutig war, es immer wieder zu versuchen, und obwohl sie einen Schicksalsschlag eingesteckt hat, der sich diesen gewählten Zugriffen entzogen hat.
Das Ende klingt, als habe die Vernunft gesiegt. Nicht die Liebe. Als habe die Emanzipation gewonnen, die Romantik oder vielleicht besser, die Gefühle verloren. Es ist ein durchaus weises Sich arrangieren mit den Verhältnissen, mit dem Alter, das seinen Tribut zollt, in dem nicht mehr alles möglich ist, in dem man dankbar sein muss, für alles, was da ist und geschafft wurde und noch geschafft werden kann. Aber die Liebe und der Traum von ihr sind, wir haben es miterlebt, auf der Strecke geblieben. Vielleicht wird es in Zukunft ab und an eine freundliche Begegnung mit jemandem geben oder einen Gefährten, der eine Weile bleibt. Aber sie wird auf sich allein gestellt sein, mit allem was daran reich und gut und glücklich machend für sie ist. Aber eben auch traurig.
2
Was, wenn das ganze feministische Training von Unabhängigkeit und Eigenständigkeit am Ende nur eine Vorbereitung war auf den Zustand von Lieb-Losigkeit und Einsamkeit, der einen im Alter einholt wie ein unausweichliches Schicksal. Wie kommt es, dass ich es früher cool fand, als Frau allein im Restaurant zu speisen, an der Bar zu sitzen und zu reisen, und es mir heute vorkommt wie etwas, das getan werden muss, weil es anders eben einfach nicht stattfinden würde. Das ist keine freie Entscheidung. Wieso beschleicht mich der Eindruck, dass ich das schamvolle Bild der übersehbaren, bedauernswerten alleinstehenden Frau abgebe, das Bild des weiblichen Scheiterns also, wenn ich da im Restaurant sitze, und eben gerade nicht das Bild einer eigenständigen Frau, die tut, was ihr gefällt und dafür eine Menge überwunden hat (meine Mutter hätte all diese Dinge oben niemals getan), eine Frau also, die voll empowered in der Lage ist, allein zu sein.
Wer lädt die Bilder auf? Ich? Die Gesellschaft?
Vielleicht kann man wie Katja Kullmann in Die singuläre Frau oder Gudrun Gut mit ihrem Hof in der Uckermark oder eben Carrie mit ihrem She was on her own tatsächlich zufrieden, einverstanden und sogar glücklich sein, wenn sich das Leben tatsächlich aus- und angefüllt anfühlt, wenn in allen wichtigen Aspekten des Lebens wie Beruf, Umfeld, Auskommen etwas erreicht wurde oder eingetreten ist, was sich richtig und passend anfühlt. Was, wenn das nicht der Fall ist?
Was, wenn die aktive und längst überfällige Umwandlung des Bildes der alleinstehenden älteren Frau (Hexe mit Barthaar), die in all den Single-mit-50-und-noch-nie-so-glücklich-Bücher und den vielen Empowerment-Artikeln zu Wir-müssen-über-die-Menopause-reden vorangetrieben wird, im feministischen Echoraum verbleibt und mal wieder nur bei den Frauen ankommt? Was, wenn dieser Diskurs, wie meistens, wenn das Private politisch aktiviert wird, neuen Druck erzeugt und vor allem, über eine Sehnsucht und eine Traurigkeit hinweg grätscht, die daher rührt, dass es nicht gelungen ist oder nicht mehr gelingen will, in dieses Private eine Beziehung zu integrieren?
Und was spielen eigentlich KATZE und GARTEN für eine Rolle in dieser Erzählung?
Katze (nochmal andere Implikationen als beim Hund, aber ähnlich): Hast du ein Bedürfnis nach Kuscheln, dann organisier dir was zum Kuscheln. Kenne deine Bedürfnisse und decke sie ab. Such dir was, was dich, anders als die Anwesenheit eines Mannes, nicht ständig damit konfrontiert, dass du trotz deiner Anti-Body-Shaming-Überzeugungen (politisch) very ashamed of your body (privat) bist und du es im Grunde sehr gut nachvollziehen kannst, dass diesen Körper keiner mehr begehrt, einen Körper, den du mehr denn je geschickt bedecken, in intimen Situationen schlecht beleuchten und unter permanentem Aufwand zurecht trimmen musst. Auch der Katze muss man das Kuscheln manchmal ein bisschen abtrotzen, aber das, witzelst du, bist du gewohnt. Ein bisschen Sorgearbeit auch, füttern, mal die Milben aus den Ohren, herrlich.
Garten. An Virginia Woolfs A Room of Ones Own können wir einen Haken machen: haben wir, check. Was wir jetzt brauchen: A Garden of Ones Own. Such dir einen Garten, dann hast du es schön und ruhig, und kannst den Blick schweifen lassen über das Grün. Das brauchst du jetzt. Einen Ort für dich, an dem du die Welt draußen lassen kannst, denn die wird sowieso und im Alter anstrengender. Hier im Garten gehts um Rückzug. Und ums bei sich sein. Vor allem aber hast du eine Beschäftigung. Eine Beschäftigung, noch so ein Wort des Alters. Such dir eine Beschäftigung.
3
Wahrscheinlich ist es trotz allem die beste Zeit in der Geschichte der Menschheit, eine Frau über 50 zu sein.
August 2025 – stiller
Kommt es mir nur so vor, oder ist es stiller geworden, das Schweigen größer, wenn ich mit Menschen am Tisch sitze und das Gespräch auf Politik kommt. Menschen, die früher gerne und viele darüber diskutiert haben. Ist es die Ratlosigkeit, die sich eingestellt hat, angesichts der so grundlegenden, sich in atemberaubender Geschwindigkeit vollziehenden Veränderungen der Zeit? Ist es die Sorge, vielleicht feststellen zu müssen, dass man, ähnlich wie in der Pandemie, unterschiedliche Positionen zu den Dingen hat, womöglich so unterschiedlich, dass die Freundschaft plötzlich zur Gewissensfrage wird? Ist die Stille Ausdruck einer sich im Gang befindenden Suche nach der eigenen Position, um die man früher leicht wusste und heute nicht mehr? Ist das Schweigen größer, weil man Positionen einnimmt, von denen man niemals gedacht hätte, dass man sie einnehmen würde, die man aber nun, angesichts des sogenannten Vibe-Shifts für richtig hält? Ist es stiller, weil diese Positionen die Fragen aufwerfen, ob man sie schon früher hätte vertreten müssen, man also falsch lag? Ist ein Schweigen im Raum, weil man fürchtet, etwas zu sagen, das man im Kopf hat, vielleicht auf der Zunge trägt, aber von dem man nicht weiß, ob es denkbar oder sagbar sein sollte?
August 2025 – Ferrante Bd. 2
Jetzt wünschte ich nur noch, es fiele Sand aus dem Buch.
August 2025 – eingesperrt
Heute in der Ubahn. Die Bahn fährt am Bahnhof Alexanderplatz los und bleibt noch am Gleis wieder stehen. Und steht. Steht. Uuund: steht.
Eine Frau wird nervös, sie versucht die Tür zu öffnen. Geht nicht. Jetzt wird sie noch nervöser, redet vor sich hin, Maaannn. Sie steckt mich an, ich lass mich nicht anstecken.
Keine Durchsage. Der Zug steht. Die Türen gehen noch immer nicht auf.
Ich setze mich, nehme mein Handy, das beste Mittel, um mich zu beruhigen: Berichterstattungen und Analysen zur desaströsen Weltlage lesen. Ich atme ruhig, ich muss mich konzentrieren, nicht an die verschlossenen Türen zu denken, keine Panikattacke zu bekommen.
Irgendwann läuft der Fahrer die Ubahnwagen entlang, zwei Männer kommen hinzu mit BVG-Westen, alles ist vollkommen unklar, Schaden am Zug, jemand ausgeflippt, Warten auf die Polizei, jemand auf den Schienen, what the fuck is Hölle los?
Als der Fahrer und die beiden Westen zurückkommen, stehe ich auf und klopfe an die Scheibe der Tür, es geht so schnell, dass ich es erst später realisiere. Ich drücke demonstrativ dreimal laut die Türhebel runter: Lassen Sie uns mal raus oder sagen uns wenigstens mal was los ist? Der Fahrer guckt nur böse, da hat man Schwierigkeiten und dann wird man auch noch doof angemacht, die Westen sagen auch nichts. Warum?
Inzwischen sind wir seit zehn Minuten hier drin und können nicht aussteigen. Eine ganze elend lange Bahn voll mit Menschen, die eingesperrt sind. Was, wenn ich mich anders entscheiden will, statt Bahn zu fahren, lieber laufen möchte, weil ich es eilig habe, lieber eine andere Route nehmen will, warum hat dieses Arschloch von Fahrer nicht die Türen freigegeben, warum hat er nichts gesagt, gar nichts. Ist was so Schlimmes passiert, dass man nicht darüber reden kann. Um niemanden zu beunruhigen?!
Ich schaue zurück aufs Handy, lese den Artikel weiter, zwinge mich, nicht herum zu daddeln, herum zu scrollen. Satz für Satz. Vielleicht gehen die Türen gar nicht auf, vielleicht hat er sie nicht nicht freigegeben, sondern sie gehen nicht auf, weil die Elektrik spinnt. Warum hat er den Zug runtergefahren und dann wieder hoch. Und trotzdem nicht die Türen freigegeben.
Die nervöse Frau hat ihren Kopf auf ihre Unterarme gelegt. Ich weiß, wies ihr geht, trotzdem, hör auf damit, du Panikkuh, du steckst mich an, reiß dich zusammen. Sie ist groß und kräftig, ihre Unterarme liegen auf dem Plexiglas neben der Tür, da komm ich nicht mal hin, jedenfalls nicht mit den Unterarmen. Eine andere Frau erklärt, mehr sich als den anderen, das dürfen die nicht, die Türen aufmachen, aus Sicherheitsgründen. Als wären wir hier drin in Sicherheit. Asl hätte dieses Arschloch von Fahrer auch nur eine sekunde an das Vieh in seinen Waggons gedacht. Wie geht es den anderen in den anderen Wagen, wir haben Glück, dass wir nur die nervöse Frau haben. Und mich. In anderen Wagen siehts vielleicht schon anders aus, da ist vielleicht schon einer dabei, die Tür aufzubrechen, das Fenster mit dem Nothammer einzuschlagen, die Notbremse zu ziehen, die Polizei zu rufen oder was könnte man sonst noch machen.
Die eine Weste bleibt jetzt näher an unserem Fenster stehen, guckt pseudo-checkermäßig die Wagenreihe entlang nach links, die Wagen entlang nach rechts, warum bin ich nicht in den vordersten eingestiegen, dann könnte ich jetzt gegen die Fahrertür klopfen, was rufen, was fragen. Das könnte meine OCD-Macke werden, immer vorne einsteigen. Die Weste guckt zu uns rein, zu mir, die gemotzt hat, der fährt gleich weiter, sagt er. Leck mich, denke ich, klammere aber meinen Blick einen Moment lang an seinem Gesicht fest, seinem unsicheren Lächeln, seinem uns Sicherheit vermitteln wollenden Blick. Das Handy. Ein vertrauter Ort, voller heimeliger Katastrophen.
Irgendwann fährt die Bahn wieder hoch. Der Zug fährt los. Was für eine beschissene Scheiße, denke ich, 15 Minuten eingesperrt, von einer Person, die sich zum Herrn gemacht hat über uns, gehört das nicht zum Protokoll, Leute informieren, Türen freigeben, damit alle frei entscheiden können, was sie jetzt machen wollen, bleiben oder das Weite suchen?
Als ich an der übernächsten Station aussteige, bin ich zittrig, aufgelöst. Und genervt davon.
Plötzlich sehe ich das Zimmer vor mir, in das meine Mutter mich früher eingesperrt hat.
August 2025 – Jungs in der Sbahn
Drei Jungs in der Sbahn. Einer deutet runter auf einen Imbiss, an dem wir vorbei fahren:
Döner hier voll overrated. Schmeckt Arsch, Digga, wie Arschritze, Digga.
Ansonsten geht es viel um die Frage ob der ne Freundin hat oder der? Als klar ist, dass der ne Freundin hat, schüttelt der Arschmann den Kopf, so: Wieso der und ich nich.
August 2025 – Existenzielles
Was ist das für eine Existenz.
Dieses permanente Traurigsein.
All die Schritte, die ich gehe,
gehe ich allein.
Juli 2025 – Kunst gucken
Als ich früh morgens das Kunsthaus betrete und auf den Raum mit der Roman Signer Ausstellung zulaufe, bin ich aufgeregt. Endlich bin ich da, ich hab eine lange Anreise hinter mir, ich habe keine gute Zeit gerade, ich gehe schweren Herzens durch die Welt. Aber schon an der Eingangstür, dort, wo zur Begrüßung den Besuchern zugewandt eine längliche Tonne auf Gummistiefeln steht, muss ich lachen. Ich könnte die Tonne umarmen. Der Raum, der sich hinter ihr öffnet, hell, hoch, großzügig, fein und klug bestückt mit Signers Arbeiten, räumt auch in mir alles auf. Ich bleibe die nächsten beiden Stunden hier, schaue mir alles genau an, höre Signer in seinem Appenzeller Dialekt über eine App zu, wie er über ein paar seiner Arbeiten spricht, und bin happy.
Das war schon immer so und natürlich nicht bei jeder Kunst, jedem Künstler, jeder Künstlerin. Aber Kunst, Fotografie und Architektur gucken ist für mich ein großes, anregendes, teilhabendes Glück.
Dieser Sommer war ein Art- und Archi-Sommer: Brutalismus-Führung in Berlin: Benjamin Franklin, Hygieneinstitut (kurz vor der Renovierung nochmal von innen!), Mäusebunker. Käthe Kruse in der Berlinischen Galerie. (Über die ich auf Hanne Darboven gekommen bin.) Roman Signer im Kunsthaus Zürich. Rechtswissenschaftliche Bibliothek Zürich von Calatrava. Vija Celmins (kannte ich nicht) in der Fondation Beyerle in Basel (Gebäude: Renzo Piano). Katharina Grosse in der Staatsgalerie in Stuttgart. Hanne Darboven Haus in Hamburg, genau genommen keine Ausstellung, trotzdem gehört’s in die Liste. Bas Jan Ader in Hamburg, absolutes Highlight. Yoko Ono in Berlin. Lost Art Festival und Berlin Art Week folgen noch. Und wer weiß, was noch.
Ich frage mich, warum ich das mache. Was mir daran so eine Freude ist. Mir fallen Menschen ein, die ihre Liebe zur Kunst, ihr Interesse daran, mit mir geteilt haben. Mein Vater, der mich früh an solche Orte geschleppt hat und mir seine aufrichtige Begeisterung für Kunst, für „das Kreative“, das er selbst in sich trägt, gezeigt hat. An J., meine erste Mitbewohnerin und beste Freundin, die sich, vielleicht mit einem intellektuelleren Zugang, für Kunst interessiert hat, und mich mit nach Paris oder Basel geschleppt hat, um welche anzuschauen. Und natürlich T.
Kunst gucken war für mich damals: Hoffnungsschimmer, Türöffner, Erleichterungsmoment, Ankommensgefühl, Anregungsmaschine, Weltverständnis, Teilhabe. Kunst gucken hat mich weg geführt, raus aus der unendlich langen, dumpfen Erfahrung der Realschule, raus aus der inspirationsfreien Umgebung, in der ich aufgewachsen bin. Sie hat mich an Orte geführt, in denen ich atmen kann.
Heute ist mir Kunst näher denn je. Kunst gucken kann ich gut allein (ohne Angst) und sehr gerne mit anderen. Kunst ist Anlass, Kunst bringt mich auf den Weg, führt mich irgendwohin, in Räume, die sie oft atmend umgeben und die mich atmen lassen. Ich brauche Kunst, weil sie mich denken, prozessieren, selbst kreativ werden lässt. Kunst makes me happy.
Juli 2025 – Schweiz im Juli – Insektenhotel
Auf dem Rückweg von Basel nach Berlin übernachte ich in Stuttgart.
In der Jugendherberge sehe ich folgenden Aushang:
Achtung: Eichenprozessionsspinner im Bereich Bruddlerstaffel
Liebe Gäste, liebe Besucherinnen und Besucher,
außerhalb des Grundstücks der Jugendherberge, im Bereich Bruddlerstaffel und insbesondere im dortigen Sitzbereich, wurde ein Befall mit Eichenprozessionsspinnern festgestellt.
Die zuständigen Behörden der Stadt Stuttgart sind bereits informiert.
Die Raupen des Eichenprozessionsspinners können beim Menschen starke Reizungen der Haut, Augen und Atemwege auslösen – auch ohne direkten Kontakt, da sich die feinen Brennhaare der Raupen über die Luft verbreiten können.
Wir empfehlen dringend, den betroffenen Bereich zu meiden und sich nicht in der Nähe befallener Bäume oder Nester aufzuhalten.
Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit und Umsicht!
Shit. Und ich hatte Angst vor Bettwanzen.
Neue Gefahren überall. Mehr Möglichkeiten übel krank zu werden und oder zu Tode zu kommen. Die Tigermücke und andere von Süden in unseren Süden eingewanderte Stechmücken übertragen Chikungunya-, Dengue- und Zika-Virus, die in Germany aufgetretene Malaria war schon einige Male eine nicht-importierte. FSME und Borreliose sowieso. In Baden-Württemberg wohnt die Nosferatu-Spinne schon ganz selbstverständlich im Haus meines Bruders. Warum nochmal stellen wir Insektenhotels auf? Aber auch ohne Insekten gehts problemlos: Vibrionen in der Ostsee, Zerkarien im Badesee. Diese Artenvielfalt. Toll, so ein Klimawandel.
P.S. Bruddlerstaffel, kicher.
P.P.S. Die Bar ums Eck der Jugendherberge ist sehr nett, befindet sich in einem sehr schönen Haus und heißt Apotheke, weil früher mal. Am Platz kurz davor sammeln sich die Leute, um von hier oben bei Abendrot über die Stadt zu schauen. Das könnte jetzt auch in Paris sein.
Juli 2025 – Schweiz im Juli – unterwegs sein
Ich komme gerne an. Ich ziehe gerne weiter.
Ich weine. Aber ich bin unterwegs.
Juli 2025 – Schweiz im Juli – Bernina Express
Das Gras wie eine ausgelegte Matte
immer möchte man
darüber streicheln
wie über das Fell eines Tieres
dabei den kleinen Kästchen ausweichen, den Häusern und Hütten
Die Tiere, Pferde, Kühe
hochnehmen und ein bisschen weiter nach links setzen
oder nach rechts
aber sie fliegen ja sowieso vorbei
Der Nebel hängt wie Rauch
über den Bäumen
einmal hinein pusten
einmal ihn fassen
um zu schauen
wie kühl er ist
wie fest wie flüchtig
Juli 2025 – Schweiz im Juli – Indian Girls
Mega nervige Girls Crew auf dem zentralen Platz in Tirano, auf dem alle nur ankommen, um abzufahren. Der arme Ort einfach nur eine Umsteigestelle, ein Wartelokal für den Bernina-Express, mit Eis, Cafés, einer schnellen Pasta, ein paar Bänken unter Bäumen zum Ausruhen und so einer Art Erweiterung des Platzes zwischen den Shops von dem aus man im Hintergrund das Bergpanorama sieht. Der Platz, den jetzt die Girls belegen.
Sie posen in allen nur erdenklichen Formationen vor den Kameras ihrer Handys, allein, zu zweit, als Gruppe, anders zu zweit, anders als Gruppe, sie rufen, sie schreien, sie kommandieren über den Platz. Wer an ihnen vorbei will, hats schwer, kann sich nur vorbei drücken, muss sich bemerkbar machen, nur um von der Gruppe ausdrücklich unbemerkt zu bleiben. Sie nehmen den ganzen Platz ein, belegen, wenn sie gerade nicht in einer Session sind, sogar noch die Stühle eines angrenzenden Cafés, ohne was zu bestellen, von wo aus ich die Show staunend beobachte. Das hier ist ne ernste Sache, so viel steht fest. Da ist viel Druck drauf.
Von der Bande her rufen die, die gerade nicht auf der Bühne stehen, Posing-Vorschläge rein, Anfeuerungsrufe: Luv ya, Love this outfit, So cute, honey, oder auch mal was konstruktiv Kritisches, Mahnendes: Maybe more to the right, oder The shirt, honey, the shirt! wenn The shirt verknittert aussieht.
Das meiste verstehe ich nicht, weil sie hauptsächlich Indisch sprechen, wobei mir klar ist, dass es das nicht gibt, Hindi, kann ich nur annehmen. Die Girls machen den Eindruck als seien sie eine Gruppe von zwanzig, de facto sind sie nur zu siebt. Alle sind in ihren Mid- to late twenties würde ich sagen, schicke kids, eher rich, aber was weiß ich schon. Zwei Jungs sind auch dabei. Viel zu sagen haben die nicht. Einer von ihnen ermahnt die anderen irgendwann: This is a public space, guys. Keine der Frauen ändert danach auch nur ein Mü ihr Verhalten.
Sind diese Girls jetzt so, weil das die lang ersparte super teure Reise ihres Lebens ins ultimative Sehnsuchtsland der Bollywood Filme, der Schweiz, ist, und nur hier und jetzt also die Chance besteht, die nicht wiederkommt, Freunden und Familien auf den einschlägigen Beweisplattformen zu beweisen, dass man es geschafft hat
oder sind das einfach superficial White-Lotus-Tussis, die im Business Studium gelernt haben, dass man einfach immer so rigoros sein muss?
Juli 2025 – Schweiz im Juli – rattatatatat
Im Bus von Lugano nach Tirano. Neben mir eine Familie mit halbflüggem Sohn. Mutter und Vater versuchen mit je einem Fotoapparat die ganze Fahrt festzuhalten bzw. abzuschießen, der Fotoapparat des Mannes gibt drei Stunden lang in kurzen Abständen ein Maschinengewehrgeräusch von sich. Leute, a, kann man sowas nicht ausstellen? Und b, wer denkt sich so einen Sound aus?
Ich lasse mir davon die Aussicht nicht trüben. Italien sieht wunderschön aus, als wir über die Grenze fahren und ich die erste Zypresse sehe, kommen mir die Tränen. Plötzlich wird mir klar, dass die drei Russisch sprechen. Keine Ahnung, vielleicht sind die drei ja auch Regimegegner,
aber der Sound liegt jetzt anders über dem Landstrich.
Juli 2025 – Schweiz im Juli – Einfallstor
Das Hotel ist wunderschön.
Trau ich mich in den Pool?
Am nächsten Morgen ganz früh trau ich mich. Es ist herrlich. Der Blick aus dem Wasser übers Wasser, nämlich des Luganer Sees, die kleine Meerjungfrau am Beckenrand, die aus einer Schale Wasser in den Pool gießt. Schwimmen geht nur eingeschränkt, die Schulter. Aber ich schwimme, ich bin da, ich schaue, ich fotografiere, ich wusste, dass ich froh gewesen sein würde, das gemacht zu haben und so ist es.
Im Bad schlage ich mir kurz danach heftig den Knöchel an, Schmerz, und sofort: Angst, Panik, was wenn ich mir wieder was gebrochen habe. Einfallstor für alles, die Wut auf T., die Wut auf U, die Angst vor der Zukunft, vor der Perspektive aus Schmerzen und zunehmender Immobilität, nicht mehr laufen können, nicht mehr das machen können, was ich hier gerade mache, der Gedanke an eine geheime Erkrankung im Hintergrund, die alles, was ich habe, in einen Gesamtzusammenhang stellen würde, die Schulter, die Hüfte, das Knie, die Füße, die Finger, der Rücken, bei jedem Hexenschuss, der mich für Tage, Wochen, raushaut, jedesmal die Sorge, dass es was Schlimmeres ist, doch wieder ein Bandscheibenvorfall?, ein erster Wirbelbruch?, tagelanges Rumquälen wie ein halb zerquetschtes Insekt, nach dem Liegen an der Fensterbank hochziehen, nicht sitzen, nicht liegen, nur stehen oder gehen wie ein Zombie, bis in der Konsequenz was anderes weh tut, nicht teilhaben, sondern Tabletten fressen, die wenig nützen,
jeden Tag mache ich Sport, dauernd gehe ich zur Physio, zur Ostheo, jeden Tag lasse ich mich „nicht unterkriegen“, wie scheiße das ist, sich nicht unterkriegen zu lassen, was soll das sein, das ist nicht leben, das ist permanente Anspannung, permanente Angst, dass es wieder kommt, das ist Kampf, Goliath, Windflügel, wann wird der Tag kommen, an dem ich mich unterkriegen lasse, untergekriegt werde, ich fühle mich schuldig, bringe mein ständiges Kranksein mit dem Scheitern meiner Beziehungen in Verbindung, mit der Vorstellung einer Unmöglichkeit einer neuen Beziehung, wer will sich das antun, wer will mit jemand zusammen sein, der permanent krank ist, jederzeit sein könnte, U, der keine Lust mehr dazu hatte, sich damit beschäftigen zu müssen, dabei sein zu müssen, wenn schon wieder irgendwas ist, es macht mich verzweifelt, weil ich nicht die Krankheit bin, die sich aber so aufspielt, ich stelle mir vor, wie er schwimmt, paddelt, wandert, Ski fährt, nur ein paar Kilometer weg von hier, mit einer anderen Frau. Einer Saisonkraft.
Juli 2025 – Schweiz im Juli – der Bahnbeamte
Ein Bahnbeamter in Uniform, ich schätze ihn auf 60, berät mich am Schalter im Zürcher Bahnhof.
Ich habe ihn gefragt, ob es angesichts der Zugreisen, die ich durch die Schweiz noch so vor mir habe, vielleicht eine insgesamt günstigere Möglichkeit gäbe als einzelne Tickets zu kaufen. Er überlegt, tippt, probiert aus. Nein, das lohnt sich nicht, das hier vielleicht? – Ah, mit dem Touristenticket hätten Sies günstiger haben können, aber das hätten sie dann direkt vor der ersten Fahrt kaufen müssen. Er schüttelt bedauernd den Kopf:
Also der Zug ist abgefahren, sag ich mal.
Obwohl ich ahne, dass er diesen Witz seit Jahrzehnten seinen Kundinnen und Kunden erzählt, obwohl ich sehe, dass er etwas zu siegessicher auf meine Reaktion wartet, muss ich laut lachen.
Juli 2025 – Schweiz im Juli – Einblicke ins Angsthirn
Es ist okay, du kannst entspannen, natürlich, der Akku wird bald alle sein, du willst viele Fotos machen, natürlich, jetzt haben sie hier im Bus nur USB-Steckdosen und das richtige Kabel dafür ist im Kofferraum, natürlich, der Bus ruckelt und du wirst Rückenschmerzen bekommen, sobald er losfährt, natürlich, sie haben keine Toilette an Bord und du wirst anderthalb Stunden aushalten müssen, natürlich, es könnte sein, dass du es nicht schaffst bis dahin, obwohl du noch dreimal auf dem Klo warst, aber was könntest du tun, wenn was in die Hose geht, die Jacke um die Hüfte binden, aber die Kälte an den Beinen, der Gestank, alle würden es sehen, riechen natürlich, natürlich, jetzt erlaubt der Router kein ungesichertes Netzwerk, das wolltest du noch einstellen gestern, das hast du wieder nicht geschafft, daran hast du wieder nicht gedacht, dabei denkst du doch schon dauernd an alles, natürlich, du sitzt auf der falschen Seite, die Seen sind rechts, warum hast du das beim Buchen nicht kapiert, natürlich tut dein Nacken weh, dein Bauch wölbt sich über die Hose, natürlich bist du hässlich, natürlich hat U dir ausgerechnet jetzt zurück geschrieben und klingt so distanziert, so weit weg, bestimmt hat er längst mit jemand anderem geschlafen, im Gegensatz zu dir, natürlich, du könntest seine Hand halten, wenn er neben dir säße, und alles wäre vielleicht weniger schlimm, alles wäre ruhiger und dein Angsthirn nicht ganz so laut, natürlich hättest du nicht über all das sprechen dürfen, worüber du gesprochen hast, auch wenn du denkst, du hast es doch kaum getan, natürlich war es zu viel, warum hast du nicht deine Klappe gehalten, natürlich fährst du
die Seen entlang
über die Grenze
nach Italien
du siehst die Berge
die Bäche
die Steine darin,
die Brücken die Boote die Kite Surfer
Die Zypressen.
Natürlich
könntest du dich entspannen
natürlich natürlich
den Kopf zurücklehnen
die Haltung verändern
von links nach rechts die Füße dehnen,
natürlich denkst du an deine Mutter deinen Vater und ihre jeweilige Art zu reisen an den anderen Vater der sich freut dass du reist
an deinen Bruder deine beste Freundin deine Freunde
natürlich sind die Blicke wunderschön
natürlich lächelst du freundlich
natürlich spricht niemand mit dir
natürlich ist der Wahnsinn längst erkennbar
natürlich könntest du daten
natürlich war es die beste Entscheidung seines Lebens, du hast doch gesehen, wie erleichtert er war
natürlich könntest du etwas trinken aber was du dann riskierst siehe oben
natürlich
bist du heute morgen im Pool geschwommen
und hast es dir lange überlegt
natürlich hast du es trotzdem gemacht
natürlich hat dir die Schulter weh getan
natürlich hast du dich still ins Wasser gelegt
wie du es geübt hast
natürlich hast du versucht
loszulassen
so wie jetzt
für ein paar Momente
ist das was du wolltest
das was du machst
das was du dir gewünscht hast
natürlich
spürst du das
spürst du das
spür das
Die Italiener hängen die Wäsche raus
Handtücher flattern im Wind
Juli 2025 – Schweiz im Juli – Italien
Und so fahre ich
mit meinem Liebeskummer
und meinem Trotz
durch
plötzlich Italien!
Juli 2025 – Schweiz im Juli – Hobby
Wetter nich so doll, nehm ich mal ne Tram. Eine alte Frau fällt mir auf, die wie ich auf dem Gleis wartet. Sie sitzt auf einer der Bänke, stützt sich, ihr Körper ist schon leicht gebeugt, auf einen Rollator. Sie ist von oben bis unten schwarz gekleidet, trägt einen langen Rock und hat eines dieser Topfhütchen auf, darunter kommen ihre schlohweißen Haare im Bob zum Vorschein. Sie ist geschminkt, die Lippen rot.
Sie steigt in die Tram ein, fährt zwei Stationen, dann sehe ich sie aussteigen.
Am nächsten Tag sitze ich in einer anderen Tram. Da ist sie wieder, ich sehe sie vom Fenster aus. Genau wie gestern ist sie schwarz gekleidet, zurecht gemacht, und erklimmt, Rollator vorweg, vom Gleis her die Tram. Eine Station später steige ich aus, gehe auf dem Gleis die Tram entlang und halte Ausschau nach ihr, da sehe ich sie weiter hinten sitzen und hinausschauen,
Ein paar Stunden später stehe ich nach einem langen Spaziergang am Zürichsee an einem großen Platz, einem Knotenpunkt fürs Umsteigen. Auf der anderen Gleisseite entdecke ich sie wieder – sie steigt gerade in eine Tram. Jetzt kapier ichs endlich. Das ist ihr Hobby! Den ganzen Tag fährt die mit der Tram, zwei Stationen hier, drei Stationen dort, guckt raus, kommt voran, hält sich fit, und sieht was von Zürich. Wahrscheinlich kennt sie hier jeder. Vor allem jeder Tramfahrer. Eine Zürcher Pappenheimerin sozusagen.
Ich glaube, das mach ich auch, wenn ich alt bin.
Juli 2025 – Schweiz im Juli – Zürichsee
Das Wasser flaschengrün, ach was, türkis!!!
Juli 2025 – Der japanische Mann
In der Nachbarschaft meiner Bürogemeinschaft gab es einen alten japanischen Mann. Er war schmal und hager. Jeden Tag ging er, auf seinen Rollator gestützt, an der Eingangstür unseres Ladenlokals vorbei. Diszipliniert, so kam es mir vor, um sich zu bewegen und ein paar Schritte bis mindestens zum Ende der Straße zu gehen.
Für ein paar langsame Sekunden erschien er zu unterschiedlichen Tageszeiten im Fenster des Türrahmens, wo ich ihn von meinem Platz aus sehen konnte, verblasste im Weitergehen hinter dem milchigen Sichtschutz des Schaufensters, um schließlich aus meinem Sichtfeld zu verschwinden.
Nie setzte er sich, wie viele andere Nachbarn auf das Bänkchen vor dem Fenster.
Manchmal saß ich auf diesem Bänkchen und sah ihn vorbeikommen. Auf seinem Hin- oder Rückweg. Ich habe, typisch für mich, erst nach einer Weile angefangen ihn zu grüßen. Er nickte zurück. Mehr nicht.
Ich habe den anderen in unserem Büro manchmal von ihm erzählt. Wer? Kenn ich nicht, haben sie gesagt. Niemand wusste, von wem ich spreche. Niemandem war er aufgefallen. Keiner hatte ihn je gesehen. Auch die nicht, die viel öfter da waren als ich, auch die nicht, die viel mehr mit der Nachbarschaft im Kontakt sind als ich.
Der japanische Mann ist lange nicht mehr an unserem Büro vorbeigelaufen. Sehr lange. So lange, dass ich davon ausgehe, dass er inzwischen seine Wohnung nicht mehr verlassen kann. Oder im Heim ist. Oder gestorben.
Ich weiß nichts über ihn. Gar nichts.
Ich kann niemanden nach ihm fragen.
Ich vermisse ihn.
Juli 2025 – Millenials
Ach, diese Millenials. Stundenlang sitze ich im Cafe neben drei wirklich netten Leuten, überzeugt davon, dass der eine der Männer, Cappie, Schnurrbart, buntes Hemd, Loafers, Socken bis zum Knöchel, gay ist. Dann plötzlich legt er die Hand auf den Oberschenkel der Frau und sie greift nach seiner Hand. Die sind ein Paar?!
Ich weiß, das ist gut. Gut, dass es bricht, aufbricht, alles in Frage stellt, mich und meine Wahrnehmung, sowieso. Dennoch störe ich mich daran. Irgendwie. Warum nur?
Ich wittere Betrug. Heuchelei?
Ich wittere die alte Sehnsucht danach, politisch zu sein im Privaten und dabei vor allem eins zu produzieren: Unaufrichtigkeit und Schmerz. Neue Machtverhältnisse, die die alten ablösen. Vor allem aber: pressure.
Juli 2025 – geschenkt
Manche Kinder wachsen auf und haben das Gefühl, sie seien ein Geschenk. Ich wundere mich mein Leben lang, wieso nie jemand verstanden hat, dass ich ein Geschenk bin. Zwinkersmiley.
Juli 2025 – Gen M
Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber ich finde die Männer meiner Generation gerade so richtig scheiße.
Juli 2025 – Gattungsbreite
Neues Genre, in dem ich mich seit kurzem immer öfter beweisen muss: Kondolenzkarten schreiben
Juli 2025 – Sommer
Es ist heiß.
Als ich die Wasserflasche öffne, pfeift der Wind ein Lied darin.
Ein junger Mann trägt seine Muskeln spazieren.
Nackt ab der Jeans aufwärts.
Die Farben leuchten.
Plötzlich Kleider in Gelb zu Taschen in Lila zu Caps in Rot.
Juni 2025 – Keine falsche Bewegung
Falsche Bewegung, wie mich das ärgert, wenn das jemand sagt, da haben Sie eine falsche Bewegung gemacht. Was soll das sein, eine falsche Bewegung? Eine Bewegung ist eine Bewegung. Und ich soll möglichst viele davon machen, so die ständige Predigt. Ich bin nicht schuld an meinem Körper, dieser entsetzlichen Diva. Ich bin nicht mit ihm zu euch (Ärztinnen, Physiotherapeutinnen) gekommen, damit ihr mir die Schuld in die Schuhe schieben könnt an ihm, und seiner Weigerung, gesund zu werden.
Juni 2025 – Frieden
G. regt sich auf, weil ein riesiges Schild mit der Aufschrift Frieden am Ortsschild eines kleinen Brandenburger Dorfes hängt. Ist doch klar, wer das ist, sagt er. Is doch irre, sage ich, dass das so ist. Dass die Forderung nach Frieden, die zu unserer politischen Sozialisation, zu unserem Selbstverständnis als sich links verortende Menschen seit je dazugehört, heute etwas ist, was einen empört. Dass man, wie G., den Impuls verspürt, zur Bürgermeisterin gehen zu wollen und zu sagen, was hängt denn da, so geht das doch nicht. Weil man weiß, welche Ecke mit dem Begriff hantiert und welchen Twist er dort verpasst bekommen hat. Frieden und Freiheit fordern, das machen heute die Rechten – oder die von links in diese Richtung abgebogenen bei der BSW. Und was kann man als Bevölkerung vor Ort oder als Durchgangsreisender auch sagen gegen ein Plakat, das Frieden fordert. Für wen da nix dabei ist, dem ist eh nicht zu helfen. Den sogenannten Kulturkampf hat die AfD in diesen Orten längst gewonnen. Wir können dagegenhalten und spezifizieren, was wir meinen, wenn wir Frieden sagen. Aber das ist alles Jaja und tl;dr. Die Begriffe liegen längst frisch gefüllt wie Cannoli ganz vorne in der Auslage.
Dennoch. Sind jetzt alle Leute, die sich auf Frieden als aktivistischen, politischen Begriff beziehen, nur bekloppte, naive Hippie-Idioten? Das hatten wir schon mal. Die Rhetorik der Stunde ist jedenfalls Aufrüsten in Milliardenhöhe, kriegstüchtig werden (nicht mal verteidigungstüchtig hört man mehr, der Krieg muss schon rein in die Köpfe, in die Erwartungshaltung), Rheinmetall-Aktien kaufen, Wehrpflicht wieder einführen, sich von der Schweiz zum Thema Bunker beraten lassen, bei uns gibts nämlich keine, da sind jetzt Ausstellungen und Pubs drin, den Hiroshima-Jahrestag weggedenken, als wär er was für Leute im Altersheim, Experten für Katastrophenschutz warnen und aufklären lassen, und immer wieder auf allen Kanälen versichern, dass der Krieg in der Ukraine alternativlos sei, weil Putin sich nicht bewegen will. Das stimmt auch. Aber trotzdem, ich mein, ja nur. Rhetorik. Was ist hegemonial. Alles immer mit Vorsicht zu genießen und zu beobachten.
Im Gropius Bau und der Nationalgalerie eine Ausstellung von Yoko Ono. Es wäre falsch, sie nur auf diese Peace-Sachen zu reduzieren, die sie gemacht hat, aber als Thema zieht sich das bei ihr schon durch. Kein Wunder, sie hat als Kind den Krieg erlebt. Und auch, wenn mir das oft kitschig oder zu einfach vorkommt, was sie da macht, liegt doch gerade in der Einfachheit der Peace-Forderung, des Friedens-Wunsches eine Stärke. Was, wenn alle Schachfiguren weiß sind. Wie in den 80ern verbindet sich die Forderung nach Frieden erneut mit der Natur und Umwelt-Frage, heute Klimawandel genannt. Im September gibt es in der Neuen Nationalgalerie eine von der Yoko Ono-Ausstellung inspirierte lange Tafel für alle, bei dem irgendwann alle als Friedenszeichen gemeinsam kleine Glocken läuten. Da muss ich natürlich spontan an die Ulmer Menschenkette denken. Okay, Frieden sagen war schon immer etwas problematisch, weil nicht gerade analytisch, sondern eher gefühlig, weihnachtlich, aber dennoch, was, wenn Frieden sagen irgendwann mal wieder hegemonialer und weniger peinlich bzw. vor allem weniger Putinflüsterer-mäßig. Was bis dahin alles passieren wird, davor graut einem. Es fällt mir jedenfalls auf, dieses Event, als seismografische Bewegung gegen die Bewegung. Und gegen die gefüllten Cannoli.
Juni 2025 – Dilemma
Manchmal findet man sich in Gesprächen wieder, in denen Männer den Problem nicht verstehen, das man schildert. Weil sich darin ein Dilemma verbirgt, das, meist unausgesprochen, mit dem eigenen feministischen Anspruch zu tun hat. Besonders gay Männer verstehen das interessanterweise oft gar nicht, weil sie anders als viele Heteromänner, die gleich schon ganz geduldig gucken, den Diskurs nicht so aus dem eigenen Beziehungsleben kennen. Man denkt so diskriminierungskumpelig, die müssten da doch was kennen, ist aber nicht so. Die zucken dann mit den Achseln, wenn es um sowas männlich konnotiertes geht wie Sachen reparieren oder Autofahren oder Wohnung renovieren oder allein verreisen, wo is das Problem. Kann man doch machen, alles, oder, wenn man keinen Bock drauf hat, lassen, auch okay. Aber einfach sagen, Regal zusammenbauen, das kann ich nicht, oder nee, ich fahre nicht Auto, das ist mir zu gefährlich, oder allein mit Zelt und Rad durch Marokko, das pack ich nicht, das kann man als Frau nicht. Denn man will das alles aus feministischen Gründen problemlos können, machen und wollen oder sich längst beigebracht haben, man will sich ja auch nicht drumrum pissen, diese Aufgaben zu übernehmen, man will keine Hilfe brauchen, schon gar nicht von einem Mann. Gleichzeitig will man auf sich und seine Bedürfnisse hören, das wurde einem ja therapeutisch und in jedem Psychoartikel einschlägiger Printmedien eingebleut, Bedürfnisse, die vielleicht sagen, ich hab auf nichts davon Bock. Aber sind das die wahren Bedürfnisse, ist denen zu trauen? Und man will sich ja auch nicht schon wieder schlecht machen und selbst geißeln, weil man das alles nicht kann, man will sich verzeihen. Denn was ist denn schon dabei, und dann findet man eben andere Lösungen, (jaja, andere Lösungen namens Mann?) oder dann nimm dir eben ne Freundin mit (Frauen gemeinsam stark, was sind wir, ne Gewerkschaft?) oder Dafür kannst du andere Sachen (was denn, häkeln?, Butterbrote schmieren?). Und wegen diesem ganzen unsichtbar darunter liegenden Mann-Frau-Thema wirken die Einblicke in oft recht alltägliche Entscheidungsprozesse dann so wuschig, hochgejazzt und sperenzchenhaft, dass am Ende auch das unfeministisch wird. Männer bekommen derweil nicht mit, was da abgeht, weil sie gerade mit dem Zelt in Marokko unterwegs sind oder durch die Unterführung nach Hause gehen. (Die Heteros zumindest). Und wenn sie es mitbekommen oder mitbekommen dürfen, denn man muss es ja auch erstmal selbst begreifen und ihnen dann erzählen, dass das thema im Unterboden mitmischt, stehen sie hilflos davor, was man ihnen nicht verübeln kann, denn wie sollen sie sich richtig verhalten? Das ist praktisch unmöglich in der gesellschaftlichen Gesamtlage. Also ist man als Frau am Ende alleine irre und denkt, gut, treff ich mal Entscheidung.
Juni 2025 – die Schweiz
Ich fahre also allein.
So ein Quatsch.
Dieses Land, nur ein Wort, das innerhalb weniger Wochen zu einer Chiffre geworden ist, für, ja, für was, wenn ich es nur verstehen würde, für grundlegende Themen, Konflikte, Fragen? Ein Wort, das sich mit Bedeutung gefüllt hat, ein aufgeblasener Ballon, ein behüllter Raum für Projektionen, Bilder, Geschichten, Ideen. Am Ende ein Mensch, der abreist.
Aber ich wollte da doch auch hin.
Eine Handvoll zu teurer Bahntickets und Hotelübernachtungen später, die sich nur gegen äußerste Widerstände buchen lassen, störrisch sind, sich weigern, sich einzufügen in den Timetable, ins Budget, als spürten sie meine Verunsicherung, als müssten sie mich beschämen, mir sagen, dass ich draußen bin, sich schließlich nur meiner Hartnäckigkeit, meinem immer wieder neuen Ansetzen ergeben, fahre ich also hin.
Juni 2025 – Samstag oder: Leben
Ich will nichts außer ins Cafe gehen
und ein Buch lesen, vielleicht
über einen Markt laufen, an einem Wasser entlang,
ins nächste Cafe, und weiterlesen.
Ein bisschen was schreiben möglicherweise,
ein wenig durch die Läden gehen und shoppen,
eine Ausstellung anschauen
vielleicht,
etwas wunderbares Kleines essen, einen Drink nehmen
mit einem Freund,
in einer Bar,
an einem Platz,
vielleicht ins Kino gucken oder kochen für Freunde,
die Küche, der Balkon.
So riecht es gut.
so fühlt es sich satt an, richtig und frei.
Juni 2025 – Trennschärfen
H.s Erzählung über sich und ihren Freund, die sich bei ihrer Trennung eine Nacht lang in den Armen gehalten und getröstet haben. Ich staune, wie unvorstellbar mir das für die Männer vorkommt, mit denen ich zusammen war. Aber vielleicht auch für mich? Es erscheint mir so logisch und richtig.
Juni 2025 – Chat GPT ist ein Angeber
Ein Kollege und ich brauchen für den Entwurf eines Radioprojekts einen Sound, einen Kapiteltrenner.
Es ist schwer, online überhaupt etwas zu finden, bzw. die frei verfügbaren Sounds passen nicht zu unserem Inhalt. Ich komme auf die Idee, Chat GPT zu fragen.
Gar kein Problem, sagt Chat. Audiodateien generieren, Töne und Musik notieren oder komponieren oder Sounddesign-Anleitungen schreiben, kann ich alles. Fein. Ich prompte haarklein den von Chat erfragten Kontext: Für was der Sound gedacht ist, wie lang er sein soll, Stilrichtung, welche Stimmung er haben soll, usw. Chat bedankt sich, wiederholt alles zur Sicherheit nochmal zusammenfassend, und schlägt im Anschluss ausufernd ein Konzept vor, bietet eine Textnotation für Musiksoftware an, fragt nach Tools, die wir benutzen, für die er seinen Vorschlag anpassen könne, erläutert Instrumentenwahl, Länge, Klangcharakter, Tempo, Tonart und macht am Ende ein Angebot: Wenn du willst, kann ich dir jetzt direkt eine MIDI-Datei generieren. Klasse, sage ich, und freu mich, wie easy das alles ist. Dann mach das doch.
Großes Gerödel im Hintergrund, da scheint schwer was gerechnet, von A nach B durchdacht zu werden. Dann das Ergebnis:
Es scheint, als könnte ich gerade keine erweiterten Funktionen zur Dateierstellung nutzen.
Na toll. Stattdessen, sagt Chat, könne ich es ja vielleicht doch selbst zu machen und erläutert mir für was, wen (Software-Auflistung) und wie er mir dafür Anleitungen bereitstellen könnte.
Ich frage ihn, ob er eine WAV statt eine MIDI ausgeben könnte.
Kann er derzeit nicht. Warum sagt er nicht. Aber, schlägt er mir enthusiastisch vor, er könne mir eine komplette Notation zur Verfügung stellen und mir dabei helfen, es in eine der vorgeschlagenen Softwares einzupflegen, auch fürs eigene Spiel gibt er mir Noten an (rechte Hand, linke Hand), auch für mein Betriebssystem könne er mir Hilfestellung geben, und mir erklären, wie ich die WAV erzeugen könne …
Danach Stille. Auf beiden Seiten.
Am nächsten Morgen. Ich habe ausgeschlafen. Chat ja vielleicht auch. Ich frage ich ihn nochmal, ob er seinen Vorschlag von weiter oben denn jetzt als WAV-Datei ausgeben könne?
Er braucht lange, die drei Punkte schwer am Atmen, Gewichte werden gedrückt.
Dann ist sie da. Die WAV-Datei! Ich drücke auf Play. Drei Computertöne erklingen, die sich, ich schwöre, so anhören:
Di Di Dii.
Juni 2025 – Summerlove
Ich liebe den Sommer.
Ich fühle ihn
kostbar
Im Haus ist es schön.
Es ist quirlig, laut, zwischen den Freunden.
Juni 2025 – Die Menschen
Die Menschen machen mich wahnsinnig. Sie husten und schniefen und schnupfeln und räuspern sich, sie schmatzen und schmieren. Sie drängeln und drücken, sie halten die Tür nicht auf. Sie blinken nicht beim Autofahren, sie lassen ihre Hunde auf den Gehweg scheißen. Sie sprechen laut und playen games ohne Kopfhörer, sie hindern ihre Kinder nicht daran, im Cafe Wettrennen zu spielen. Sie scheißen selbst. Auf den Sitz in der U – wait for it – 5. Sie füttern Tauben und Spatzen. Das soll man nicht!
Juni 2025 – T.räume
Wer hat behauptet, der Traum sei zur Verarbeitung da, der Traum hält das Trauma aufrecht, er füttert die alte Erzählung, füllt sie mit Varianten, damit sie auf ewig bleibt, der Traum will geträumt werden, also träumt er mich, ich bin sein Wirt, warum erzählt er mir keine andere Geschichte, der Traum, eine, die mich erleichtert, mir sagt, wie gut und schön alles ist, eine Geschichte, die mich tröstet und beruhigt. Bin ich schuld an meinen Träumen, sind meine Träume schuld an mir, ich träume nicht meine Träume, meine Träume träumen mich.
Ich bin nicht meine Träume.
Juni 2025 – DDR
Im Büro vermacht mir jemand einen alten Schreibblock aus der DDR. Die Seiten sind vergilbt, eher in einem Karamell-Ton als in einer gelblichen Sepiafarbe. Das Cover ist in einem schönen Design gehalten. Schwarz mit goldenen Querstreifen, nach links und rechts gekippt, zusammen bilden sie kleine Rauten. Der Geruch des Papiers als ich das Cover hebe, irritiert mich. Ich finde ihn eigen. Ich kenne ihn nicht.
Ich frage mich, ob sich Menschen aufgrund dieses Geruchs in die DDR zurückversetzt fühlen, so Proustsche Madeleine-mäßig. Und sagen:
So hat die DDR gerochen.
Juni 2025 – see you
Ich liege in meinem Bett. Genau so und an der Stelle, wo er lag, eines Morgens. Wie er damals schaue ich in den Raum, Richtung Tür, dorthin wo ich stand. Ich war aus dem Bett aufgesprungen und hatte Dinge gesagt, wütend, laut, während ich nach irgendwelchen Kleidungsstücken griff, um sie mir anzuziehen. “Ich habe das Gefühl, du verlässt mich und es ist dir egal” war der Gipfel der Dinge, die ich sagte, war der Satz, in dem alles kulminierte und nach dem ich abrupt verstummte, weil mir die Tränen kamen.
Ich sehe mich dort stehen, aus seiner Perspektive, und versuche zu sehen, was er gesehen hat. Zu verstehen, was er verstanden hat.
Nur ein paar Tage später hat er mich verlassen.
Juni 2025 – Frau und Hund
Cafe in Mitte, morgens, Schlange. Zwei Frauen mit kleinem Hund, eine Frau mit großem Hund.
Der größere beschnuppert den kleinen. Verzückte Blicke auf die Hunde.
Der größere schiebt seine Nase full frontal an den Hintern des kleinen.
Ist das ein Männchen? fragt die Besitzerin des kleinen.
Ja. sagt die mit dem großen.
Ah – Sie ist grade läufig.
(Ich kotze fast in meinen Kaffee.)
Der macht nichts, sagt die Frau vom großen.
Ich bin der Meinung, der weiß nicht wies geht.
Alle drei Frauen lachen laut und kräftig.
Mir reichts schon wieder für heute.
Juni 2025 – Schmelz
Ich höre einen Song, irgendwo, im Vorübergehen. Ich kenne ihn gut. Ich weiß, dass T. ihn sehr mochte. Die Stimme einer Frau, hell, sehnsüchtig, mit einem fast ins Weinen kippenden Klang, sie singt von ihrer Sehnsucht nach dem Mann, den sie vermisst. Auch ich mag ihn sehr.
Andere Songs fallen mir ein, und andere Männer, bei denen es ähnlich war, wenn Frauenstimmen, die weich, fast gebrochen, ihre Liebe und ihren daraus resultierenden Kummer über Männer besingen.
Was, wenn die Rührung, die Text und Stimme bei Männern auslöst, gar nicht daher kommt, dass sie sich mit der Frau, die singt, identifizieren, so wie ich. Sondern daher, dass sie berührt davon sind, was Männer – also potentiell sie – Frauen antun können. Welchen Kummer und welchen Schmerz sie ihnen bereiten, welche starken Gefühle sie in ihnen auslösen. Wenn der empfundene Schmelz also, den das Lied auslöst, gar nicht von den Gefühlen der Frau herrührt, sondern vom Wissen um die tragische Cowboyhaftigkeit, die in den Männern wohnt, und die früher oder später aus ihnen herausbrechen wird. Vom Wissen um den Sonnenuntergang also, in den man eines Tages wird reiten müssen, auf den Schultern eine schicksalhafte Last, die getragen, im Herz einen Schmerz, der aufrecht ertragen werden muss, weil man die Frau mit ihrer Empfindsamkeit und ihrer Liebesfähigkeit zurücklassen muss.
Das älteste Identitäts-Narrativ der Welt, in dem man sich so herrlich gefühlig gefallen kann. Beiderseits.
Juni 2025 – Keine Heimat
Wo und wann geht es dir gut? schreibe ich auf einen Zettel.
Immer wieder begegnet er mir, über Tage, Wochen.
Juni 2025 – Vermissen
Das Vermissen von Menschen, die mir einmal nah waren
oder soll ich sagen, nie nah genug
ist ein so großer Anteil meines Gefühlshaushalts, dass ich mich frage, aus was ich sonst noch bestehe.
Juni 2025 – Sommersamstag
Die Wäsche schaukelt sacht
wie das Pendel einer Uhr
Juni 2025 – weg
U. ist weg.
Er war schon die ganze Zeit weg.
Erst war er in einem Weg in der Nähe.
Dann war er auf dem Weg ins Weg.
Jetzt ist er ganz weg. Dort, wo er hinwollte,
ins Weg.
Weg von mir.
Ich bin hier. Im Hier und Jetzt.
Denn das Weg ist ja schon besetzt.
Von starken Männern.
Im Hier ist die Luft jetzt rein. Ich kann mich frei bewegen.
So frei, wie jemand,
der den Bauch mit Wackersteinen voll hat.
Die sieben Geißlein tanzen um mich herum.
Mai 2025 – Kinseyfest
Ich mache einen Kinsey Skala Test, weil er mir im Dialog einer Serie über den Weg läuft. Lächerlich. Ich bestehe ihn mit Bravour.
Mai 2025 – mp
G. angesichts der vielen kleinen To-Do-Zettel auf meinen Schreibtisch:
Schon n bisschen manisch.
Ich:
Das ist nicht manisch, das ist panisch.
Mai 2025 – Vertrautes Fremdes
Oft sehe ich sie, irgendwo auf der Straße, an der Ampel, im Getümmel, T. und U
Ich sehe sie, weil irgendjemand mich für einen stechenden Moment an sie erinnert, weil Silhouette, Gangart, Gesichtszug, Kleidungsstil ihr Bild in mir aufruft. Ich sehe sie, weil diese anderen Männer in Situationen sind, in denen sie einmal waren, in denen sie vielleicht gerade sind, in denen sie irgendwann sein könnten. U mit einem kleinen blonden Mädchen auf den Schultern, das andere an der Hand, T. mit seiner Tour-de-France-Cap auf dem Rennrad, U im Auto auf dem Weg zum See, im Radio deutsches Songwriting, T., alt geworden, im weißen Hemd in einer Ausstellung, charmant parlierend neben einer gutaussehenden Frau, U, älter geworden, im Gespräch mit einem Enkelkind.
Was ich nicht finde, nie, in den Silhouetten, Gangarten, Gesichtszügen, Kleidungsstilen, T.s Wachheit, Radikalität und Traurigkeit, Us Ruhe, Eigensinn und Zurückgenommenheit.
Nun vermisse ich also schon zwei Männer.
Was ist die Aufgabe, mir einen dritten suchen?
Mai 2025 – Im Zug
Im ICE nach Berlin. Eine Durchsage des Zugführers:
Der Zug muss leider über Hannover umgeleitet werden. Grund ist ein Suizidversuch auf der Strecke.
Ein Fahrgast laut irgendwo weiter vorne im Abteil:
Einfach drüber fahren!
1 Dass ein voll besetzter ICE als Telegram Kanal für ungefiltert rausgehauene Hassposts herhalten muss, dass ein vor Verachtung und Würdelosigkeit strotzendes Statement nicht mehr von irgendeinem hugo_21 auf der Toilette getippt werden muss, sondern es lautstark am helllichten Tag in aller Öffentlichkeit geäußert wird, könnte mich und alle anderen schockieren, aber dazu sind wie alle schon zu abgebrüht. Das ist das eigentlich Schockierende.
2 Warum formuliert der Zugchef das so explizit? In der DBApp steht: Wegen eines Notfalleinsatzes, das scheint mir angemessen. Warum scheint mir aus der faktischen Formulierung, die er wählt, dennoch sein Ärger zu klingen. So, jetzt waren wir mal so schön pünktlich – denn in diesem Kontext hat der Suizid für ihn und die Bahn natürlich Bedeutung als Topos mit dem man regelmäßig umgehen, Protokolle abarbeiten muss – und nun wieder so einer. Hat seine explizite Formulierung, den Mann mit dem mündlich vorgetragenen Hasspost ermutigt? Geht es irgendjemand was an, ob ein Herzinfarkt, Schlaganfall oder Suizidversuch der Grund für den Notfalleinsatz ist? Ist es eine Indiskretion, das zu erwähnen? Fakt ist doch, jemand braucht Hilfe. Und wenn die Hilfe zu spät kommt, auch.
3 Hat der Suizid eines Menschen an Bedeutung, an Dramatik verloren? Der Aufwand, der auf institutioneller Ebene betrieben wird, um den Suizid zu verhindern, und ihn, wenn er passiert, zu be- arbeiten und zu verarbeiten, scheint mir hoch. Wieso hat man den Eindruck, die Institution hält hier einmal mehr etwas aufrecht, was einmal mühsam erarbeiteter Werte-Konsens war. Für die meisten scheint der Suizid vor allem ein narzisstischer, egoistischer Akt zu sein. Der Abläufe stört und Menschen verstört. Warum soll man den Suizidalen retten, wenn er doch gar nicht gerettet werden will. Ist doch eine freie Entscheidung. Außerdem, andere, also wir hier, stellen uns doch auch nicht so an, halten die ganze Scheiße aus, zum Beispiel die ewigen Bahnverspätungen, aber irgendeiner muss sich ja immer wichtig machen.
4 Hat der begleitete, freiwillige, sozusagen saubere Suizid, dem regulären seine Dramatik genommen, der deshalb jetzt noch eher als Ärgernis, Unverschämtheit, Rücksichtslosigkeit wahrgenommen wird?
Mai 2025 – News
Dann wieder Nachrichten, die mich glücklich machen. Ich bin so begeistert. Alles ist gut heute, life is beautiful:
Es gibt einen neuen Kontinent: Zealandia. Er hat sich versteckt gehalten, im Wasser, nicht mal besonders tief. Wir haben nur nicht verstanden, dass er ein Kontinent ist.
Es gibt eine neue Farbe. Sie heißt Olo. Wir konnten sie nur nicht sehen. Bis jetzt!
Mai 2025 – Ausschau
Der quälende Gedanke, dass ich den letzten netten Mann über fünfzig in die Flucht geschlagen habe.
Mai 2025 – Party
Ich bin auf einer Party eingeladen. Ich will da hin. Es werden viele Leute da sein. Ich überlege, was ich mitbringen will, ich kaufe ein, ich will was backen, ich freu mich drauf, das Wetter wird toll, es ist ein bisschen weiter draußen, wie komm ich da hin, ich suche schon mal eine passende Bahn raus.
Schon morgens merke ich, dass es schwierig wird. In meinem Kopf tanzen mögliche Situationen, tummeln sich Menschen, die dort sein werden.
Manche von ihnen Freunde von T., die die Gefahr mit sich bringen, dass ich etwas mitbekomme, was ich nicht wissen will, manche von ihnen Menschen, die ich lange nicht gesehen habe und mit denen die Begegnungen deshalb unangenehm sein könnten, mir fallen Momente ein, in denen ich verletzt wurde von diesen Menschen, ich denke an alte Geschichten. Ich verschiebe das Backen, ich fange an zu backen, ich mache was anderes, ich backe weiter.
Ich zwinge mich, die schönen Sachen aufzurufen, daran zu denken, dass ich Menschen sehen werde, die ich mag, die nett sind, dass ich eine Frau wiedertreffen werde, die ich kürzlich kennen gelernt habe, dass ich auf eine Party! eingeladen bin, dass es sicher, ganz sicher, ein schöner, entspannter, liebreizender Nachmittag im Grünen wird, dass es guttun wird, es geschafft zu haben dorthin zu gehen, dass es wichtig ist, notwendig und wohltuend unter Menschen und im Kontakt zu sein, dass es wichtig ist, sich nicht auszuschließen, Ja zu sagen, statt Nein, dass es schön ist, mit einer immer herzlichen Freundin zu feiern, die dich an deinem Geburtstag besucht, wenn du sie einlädst, obwohl ihr das sicher auch nicht immer leicht fällt, die dich nicht vermissen wird, wenn du nicht da bist, aber die sich verdammt nochmal freuen wird, wenn du kommst, verstehst du das?
Ich laufe los.
Auf der halben Strecke zur Bahn kehre ich um.
Ich schreibe eine Nachricht, dass ich es nicht schaffe.
Es ist ein Desaster. Die Depression ist da, da gibt es kein Vertun.
Sie wirft mich nieder, wirft mich raus, heute und die nächsten Tage, sie kommt wieder keine Frage. Der Kampf ist verloren, er hat mich erschöpft. Ich habs nicht geschafft. Ich habs nicht geschafft. Ich habs nicht geschafft.
Später sehe ich die Fotos, die glücklichen Textnachrichten: Es war ein schöner, entspannter, liebreizender Nachmittag im Grünen.
Mai 2025 – K wie Kontakt
Mal wieder ein Paket bei der Nachbarin gelandet. Es dauert lange, bis sie öffnet. In letzter Zeit war sie oft nicht da, ihre Schwiegertochter hat aufgemacht. Ich sehe: Sie hat kaum noch Haare. Der Krebs ist zurück. Ihr Körper ist schwer, sie sucht im Kämmerchen nach dem Paket. Während ich warte, überlege ich, was ich sagen könnte, wie geht’s Ihnen?
Ich sage nichts.
Ein paar Tage später sehe ich sie wieder. Zwei Sanis bringen sie mit dem Transporter zurück. Bringdienst? Wahrscheinlich kommt sie von der Chemo. Ich schaue rüber zu ihr, die Straße hinunter, so lange, bis sie mich entdeckt. Dann hebe ich die Hand zum Gruß. Sie lächelt und winkt zurück.
Mai 2025 – Meldung:
Lindner hat einen Hund überfahren. Der Hund gehört einem Filmproduzenten und war klein. Sehr klein. Der Hund war so klein, etwa 1 Meter 67, dass Lindner ihn in seinem SUV übersehen musste. Die Filmrechte wurden vom Produzenten noch vor Ort erworben. Nachdem er seine Tränen getrocknet hatte. Blöd ist, dass Lindner gerade ein Baby bekommen hat. Was jetzt schlecht zusammen passt, schlagzeilentechnisch.
Interessant an der Sache: noch nie war ich Lindner so nahe. Das Menschliche tropft nach dieser Sache aus ihm, wie das Gedärm aus dem Hund.
Der Produzent wird sich das nächste Mal einen größeren Hund anschaffen. Ein edleres Tier. Vom Geld aus der Klage.
Mai 2025 – Bereit
Ich wünsche mir ja nicht mal mehr jemand, der mich liebt. Von Minute zu Minute scheint das weniger möglich zu sein. Ich sehe es,
in allem, was sich spiegelt.
Ich wünsche mir jemand, der bereit wäre, mich zu lieben. Allzeit bereit. Der dieser Frage also mit permanenter Offenheit begegnet.
Ich denke darüber nach, wer je zu mir Ich liebe dich gesagt hat. Darüber, wie oft ich diesen Satz gehört habe, in meinem Leben. Ich erinnere mich an zweimal.
Und wie oft ich ihn gesagt habe. Öfter, aber nicht viel öfter. Mit Bedacht und ohne Drogeneinfluss.
Man soll ja nicht verschwenderisch sein damit, und es nicht so machen, wie die in den amerikanischen Serien. Aber so ist es auch nicht gut. Ein bisschen wenig für ein ganzes Leben.
Mai 2025 – heute
Ein Kollege erzählt mir von der Tracking App, die er fürs Handy seiner 11jährigen Tochter installiert hat. Sie weiß nichts davon. Ich weiß, sagt er, und checkt, ob sie in der Sporthalle angekommen ist, in die sie mit dem Rad unterwegs war, das ist mega scheiße. Aber was willst du machen, ey. Heute
Mai 2025 – next one
Schon wieder eine OP. Nichts Wildes, so ein ewig verschobenes Muss-halt.
Meine Laune ist mega schlecht. Wieder stochert die Schwester in meinen Venen herum, ich fühle schon beim ersten Mal, dass es nicht klappen wird, wie ich das hasse, wenn die das nicht können und sie dann Drüberweglabern über ihre Unfähigkeit, auf dem Op-Tisch werde ich robust platziert, obwohl ich sage, dass ich meinen Arm nicht so verdrehen kann, weil die Schulter leider kaputt ist, als jemand anderes dazu kommt, ist es plötzlich kein Problem mehr, den Arm nicht derart anzuwinkeln, aber ich bin sowieso nicht mehr vorhanden, ich bin ein Bein, das jetzt fertig gemacht werden muss, weil die Ärztin gleich da ist, ich bin ein Unterschenkel, ein Unterschenkel von vielen, ein Unterschenkel der desinfiziert wird, ein Unterschenkel, der winzig fein aufgeschnitten wird, ich bin OP-Vieh, die Narkose, diesmal ein sogenannter Dämmerschlaf, wirkt mal wieder nur halbgar und ich habe starke, brennende Schmerzen, formuliere das auch, fragend, zweimal im Laufe der OP mit der vorsichtigen Intonation von: Ist das normal, ohne weitere Reaktion der Narkoseschwester, ich halte die Augen geschlossen, die Tränen laufen mir sanft und leise aus den geschlossenen Augen, wie das Blut aus dem Bein.
Habe ich schon gesagt, dass ich erschöpft bin? Das stimmt nicht mehr, ich bin aggressiv.
C. holt mich ab,
das ist so gut.
Wie schafft sie das nur immer.
Mai 2025 – Meno Päuschen
Eine junge Frau auf der Straße spricht mich an, Sorry, ob ich zufällig einen Tampon habe?
Sehr schmeichelhafte Frage.
Mai 2025 – church
Ich mal wieder in der Kirche. Die Kirche katholisch, sieht aber vertraut evangelisch aus, karges Betongebäude. Der Pfarrer so voll locker, muss man sein, wenn man heute noch jemand da hinlocken will, die Ministranten, zwei Mädchen, war auch mal undenkbar, kleiden sich in der Sakristei um als ich aufs Klo muss, man bedankt sich herzlich, dass sie heute so spontan eingesprungen sind, was hätte man sonst gemacht ohne sie. Fachkräftemangel wo man hinschaut. Der Co-Priester aus Ghana, er liest einen Bibeltext, der Mann vor mir verzieht das Gesicht, weil der kein ordentliches Deutsch kann.
Kurzfassen können sie sich immer noch nicht, nach dem xten Song, dem xten Gebet, noch ein Song, noch ein Gebet.
Das Kind ergriffen, erfasst von Glaube, Liebe, Hoffnung
und vor allem: der Sorge um die Welt. Beschäftigt mit den großen Fragen. Es rührt mich.
Ich erinnere mich so gut daran.
April 2025 – Ms Augen
Suchend,
fragend,
entsetzt?
Wirr, irre, wirrirre
Wahrnehmend:
Geräusch, Licht, Berührung.
Erinnernd, denkend?
Ich weiß es nicht.
April 2025 – Project 2025
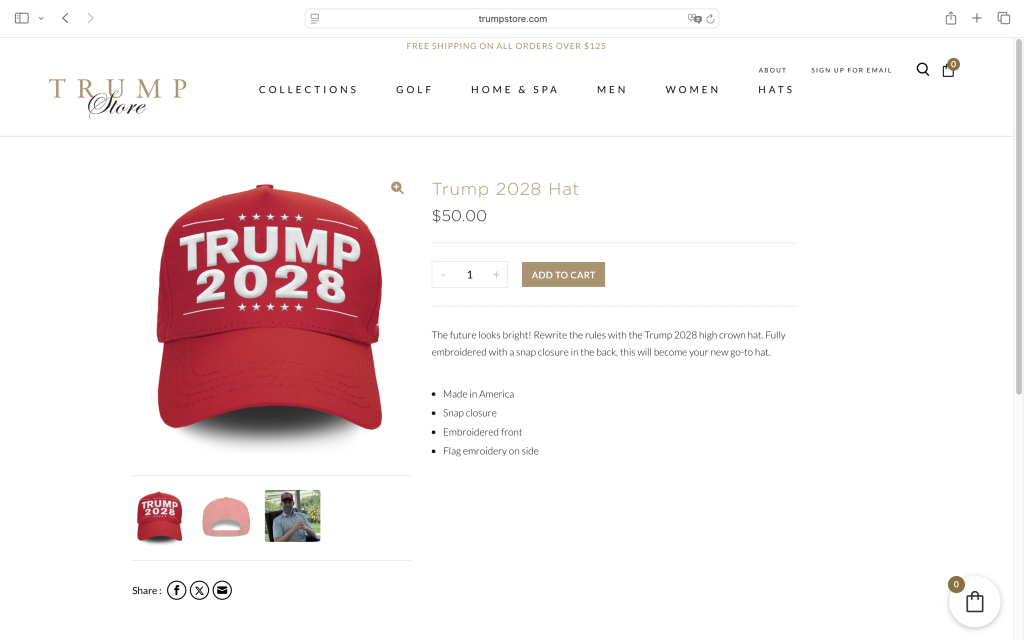
April 2025 – NVC
NPC: Non-playable character.
Thats me. Ich steh am Rand und wippe. Rede irre vor mich hin.
Dann bekomme ich eine Beförderung nach unten (Trennung; Alter; Kündigung)
und werde vom NPC
zum NVC: Non-visible character.
April 2025 – Sommer
Wieder liegt ein Sommer vor mir.
So wie manchmal auch ein Jahr vor mir liegt.
Asl wäre er eine Bürde, etwas, das es zu tragen, zu stemmen gilt.
Dabei liebe ich den Sommer. Im Sommer habe ich am ehesten eine Chance.
Warte doch mal ab. Hab doch mal ein bisschen Geduld.
Wenn ich nichts tue, passiert nichts, versteht ihr das nicht? Da sind die Tage, die Abende, und die Wochenenden! Die Nächte, die Morgen, die Stunden, die Wochen, die Feiertage, die Brückentage! und
all diese Sekunden.
Dauernd passiert was. In den Nachrichten. Von dem ich froh bin, dass es mir nicht passiert. Aber es passiert mir ja doch.
Wo ist das gute, das richtige Passieren?
Im Kontakt.
In der Berührung, im Austausch, im selbstgewählten, temporären Rückzug.
Was, wenn der Kontakt verboten ist.
April 2025 – Du kannst
Du kannst nicht Vorteile von mir haben (Plaudern Sex Reise Support) ohne die Nachteile (Depression Kampf schlechte Gesundheit doofe Angewohnheiten).
Du kannst keine Beziehung haben ohne einander Verlorengehen ohne temporäre Sexlosigkeit ohne Aushalten und Dranbleiben ohne temporäre emotionale Transparenz ohne das Wagnis der Bedürfnisäußerung ohne Zweifel ohne konstruktive Lösungen für den Konflikt. Ohne Arbeit. Aber wenns die Beziehung nicht wert ist. Wenn die Vorteile nicht mehr überwiegen.
Wenn die Gefühle nicht reichen.
Dann kannst du.
So war das also.
April 2025 – Swinemünde im April – Notizen 2
Das Cafe. Mit dem perfekt versteckten Blick auf die Promenade.
Der Sand. Ich ziehe die Schuhe aus.
Die Kantine mit den Piroggen. Sie heißt irgendwas mit Babicka.
Der Supermarkt, bei dem man nie weiß, ob er offen hat oder zu, so verschlossen ist alles.
Das hübsche weiße Haus in Bäderarchitektur, das zum Verkauf steht.
Der Mann vor den Garagen, tiefgetaucht in den Kofferraum seines Autos. Im Hintergrund die Platten.
April 2025 – Swinemünde im April – Notizen 1
Ich fahre trotzdem
Das gute alte Trotzdem
Man weiß nie, ob das gut ist
Die Gefahr ist groß
Aber das ist sie zuhause auch
Und ich wollte doch
(Raus hier),
ich hab mich doch
(Darauf gefreut),
das war doch
(Lange geplant).
Ich wollte das Meer sehen
Warum seh ich eigentlich nie das Meer.
Das Meer ist die Ostsee, naja
Ich arbeite alles ab. Zugfahren. Ankommen. Einchecken. Loslaufen.
Dies anschauen. Und das. Ach, guck mal. Dann noch dahin.
Ich komme klar. Ich komm schon klar.
Klarkommen ist was anderes als.
So verlaufen die Tage.
Es geht
Es geht nicht
Es geht nicht gut
Es geht mir nicht gut
Glücklicherweise kommt C.
Ich nehme ihre Hand und spreche es aus.
Wie gleich hätte alles ausgesehen, wie anders wäre alles gewesen.
Was für eine Verschwendung.
April 2025 – Swinemünde im April – Glitzer
Im Zug
Der Pullover der Frau
Grau mit winzigen Glitzersteinchen
Die Sonne macht ein Lichtspiel draus, wirft es für uns alle an die Decke.
April 2025 – Drei Männer und ein Geburtstag
Der eine, ein Vater, ruft an, ich nehme nicht ab, die Voice Mail nett, hilflos.
Ein anderer, T., meldet sich nicht, und hat wie immer die Oberhand.
Ein dritter, U, meldet sich, nett und warm und ohne begriffen zu haben, dass er sich vor ein paar Tagen von mir getrennt hat und nicht alles haben kann.
Egal wie, ob oder nicht. Alle bereiten mir Schmerzen.
April 2025 – repeat
Ich will allein sein.
Wie die Sätze sich wiederholen.
Von Mann zu Mann zu Mann.
April 2025 – Trennung
Ich könnte mir wie andere Leute einen Hund kaufen.
Und ihn Volker nennen.
Nach T
und U
kommt V
März 2025 – Johl
Zwei Prolls in ihren 30ern (!) ziehen johlend um die Ecke. Ein obdachloser Mann liegt in seinem Schlafsack an einer Hauswand und schläft. He! Uffwachen brüllt der eine ihn unvermittelt an. Lautes Proll-Gelächter.
Ihr Arschlöcher, sage ich zu ihnen. Hilflos steht das im Raum, verhallt irgendwo zwischen mir und einer lachenden Wand, die mir sagt, ich bin draußen.
März 2025 – Mühsam Berlin
Überall diese Fickerei.
Keiner schaut sich mehr an, küsst sich, kuschelt, streichelt, spielt, ist zärtlich.
Für sowas hat man einen Hund.
Harte Drogen kinky Sex. Diese Stadt hat noch nie zu mir gepasst.
Ihre Kälte hat sie nie verloren.
If you can’t fuck anywhere you can fuck here.
März 2025 – free speech
accessible
activism
activists
advocacy
advocate
advocates
affirming care
all-inclusive
allyship
anti-racism
antiracist
assigned at birth
assigned female at birth
assigned male at birth
at risk
barrier
barriers
belong
bias
biased
biased toward
biases
biases towards
biologically female
biologically male
BIPOC
Black
breastfeed + people
breastfeed + person
chestfeed + people
chestfeed + person
clean energy
climate crisis
climate science
commercial sex worker
community diversity
community equity
confirmation bias
cultural competence
cultural differences
cultural heritage
cultural sensitivity
culturally appropriate
culturally responsive
DEI
DEIA
DEIAB
DEIJ
disabilities
disability
discriminated
discrimination
discriminatory
disparity
diverse
diverse backgrounds
diverse communities
diverse community
diverse group
diverse groups
diversified
diversify
diversifying
diversity
enhance the diversity
enhancing diversity
environmental quality
equal opportunity
equality
equitable
equitableness
equity
ethnicity
excluded
exclusion
expression
female
females
feminism
fostering inclusivity
GBV
gender
gender based
gender based violence
gender diversity
gender identity
gender ideology
gender-affirming care
genders
Gulf of Mexico
hate speech
health disparity
health equity
hispanic minority
historically
identity
immigrants
implicit bias
implicit biases
inclusion
inclusive
inclusive leadership
inclusiveness
inclusivity
increase diversity
increase the diversity
indigenous community
inequalities
inequality
inequitable
inequities
inequity
injustice
institutional
intersectional
intersectionality
key groups
key people
key populations
Latinx
LGBT
LGBTQ
marginalize
marginalized
men who have sex with men
mental health
minorities
minority
most risk
MSM
multicultural
Mx
Native American
non-binary
nonbinary
oppression
oppressive
orientation
people + uterus
people-centered care
person-centered
person-centered care
polarization
political
pollution
pregnant people
pregnant person
pregnant persons
prejudice
privilege
privileges
promote diversity
promoting diversity
pronoun
pronouns
prostitute
race
race and ethnicity
racial
racial diversity
racial identity
racial inequality
racial justice
racially
racism
segregation
sense of belonging
sex
sexual preferences
sexuality
social justice
sociocultural
socioeconomic
status
stereotype
stereotypes
systemic
systemically
they/them
trans
transgender
transsexual
trauma
traumatic
tribal
unconscious bias
underappreciated
underprivileged
underrepresentation
underrepresented
underserved
undervalued
victim
victims
vulnerable populations
women
women and underrepresented
März 2025 – Erinnerungskultur
Ist das abgebrochen oder ist das so gebaut? fragt eine junge Frau mit Kind ihren Freund. Sie meint die Gedächtniskirche.
März 2025 – doomed
The world ist doomed.
There is no dooms day.
There are doom years, decades, ahead of us,
ahead of you,
ahead of me
März 2025 – Arschis
Was für Arschis sind das eigentlich, die ihren Müll in Fahrradkörbe werfen?
Februar 2025 – Drin im System
Ich sehe schlimm aus, die Rosazea treibt mal wieder ihre Blüten auf meinem Gesicht, rot, entzündet, demütigend, ich habe keine Creme mehr, ich suche die ganze Stadt und die einschlägige Arzttermin-Plattform nach einem Termin beim Hautarzt ab , es gibt keinen. Oder genauer: Es gibt keinen, der umsonst ist. Genau wie die Orthopäden und die Augenärzte haben die Hautärzte nämlich aufgerüstet. Sie sind jetzt moderne Dienstleister mit shiny-schick eingerichteten Praxen in denen die Mieten so teuer sind, dass die Armen gucken müssen wo sie bleiben und deshalb listig behaupten, auf ihren Webseiten und auf der einschlägigen Arzttermin-Plattform, dass sie offen für Kassenpatienten sind, dann aber leider nur noch Termine für Privatpatienten haben oder vereinzelte, in weiter Zukunft liegende für Selbstzahler, die allerdings nur schrittweise freigegeben werden.
Der Selbstzahler ist der neue Kassenpatient.
Ich gebe irgendwann klein bei. Ich zahle knapp 100 Euro für den Hautarzt-Besuch, bei dem ich über die Rosazea erfahre, was ich schon weiß und endlich das Rezept bekomme für die Salbe, die ich brauche, für die ich in Worten sechzig Euro bezahle, weil ich ja nicht über die Kasse da bin. Die angestellte Ärztin gibt mir sozusagen an ihrer Arbeitgeberin Schrägstrich Arzt-Unternehmerin vorbei den Tipp, das nächste Mal eine Krebsvorsorge zu bezahlen, (die man laut Kasse alle zwei Jahre machen soll, um eine der aggressivsten Krebsarten zu bekämpfen, nicht umsonst gibt, bei keinem Hautarzt mehr, weil die Kasse den Ärzten, so erfahre ich von einer Ärztin, nur etwas mehr als 20 Euro pro Untersuchung dafür gibt), dann wäre ich nämlich drin im System und sie könne mir dann auch ein reguläres Rezept für die Salbe geben mit dem ich nur die Zuzahlung für die Krankenkasse zahlen muss. Das mach ich natürlich. Baldiger Hautkrebstermin für knapp 100 Euro, bitte. Denn ich will ja rein, ins System.
Februar 2025 – Hussel-Alarm
Ich bummel durch die Mall und gehe zu Hussel.
Mit der kleinen Zange fülle ich drei mit Schokolade umhüllte getrocknete Apfelscheiben in ein Tütchen, Zartbitter, Vollmilch, weiß, ein Ritual. 7 Euro 30, sagt der Mann hinterm Tresen. Nein, sage ich und schaue ihn erschrocken an, das geht nicht. Ich gebe ihm die Tüte zurück, überlasse es ihm, die drei schokolierten Äpfel, die mir gehören könnten, wieder zurück zu räumen.
Ich gehe auch seltener essen, fällt mir auf. Alles ist so teuer.
Februar 2025 – Dussmann
Bei Dussmann. Alle schreiben Bücher, warum ich nicht? Das weiß nur mein Psychohirn.
Februar 2025 – nach der Endstation gehts weiter
Sbahn. Endstation, alle aussteigen.
Einer ist zu lahm – zu besoffen, zu dicht. Alle schon draußen, Türen zu. Er drückt noch, die Bierflasche in der Hand, von innen den Knopf. Die Bahn fährt los, er bleibt drin.
Wohin mögen sie ihn fahren …
Januar 2025 – Der Nachbar
Mein Nachbar von obendrüber quält mich. Er gefährdet mein Wohlergehen, meine psychische Stabilität, ja, sogar meine Beziehung. Das macht er jetzt schon sehr lange. Zweimal hab ich mit ihm gesprochen, dreimal hab ich ihm einen Zettel in den Briefkasten gelegt. Er hat 24 Stunden auf Koks mit irgendeiner Kreisch-Tussi gefickt, jede vorhandene Tür sowie Schublade um jede mögliche Uhrzeit knallen lassen, er ist nachts um 2, morgens um 5 oder mittags um 12 auf seinem Laufband gerannt, das ein stetes Maschinengeräusch in mein Schlafzimmer gepumpt hat, sein Bett hat nächtelang ungelogen ununterbrochen ein knarzendes Geräusch von sich gegeben, als wäre es aus dünnem Holz, er hat Techno gehört, so telefoniert, dass ich alle seine Thesen verstanden habe, ständig habe ich neue Leute im Haus gesehen – Airbnb?, Zigarettenstummel auf meinem Balkon gefunden, die man dort nur absichtlich hinbekommt, verschiedene Frauen durchs Haus kommen und gehen sehen, die er zu seinen, ich schätze mal PornHub- oder OnlyFans-Videodrehs eingeladen hat. Er hat sich in meinen Kopf gefressen, er ist mein Mitbewohner wider Willen, von dem ich nichts wissen will aber alles dauernd wissen muss. Wenn ich ihn von weitem auf der Straße gesehen habe, hasse ich ihn so, dass mir fast der Schädel platzt, er ist nämlich ein WIESEL. Wiesel sind Menschen, von denen man denkt, der wär gleich vorne mit dabei gewesen. Du hättest nett und verständig getan, um einen gemachten Mann aus dir zu machen und bedauernd geguckt, wenn du die Leute an der Rampe aussortiert hättest, du ekelhaftes Tier.
Irgendwann schreibe ich eine Mail an die Hausverwaltung. Die zuständige Mitarbeiterin ruft mich Wochen später an, um nachzuhaken. Irgendwann kapiere ich, nicht mein Leiden unter der Lärmbelästigung ist der Grund ihres Anrufs, sondern dass sie aufgrund meiner Mail begriffen hat, dass über mir ein illegaler Untermieter wohnt.
Ich fertige ein Lärmprotokoll an, denn ohne geht es nicht, sagt sie.
Ein paar Wochen später. Ein Bett steht neben unserer Haustür, schön in seine Einzelteile zerlegt, Sperrmüll, soll sich drum kümmern, wer will. Das Bett ist aus Rattan! Zumindest das Knarzen hört auf.
Viel später. Ich treffe den anderen Nachbarn im Hausflur, der, der meinem Quäl-Nachbarn gegenüber wohnt. Ich bin schon fast vorbei, wir grüßen uns immer, sprechen aber eigentlich nie, Der is ja ausgezogen, sagt er unvermittelt. Ich stutze. Ach, sage ich. Und frage ihn, ob er sich denn auch gestört gefühlt hat. Der hat ja ein Bordell betrieben da, sagt er, die haben ja nachts bei uns manchmal geklingelt. Und dann immer die ganzen Frauen vor der Tür. Ich staune.
Ich dachte, ich hab zu viel irre Fantasie
Stellt sich raus, alles stimmt, ist nur noch viel krasser als ich dachte.
Januar 2025 – Headline
Headline eines Artikels: Frauen, wir müssen mutiger reisen!
Wie mich das nervt. Was ich immer alles muss, weil ich eine Frau bin.
Januar 2025 – Narbe
Die Narbe am Handgelenk sieht aus wie ein Suizidversuch.
Passt ja.
Dezember 2024 – Silvester
Null Uhr.
Meine Nachbarin von schräg gegenüber
allein auf dem Balkon
In jeder Hand eine brennende Wunderkerze.
Sie wedelt mit ihnen
als wären sie zwei Rührhaken
N. erzählt von einem Freund, der sich in die Badewanne legt und aus dem Fenster das Feuerwerk betrachtet.
Dezember 2024 – Sbahn fahren
Ich fahre SBahn.
Bellevue, ein Mann verrichtet seine Notdurft, Number One and Two auf dem Bahnsteig. Als wir an ihm vorbeifahren lässt er gerade das Papierchen fallen, mit dem er sich den Hintern abgewischt hat und zieht sich die Unterhose hoch.
Nächste Station Tiergarten, eine Frau, ich schwöre, sitzt auf der Bank und kotzt mitten auf den Bahnsteig. Einmal zweimal dreimal, raus das Mittagessen. Heute ist der 31.12., Happy New Year. Besser wirds nicht.
Dezember 2024 – Hund
Um sein Frauchen herum
läuft ein Hund auf mich zu
und lächelt mich an.
Er hat gesehen
dass ich traurig bin.
Dezember 2024 – Ich kann tun und lassen was ich will
Mein Unbewusstes weiß,
weiß ganz genau,
dass Weihnachten/Silvester ist. Es schickt mir einen Traum mit T.
Diesmal taucht er nicht mal mehr selbst auf, stattdessen ein gemeinsamer Freund. Er erklärt mir T., erzählt mir, wie es ihm geht und was er macht. Als ich aufwache, kann ich mich an nichts davon erinnern. Nur mein Körper weiß, was geschehen ist.
November 2024 – Klinik
… Am nächsten Tag quer durch die Stadt zum ambulanten Chirurg. Ich brauche eine Krankenhauseinweisungsbescheinigung. längstes deutsches Wort ever. Sehr gut organisierter Durchgangsarzt, trotzdem wird mir schwummrig von den Gesprächen, die ich vom Wartezimmer aus mithöre, der Zehennagel hängt nur noch so dran; der Deckel von der Thunfischdose war zu scharf …
Am übernächsten Tag zur OP Vorbesprechung nach Marzahn. Erneut werde ich 8 Stunden in der Klinik sein.
Der Orthopäde bespricht die OP mit mir. Die Anästhesistin scheint mich vergessen zu haben. Der Orthopäde schickt mich deshalb schon mal zum Gipsen, weil ihm der Gips aus Bad Saarow nicht gefällt. Beim Gipsen begehe ich den Fehler auf meinen Arm zu schauen. Ich bitte die Schwester, mich hinlegen zu dürfen und um ein Glas Wasser, das völlig verschobene Handgelenk, der ganze Arm (Hämatom) sieht fürchterlich aus. Ich plaudere mich durch meine Angst, frage nach ihrer Ausbildung.
Als Nächstes muss ich in die Radiologie, um zu sehen, wie der Bruch aktuell steht. Strahlenbelastung in den letzten Jahren auch immer höher. Aber einer fragt. Auch dort vergisst man mich im Warteraum. Ich mache mich bemerkbar, frage bei der Radiologie-Anmeldung, ob man mich vergessen hat. Dort werde ich weggeschickt.
Ab und zu tritt ein junger MTA aus dem Maschinenraum in den Wartebereich, ruft Namen auf, die nicht meine sind oder unbeantwortet bleiben. Eine ältere Frau, schon wieder dement, liegt, immer wieder mal stöhnend, im Bett. Sie wäre meiner Einschätzung nach gar nicht in der Lage dazu, ihren Namen zu verstehen, noch zu antworten, wenn sie aufgerufen wird. Doch der Radiologieassistent kommt nicht auf die Idee, dass sie überhaupt jemand mit Namen sein könnte, sie ist ein Bett. Abgestellt von jemand, der schon wissen wird, was das soll. Falls sie morgen noch hier liegt, würde es mich nicht wundern, dann vielleicht auch tot, viel fehlt sowieso nicht mehr.
Irgendwann komme ich zurück an den Anfang des Warteprozesses, wo auch die Anästhesie sich an mich erinnert. Der OP-Termin, den ich bekomme, liegt an der Grenze der maximal erlaubten Zeit bis zur Operation eines solchen Bruchs. 14 Tage werde ich mit dem Gips herumlaufen, was die Zeit bis zur Knochenheilung – sechs Wochen – also auf insgesamt acht Wochen dehnt.
Am nächsten Tag habe ich eine Job-Besprechung. Es ist klar, dass ich niemandem bei der Firma oder der Redaktion von meinem gebrochenen Handgelenk erzählen kann, solange ich den Job nicht fest habe. Die würden mich sofort rauswerfen, zu hohes Risiko, der Zeitdruck auf dem Projekt ist groß, ist er immer. Ich halte den Arm beim Teams-Call unten, damit man den Gips nicht sieht.
Vorher ist alles gut gelaufen, die Produktionsfirma mochte den Pitch. Hat ihn weitergeleitet an die Redaktion. Nadelöhr 1, Check. Von der Redakteurin werde ich im Call gelobt, ich höre Dinge wie Wärme, feiner Humor, feine Feder. Aus irgendeinem Grund bin ich gerührt davon, weil ich das Gefühl habe, verstanden worden zu sein. „Umso mehr tut es mir leid …“ , setzt die Redakteurin an, und ich stürze, die dramatische Fallhöhe, die sie gebaut hat und auf die ich hereingefallen bin, zu hoch, tief hinunter „… dass wir den Stoff nicht machen können, vielleicht fällt ihnen ja noch was anderes ein.“
Na klar, ich schau mal. Zurück auf Los, zurück ins Ungewisse, was arbeiten und Geld verdienen angeht.
Ich mache alles mit rechts. Hose anziehen ist am Schwierigsten. Betten beziehen geht nicht. Spülen ist auch schwierig. Aber sonst komme ich erstaunlich gut klar.
Am Tag der OP – in der Zwischenzeit arbeite ich mit verstecktem Gipsarm und versuche, möglichst viel zu diktieren und mit einer Hand zu schreiben, um die linke nicht zu belasten – fahre ich morgens um fünf ins Krankenhaus. Ich habe Angst, Angst, dass die OP nicht gut verläuft, Angst vor den Schmerzen, den nicht wirkenden Medikamenten, dem Aufenthalt in der Klinik.
In der Vorbereitung zur OP ein Anästhesist, der irritiert ist, warum ich eine Vollnarkose bekomme, er hat sich auf was Lokales vorbereitet. Lokal, sicher nicht, was denken diese Heroes sich immer? Dass ich ihnen dabei zuhöre, wie sie meinen Arm öffnen, ihre Platten darin verlegen und alles schön festnieten? Der Anästhesist ist nett, keine Ahnung, warum die immer so nett sind, aber die Anästhesisten kommen mir vor wie die nettesten Ärzte, die es gibt. Trotzdem gucken sie nicht auf die Zettel, die man ausgefüllt hat, die ihre Kollegen ausgefüllt haben. Jetzt ist jetzt. Tl;dr. Den Operateur werde ich nicht sehen, ich werde vorher schon weg sein. Wieder versucht ein Pfleger mir einen Zugang zu legen, wie immer merke ich nach 10 Sekunden, ob es klappen wird oder nicht. Es klappt nicht. Er stochert herum, mehrfach, gleicht seine Unfähigkeit durch Laberei aus. Der Anästhesist erbarmt sich, schafft es aufs erste Mal, das Ding sitzt.
Als ich aufwache, habe ich starke Schmerzen im ganzen linken Arm. Es fühlt sich an wie direkt nach dem Bruch, all on fire, from finger to shoulder. Ich bin sehr unruhig, nervös, bewege die Beine hin und her (Opiate). Irgendein Arzt geht, irgendeine Ärztin kommt, sie schaut nach anderen, nicht nach mir. Ich spreche sie irgendwann an. Sage ihr, dass ich Schmerzen habe. Ein anderer Arzt kommt irgendwann, fragt mich wie stark die Schmerzen sind auf einer Skala von 1-10. Die Frage kenne ich schon. Acht, sage ich, und wenn Sie mir sagen, dass das normal ist, halte ich das aus. Nein, sagt er, das ist mir zu hoch. Ich erwähne wie immer, wie schon auf allen Zetteln, die Sache mit den Opiaten, und er gibt mir andere Mittel, erst eins, dann später noch ein weiteres, von dem ich weich und ruhiger werde: Die Schmerzen sind da, der Arm ist da, aber beides ist weiter weg. Irgendwann werde ich mit dem Bett an anderen Betten vorbei, Box-Betten, von einem der Betten-Schieber in mein Zimmer geschoben. Ich war sehr lange im Aufwachraum. Ich finde es zu früh.
Die Schmerzen bleiben hartnäckig, lange. Neben mir eine Frau, 20 Jahre älter als ich, mit gebrochener Hüfte. Sie spricht. Und spricht. Und spricht und spricht. Ein Trigger für mich. Missbrauchs-Gefühle, ich kenne das, von meiner Mutter, meiner Kindheits- und Teenie-Freundin L. Auch am nächsten Tag hört sie nicht auf zu sprechen. Sie bekommt Besuch, mehrmals und erzählt bei jedem Besuch alles, was ich schon mehrfach gehört habe und schon ganz genau weiß, nochmal. Sie hat ihren Mann (erste Demenzansätze, guter Grund, ihn rumzukommandieren und zu demütigen) und ihren Sohn (du willst doch deine Mutti besuchen) ziemlich im Griff. Sie tut mir trotzdem leid. Ich kann nicht weg, nicht auf den Flur, mir ist schwindlig, übel, schwach. Mein Arm ist geschwollen und ich versteh das alles nicht. Müsste das nicht anders sein? Ist das normal? Ich bin enttäuscht von mir, dass ich da nicht schnell wieder fit rauslaufe.
Zu meiner Überraschung muss ich einen Tag länger bleiben, was ich sehr gut finde, denn aufstehen und gehen scheint nicht denkbar. Ich trage permanent Kopfhörer, trotzdem spricht die Frau die ganze Zeit, auch hier erfahre ich Anamnese Diagnose Perspektive. Ich wundere mich, wie wenig der Geriater zum Thema Versorgung zuhause im Anschluss weiß.
Morgens bei der Visite ein Auflauf von 15 Personen in weiß, die ineffektive Fragen stellen, nett sind, aber nicht besonders mitdenken, was hätte man nicht alles im Einzelgespräch schneller und sinnvoller besprechen können. Eine der ältesten und überholtesten Veranstaltung der Medizingeschichte in der man, so mein Eindruck, nichts herausfindet. Performanz. Einem der Ärzte – es ist der lustige Orthopäde, der mich damals zum Gipsen gebracht hat, die Abkürzung übers Traumazentrum genommen hat, was er den coolsten Ort von allen fand und ein bisschen angegeben hat, was hier so mit dem Heli reinkommt – fallen während des Gesprächs am Bett der Nachbarin im Stehen die Augen zu.
Ich gehe mit einem Klostuhl aufs Klo und habe nicht mal mehr ein Fünkchen Humor oder Neugier in mir. Das erschreckt mich am meisten. Ich soll die Finger bewegen, sagen die Ärzte, ich bewege, aber da bewegt sich nichts zurück, die Hand geschwollen, der Ellbogen und die Schulter tun weh, wahrscheinlich vom Aufprall, vom Hämatom.
Ich finde alleine heraus, dass man im Flur Tee holen kann.
Ich weine kein einziges Mal.
Am Tag der Entlassung mache ich mir Sorgen, weil mir schwindlig ist und übel und ich nicht weiß, ob ich den Nachhauseweg schon schaffe. Als die Schwester sehr kompetent den Gips entfernt, um die Wunde zu versorgen, sage ich ihr, dass ich nicht hinschauen werde. Obwohl ich im Bett liege, würde ich bestimmt nur wieder umkippen. Sie macht eine kleine Radioberichterstattung und sagt mir, wie gut alles aussieht, ich hab sie so gern.
Ich habe keine Filter, keine Kraft. Ich bin unleidlich, wütend, verletzt, auf allen Ebenen. Dabei geben sich alle so viel Mühe.
Auch zu Hause wird es nicht besser. Als ich mich hinlege, fängt der Lärm beim Nachbarn oben an, noch so eine Belastung, der letzten Wochen, Monate, die mir entfallen war. So also, denke ich, endet das Jahr und beginnt das neue. Was, wenn die Hand nicht mehr wird, wenn das Handgelenk nicht mehr so belastbar ist wie vorher, was ist mit Sport, mit Pilates, etwas, dass ich dringend brauche, um stabil zu bleiben, um den Rücken bei Laune zu halten, was ist mit Schreiben, was ist mit meinem rechten Arm, nun doppelt belastet und sich sowieso schon in Richtung Sehnenscheidenentzündung orientierend. Was, wenn ich diesen Winter noch mal hinfalle, ausrutsche auf nassen Blättern, auf Eis. Was, wenn das nun die nächsten Jahre werden, im Grunde ja gar keine Frage mehr, mit Brüchen im Krankenhaus landen. Wie umgehen mit Bewegung, mit Mut, mit Reisen, mit Risiko. Ich habe mir nicht den Rücken gebrochen oder ein Bein, auch kein zweites Handgelenk. Ich versuche froh, darüber zu sein, über alles, was gut ist, was sehr gut ist, über die Qualität der OP, über kompetente Schwestern, Physiotherapeutinnen, Durchgangsärzte, nette Worte, über Menschen um mich herum, die bereit sind, mir zu helfen und sich große Mühe zu geben im Irrsinn einen guten Weg zu finden.
Es gelingt mir nicht, das nach oben zu ziehen. Auch das ein Scheitern. Ich mag mich nicht, mag das Misstrauen in mir nicht, den anderen und mir selbst gegenüber, gegenüber dem Sturz und seiner Bedeutung. Die Suche nach der Bedeutung.
Die distale Radiusfraktur ist der häufigste Bruch im Erwachsenenalter.
November 2024 – Bruch
Teil 1
Zu meinem Geburtstag, genau genommen dem Geburtstag meines Spitznamens und Pseudonyms, zu meinem Pseudonatalis sozusagen, beschließe ich, etwas Schönes zu machen, zusammen mit U, und endlich mal wieder ein bisschen rauszufahren, was anderes zu sehen als Berlin, um wegzukommen von der viel zu vielen Arbeit und der Jahreszeit des letzten Quartals ein bisschen Wärme und Entspannung entgegenzusetzen. Wir fahren nach Bad Saarow für eine Nacht im Hotel mit Aufenthalt in der Therme.
Im Hotel ist alles wundervoll. Ich komme sofort runter, entspanne mich, wir reden, lesen, essen. Abends machen wir den Fernseher an, für mich etwas Besonderes, seit ich keinen mehr habe. Zufällig schalten wir in den Brennpunkt ein.
Der ganze Tag schon überschattet und gedrückt vom zu erwartenden nicht ansatzweise knappen Wahlsieg Donald Trumps. Der Eindruck, am Beginn einer sich in zweiter Runde nun endgültig verwirklichenden Dystopie zu leben.
Und wir hier, ins Hotelbett gekuschelt.
Der Brennpunkt geht im Laufe der Sendung über in eine aktuelle Berichterstattung zum Bruch der Ampelkoalition. Die Regierung ist aufgelöst. Lindner hat endlich bekommen, woran er von Anfang an gearbeitet hat wie ein verzogenes Kleinkind. Mehr Milei und Musk wagen hat er kürzlich noch gesagt, und damit endgültig klar gemacht, welche Strömung er als moderner FDPler vertritt, dass der Liberale bei den Libertären angekommen ist.
Teil 2
Am nächsten Morgen ziehen wir um in die Therme. Das warme Wasser, die Sauna ist vielleicht kein direkter Trost, aber eine Erinnerung daran, dass ich und mein Körper da sind. Ich baue die Erfahrung ein in meine Zellen, auch wenn sie nur eine äußere Schicht erreicht und komme erholt und ein bisschen weniger geschunden, weniger abgelenkt von oder genauer: hingelenkter zu mir aus der Therme.
Wir kommen aus dem Gebäude, ich laufe neben U schwatzend über den Vorplatz. Das Wetter ist ein wenig klamm, es regnet nicht, aber es ist, als hingen viele feine Tröpfchen in der Luft, die der See absondert. Als ich die vier Stufen der Treppe vom Vorplatz hinunter gehe, rutsche ich mit meiner Sneakers-Sohle an der metallbeschlagenen Kante ab, falle und breche mir das Handgelenk. Ich weiß es sofort. Alles weiß ich sofort. Ich weiß, dass sich mein Leben für die nächsten Stunden, Tage, Wochen und Monate ändern wird und ich weiß auch wie.
Das Erste, was ich sage ist, Nein, ich muss doch arbeiten! Ich kämpfe, am Boden kauernd, gegen die Ohnmacht, ich vermeide, auf das gebrochene Gelenk zu sehen, ich bitte U um Wasser, um einen Krankenwagen, denn ich weiß, ich werde nicht ins Krankenhaus laufen können, zu schwarz ist mir vor Augen. Gesichter erscheinen vor mir, erschrocken, Gutes wollend, U tut mir leid.
Mein Arm fühlt sich an wie Matsch, von unten links Zeigefinger Ringfinger über den Unterarm, den Ellbogen bis zur Schulter ist, so mein Eindruck, alles kaputt.
Erst seit ein paar Wochen kommen wieder Aufträge zu mir, Projekte sind angeleiert, und in Aussicht, gute Projekte, gerade eben habe ich eine gute Chance ergattert, in ein neues Format hinein zu schreiben, was mir nach langer Flaute die Möglichkeit geben würde, vielleicht einmal im Jahr einen Batzen Geld zu verdienen, was meine Chancen erhöhen würde, endlich eine Agentur zu finden.
Das Rettungsteam ist eine sympathische kleine Gurkentruppe. Die Anführerin sagt, der steht schlecht, als sie den Bruch sieht, was nicht gerade zu meiner Entspannung beiträgt, weil ich nicht sicher bin, was sie damit meint und will mir unbedingt in ihrer adrenalingesteuerten und actionorientierten Macherart den Pulli aufschneiden, fasst meinen Arm viel zu oft an und herrscht U an, wo der Medikamentenplan sei. Mit ruppigem Schwung werde ich auf eine Liege gelegt und in den Notarztwagen geholpert. Wer eine Rückenfraktur hat, hat danach noch eine.
Der eine Sani, Mitte 40, dicker Bauch, liebes, rundes Gesicht, Jens, dem ich sein Mitleid, seine Überforderung und seine Unsicherheit ansehe, und den ich deswegen irgendwie mag, versucht, mir einen Zugang zu legen. Das gelingt nicht. Er stochert dreimal in meinen Venen herum, denn auch Anfänger haben ja manchmal Glück bzw. müssen was lernen, erst die Anführerin schafft es, die Kanüle zu platzieren. Sie injizieren mir irgendwelche Mittel, ich erzähle ihr, dass ich es nicht so mit den Opiaten habe, sie gibt mir was, was sie auch mal bekommen hat, als sie sich das Bein gebrochen hat, ich bilde mir ein, es klingt irgendwie nach Ketamin. Irgendwann bin ich eher weg, dann wieder halb da, dann ist alles sehr, sehr weiß und filmreif als die Tür zur Rettungsstelle der glücklicherweise nahe gelegenen und großen Klinik aufknallt.
Ich werde hier insgesamt 8 Stunden verbringen, die meiste Zeit wartend. Auf Ärzte, auf Behandlung, auf Bilder, auf Entscheidungen. Pfleger Leroy gibt mir ein Opiat, verspricht mir eine rosa Wolke. Wie immer nichts. Stattdessen ängstliche Nervosität und Schmerzen. Die Kochsalzlösung, die in meinen Arm fließt, führt dazu, dass ich alle halbe Stunde auf Toilette muss. Dennoch bin ich froh, sie zu haben. Sie stabilisiert mich, ich muss nicht mehr gegen die Ohnmacht kämpfen. Der Schieber, so heißt die Bettpfanne inzwischen, den Pfleger Leroy mir bringt, ist nicht für Frauen gemacht. Ich setze mich möglichst weit hoch, damit der Urin mir nicht Richtung Po und Rücken läuft.
Neben mir all die anderen Kranken. Eine ältere Dame, die unaufhörlich jammert und jeden, der vorbeikommt, um Hilfe bittet, sie habe solche Schmerzen und niemand kümmere sich. Anfangs frage ich mich, ob ich aktiv werden muss, aber dann verstehe ich, dass sie dement ist. Deshalb ignorieren sie auch alle.
Ein älterer Mann, der, wie ich später erfahre, denn ich erfahre alles!, Blut gepinkelt hat, nachdem er tagelang gar nicht pinkeln konnte und nun irgendwie durchgespült wird. Pfleger Leroy ist zufrieden mit der Klarheit des Urins im Beutel, ich auch, und auch der Urologe, der sehr viele Stunden später kommt und von Pfleger Leroy angekündigt wird als einer der wenigen Ärzte, die es hier auf der Urologie gibt und über die wir alle froh sein können, dass es sie überhaupt gibt, scheint zufrieden mit dem Verlauf.
Überall Schmerzen. Pfleger Leroy entscheidet irgendwann pragmatisch, mir einfach Paracetamol zu geben. Ich bin froh, dass ich ihn habe. Er ist eindeutig der beste Pfleger hier. Eine Schwester mit dunklen Haaren um die 50, hat etwas überraschend Brutales, Sadistisches an sich. Ich traue ihr alles zu. (Vor allem natürlich das AfD wählen.) Aber wie muss es auch sein, wenn man jeden Tag diese jammernden Menschen und fordernden Situationen um sich hat. Sie spricht übertrieben barsch mit dem Oberschenkelhalsbruch, der älteren dementen Dame neben mir. Sie fasst sie auch so an.
Die Dame hebt immer wieder mal den Vorhang zwischen uns, und schaut irgendwie lieblich darunter hervor. Sie spricht mit mir, lächelt, fragt, was ich habe, reagiert empathisch und erzählt mir klagend, dass sich niemand kümmert und sie mit niemandem sprechen konnte, nicht mit ihrem Mann, nicht mit der Schwiegertochter. Ich weiß, dass das nicht stimmt, weiß es sehr genau, denn sie hat mit allen gesprochen, ich habe alles gehört, immer wieder, jedes Wort, das sie gewechselt hat, mit dem Pfleger, der ihre Schmerzmedikation überprüft hat, der Pflegerin, dem Mann am Telefon, der Schwiegertochter, nur mit ihrer Schwester nicht, vielleicht war das, bevor sie neben mich geschoben wurde oder die Schwester lebt nicht mehr. Sie alle waren nur genervt von ihr.
Eine Ärztin steckt den Kopf zur Tür raus, ruft in den Gang, kann mir mal jemand den Papa aus dem Wartezimmer holen, die Mama kollabiert mir hier gerade. Sie behandelt ein kleines Mädchen, ich sehe es durch die Tür auf dem Untersuchungstisch, irgendwas mit Bruch oder Schnitt. Der junge Vater kommt, die Mutter wird kreidebleich aus dem Zimmer geführt, ich kann sie so gut verstehen.
Ich bin maximal erschöpft. Ich bin nicht mal müde, ich bin was anderes, ich weiß nicht was, drüber, durch, ich komme nicht zur Ruhe, weil alles zu laut und zu deutlich ist und ich keine Filter habe, überhaupt keine Filter, ich bin bei allen: dem sein Bestes gebenden junge Pfleger, der in ein paar Jahren verschlissen sein wird, dem jungen Assistenzarzt, vermutlich irgendwas mit Migration in zweiter Generation mitten im AfD-Osten, der bestimmt nicht geschlafen, seit Stunden nichts gegessen hat und hier Dinge macht, die er eigentlich noch gar nicht richtig kann und die ihm auch niemand solide beibringen wird, bei der alten demenzkranken Frau, deren Mann eine gruselige Gleichgültigkeit in der Stimme hat, dem Prostata-Mann, der aus dem Schwanz blutet und still und zurückgezogen seine Schmerzen erträgt, der jungen Mutter, die angesichts ihres leidenden Kindes fast das Bewusstsein verliert, ich komme nicht zur Ruhe, weil ich sie alle höre und verstehe und erkenne und mir das System entgegen kommt, in dem alle nur versuchen durchzukommen, ohne allzu grobe Fehler zu machen oder geduldig zu warten, bis es besser wird, bis sich jemand kümmert, vor allem aber,
weil es kein verdammtes Medikament gibt,
das es schafft, die Schmerzen, die Angst, das Mitleid, das Chaos, die Überforderung der Ärzte und Pfleger und Patienten irgendwie von mir wegzuhalten.
Nach dem Röntgen beschließt der junge Assistenzarzt, meinen Handgelenksbruch zu strecken. Dazu muss der Arm, erklärt er mir, in eine Streckapparatur. Die Finger werden bei nach oben ausgestreckter Hand einzeln in Schraubzwingen gesteckt und fixiert, der Arm hängt locker im 90-Grad-Winkel nach unten. Dann werden Gewichte auf den Oberarm gelegt. So soll das Gewebe, also Blutbahn, Nerven, Sehnen, die vom Bruch möglicherweise gequetscht worden sind, entlastet werden. Ich gehe davon aus, dass ich bei der Prozedur schreckliche Schmerzen haben werde. Der Arzt betäubt meine Hand mit ein paar Nadelstichen, und ich merke gar nichts, absolut gar nichts, alles geht sehr gut. Ich bin sehr erleichtert. Der Arzt kommt mir zurecht stolz vor.
Die nächste Haltestelle ist das CT, auf dem überprüft wird, ob die Streckung soweit erfolgreich war. Wenn nicht, muss das Handgelenk noch heute Nacht operiert werden. Wenn doch, dann muss ich mir einen OP-Termin besorgen. In Berlin. Und zwar gleich am nächsten Tag, sagt der Arzt, denn allzu lang sollte man mit der OP in diesem Fall nicht warten. Da ich nicht weiß – der Arzt verschwindet über Stunden im OP, kann also nicht aufs CT gucken – ob ich heute noch operiert werde oder eben nicht, und sich alles quälend lange hinzieht, telefoniere ich mit U., der im Wartezimmer und in Cafés herumsitzt. Er soll besser mal nach Hause fahren.
Ziemlich genau um 22:00 Uhr, nach 8 Stunden Rettungsstelle, kommt die Entwarnung. Die Streckung hat gebracht, was sie bringen soll, ich muss nicht hierbleiben und notoperiert werden, sondern ich muss raus. Ich dachte, sage ich, ich kann für eine Nacht hierbleiben. Der Arzt schüttelt den Kopf, sie sind kein Notfall mehr, und stationär würde ich auch nicht empfehlen, wir haben Corona.
Für einen Moment bin ich total überfordert, denn der letzte Zug nach Berlin ist praktisch gerade eben gefahren, beziehungsweise es gibt noch einen späteren, der eine Dreiviertelstunde Aufenthalt in Fürstenwalde hat. Auf dem Gleis in Fürstenwalde, bei Dunkelheit, Kälte, den Arm in Gips, den Medikamentencocktail noch nicht verdaut? Und wie komme ich überhaupt von hier zum Bahnhof? Vor der Klinik gibt es keine Taxis, sagt man mir.
Ich rufe U an, und bitte ihn, in dem Hotel, in dem wir waren zu fragen, ob sie noch ein Zimmer frei haben. Eins ist noch frei! Ich muss den Schlüssel allerdings aus einem Safe holen, an der Rezeption ist niemand mehr.
Ich beschließe, ins Hotel zu laufen, 27 Minuten. Richtig wohl ist mir bei dem Gedanken nicht. Ich trete vor die Klinik, beziehungsweise man schickt mich zum Hinterausgang hinaus, froh, dass wieder jemand weg ist, der einem ab sofort egal sein kann. Es ist kalt, nass und dunkel. Google Maps schickt mich in Richtung eines unwirklichen stockdunklen Weges. Ich laufe ein paar Meter, der Weg endet vor einem Gitter. Ich bin so durch, zittrig, wirke auf mich selbst verwirrt. So geht das nicht.
Ich gehe zurück in die Klinik und bitte eine Frau am Empfang, mir bei der Organisation eines Taxis zum Hotel zu helfen. Ich bekomme eine Liste mit Taxiunternehmen, telefoniere sie durch, niemand geht dran. Ich gehe zurück zum Tresen. Der Assistenzarzt isst im Hintergrund irgendein Fast Food. Mir muss jetzt mal jemand helfen, höre ich mich in Richtung der beiden Frauen am Empfang sagen. Eine erbarmt sich, greift zum Telefonhörer und ruft jemanden von der Taxi-Liste an, den sie offensichtlich kennt. Schwatzt.
Ich warte eine halbe Stunde, den Gipsarm im Schoß, im Wartezimmer. Eine Frau kommt herein, sie hat beide Handgelenke im Gips. Nein!, sage ich, unser absurder Anblick erheitert die Wartenden, auch mich und sie, wenn auch deutlich weniger, so sehr sind wir noch damit beschäftigt zu realisieren, was das jeweils für die nächsten sechs bis acht Wochen im Alltag bedeuten wird. Eine andere Wartende weist sie grob darauf hin: Da könnse sich jetzt aber nicht mal mehr alleine den Arsch abwischen.
Ich suche das Weite und setze mich in den Gang auf einen der Stühle.
Der Taxifahrer kommt zur Tür herein. In seinem Gesicht prangt – ungelogen – ein Hitlerbart.
Er fährt mich freundlich, die Anfahrt aus Fürstenwalde auf den Fahrpreis dazu addierend, ins Hotel und spricht irgendwann von Adolfs Zeiten in Bezug auf irgendein Gebäude, an dem wir vorbeifahren. Alles klar.
Ich bekomme den Safe mit dem Schlüssel nicht auf. Der Code funktioniert nicht. Mein Herz klopft, mein Arm pocht. Ich unterdrücke meine Panik, niemand ist mehr auf der Straße, ich bin hier mitten in einem Wohngebiet, ich laufe zurück auf den Parkplatz. Dort stehen glücklicherweise zwei Personen. Glücklicherweise ist es jemand vom Hotel und weiß den Code.
Den Schlüssel in der Hand, steige ich die zwei Treppen hoch bis zu meinem kleinen Zimmer. Ich lege mich und den Arm irgendwie und so wie ich bin ins Bett, stehe nochmal auf und hole alles an Decken, Handtüchern, was ich finde und lege sie auf mich drauf und um mich herum. Ich zittere. Ich habe zuletzt heute morgen was gegessen, fällt mir auf.
Teil 3
Am nächsten Morgen stehe ich um 5 auf und fahre von Bad Saarow aus direkt die ganze Strecke durch bis in die Unfallklinik Berlin Marzahn, um mir einen OP-Termin zu besorgen. Mit meinem Gipsarm links und einer Riesenplastiktüte mit dem Aufdruck Rettungsstelle rechts, betrete ich die Rettungsstelle.
Bei der Anmeldung schildere ich die Situation und dass man mir gesagt habe, ich solle mich umgehend um einen OP-Termin kümmern. Die Frau an der Rezeption lässt sich den Zettel geben, den man mir in Bad Saarow mitgegeben hat. Genau genommen den Befund. Dann fragt sie nach den Bildern. Die habe ich nicht bekommen, sage ich. Wir brauchen die Bilder, sagt sie. Ja, sage ich, klar, könnten Sie da nicht anrufen, damit die die schicken? Das geht nicht, sagt sie, Sie müssen da anrufen. Okay, sage ich. Und wohin sollen die die dann schicken? Gibt es eine Mail-Adresse? Nein, sagt sie, die müssen das mit einem Kurier schicken. Manche schicken einen QR-Code. … Okay, sage ich, ich ruf dort an.
Ich gehe zurück ins Wartezimmer und rufe in der Rettungsstelle Bad Saarow an. Man gibt mir die Nummer der Radiologie. Dort geht niemand dran. Ich rufe, unruhig im Wartezimmer auf und ab laufend 20mal dort an. Die Nummer muss falsch sein, oder liegt es an der schlechten Verbindung hier und ich komme einfach nicht durch?
Irgendwann werde ich zu einem Bett geleitet. Um mich herum Vorhänge, die beiseite oder wieder zugezogen werden, schon wieder jede Menge Geschichten, Prozeduren links und rechts, diesmal eine schwerhörige demente alte Frau, die nicht versteht, was los ist, die Pflegerinnen haben es schwer, sie umzuziehen, ein alter Mann von dem ich mir nicht sicher bin, ob er noch lebt, so weg ist er.
Abrupt wird mein Vorhang zur Seite geschoben, eine Ärztin steht vor mir und meinem Arm. Wo sind die Bilder? fragt sie ohne weitere Einleitung, ohne Bilder kann ich Ihnen keinen OP-Termin geben. Ich frage, ob sie mich nicht zumindest schon mal ins System aufnehmen könnte für einen OP-Termin, Sie habe doch den Befund, und dann vielleicht in Bad Saarow anrufen könnte bei ihrem Kollegen (oder in der Radiologie, die Nummer hab ich rausgefunden, sage ich)
– um ihn zu bitten, die Bilder zu schicken. Ja, wie denn, pfeift sie mich an, mit der Pferdekutsche?
Ich bin erschöpft. Ich bin erstaunt darüber, wie erschöpft ich bin. Ich bin nicht mehr zupackend, pragmatisch, nach vorne gehend, geduldig, wie ich in solchen Situationen sein kann, wie ich mich in solchen Situationen schon erlebt habe. Ich habe plötzlich wahnsinnig schlechte Laune. Inzwischen bin ich auch hier schon seit 5 Stunden. Ich will einfach nur, dass es vorbei ist, dass es nicht passiert ist. Aber es geht weiter und es ist passiert.
Ich dachte, digital, sage ich.
Manche schicken uns einen QR-Code, sagt sie. (Es geht also digital – verkneife ich mir zu sagen). Aber mit Bad Saarow haben wir keine Kooperation. So ist das, sie ist bei Konzern A angestellt und der Kollege bei Konzern B und weil die Konzerne nicht kooperieren, kann ein Arzt nicht den anderen anrufen.
Ich wundere mich nur, sage ich, dass ich jetzt die Krankenhausorganisation übernehmen muss, soll ich mich jetzt um die Bilder kümmern? frage ich die Ärztin.
Ja klar, sagt sie. Es ist doch ihr Arm.
Dieser Satz bleibt mir hängen. Wow, denke ich, Maggie Thatcher. Wie ein Ballon schwebt Maggies Kopf mit Frisur plötzlich zwischen mir und der Ärztin. Aber vielleicht sind das auch die Medikamente.
Ich meine, wirklich, ist es mein Arm?
In den letzten Stunden war mein Arm nicht mein Arm. Er hat dem System gehört, das mit dem Arm gemacht hat, was es will, soll und muss. Es hat ihn nach vorgeschriebenen Algorithmen bearbeitet. Vom eingehenden Notruf, über den Rettungswagen, in der Klinik, bei der Abrechnung, die im Hintergrund angelaufen ist, hat der Arm im System Prozesse ausgelöst. Der Arm ist in die Statistik eingegangen, hat seine Daten hinterlegt, ist Teil von Gesundheitspolitik, Versicherung, medizinischer Ausbildung, Bettenbelegung, Krankenhausabläufen und Personalhierarchien geworden, und jetzt, wo ein Fehler aufgetreten ist, ein Glitch in der Matrix, weil sich eine Lücke im System aufgetan hat, die das System produziert hat, weil es ein kapitalistisches ist,
jetzt also, wo der Arm dem System nicht in den Kram passt,
ist es plötzlich mein Arm.
Dabei mache ich doch mit dem Arm eben in diesem Moment, in dem ich vor ihr stehe, den fürs Elitekrankenhaus Marzahn offenbar zu läppischen Befund aus Bad Saarow (distale Radiusfraktur, Punkt) in der Hand, genau das:
Ich kümmere mich, wie geheißen und unter Aufwendung all meiner Kräfte, darum, meinem Arm einen zeitnahen OP-Termin zu organisieren,
was von ihr aber gerade aktiv verhindert wird!
Warum nur, so ärgere ich mich über mich selbst, habe ich nicht besser mitgedacht, und dem scheiß Assistenzarzt – der im Übrigen auch an die Medikamente nicht gedacht hat, die hab ich mir Maggie-Thatcher-Style am Ende noch schnell selbst beim Pfleger besorgt – gesagt, er soll mir die Bilder mitgeben! Ich weiß doch, wies läuft! Aber was soll ich denn noch alles machen, an was soll ich denn noch alles denken? Und was machen eigentlich Menschen, die ohne deutsche Sprachkenntnisse oder mit Demenzerkrankung in der gleichen Situation sind?
Sie erbarmt sich, warum weiß ich nicht, vielleicht Angst vor schlechten Bewertungen im Internet, und führt mich zu einer Art Annahmestelle, wo ich nun, wie mir scheint problemlos, einen Termin zum Vorgespräch (!) für eine OP bekomme. Doch bis dahin müssen die Bilder da sein, schärft sie mir ein und sagt:
Da fahren sie einfach morgen nochmal hin und holen die. Bad Saarow ist doch ein hübsches Städtchen.
November 2024 – Ideenhaberei
Tagsüber:
Vielleicht kannst du da mal eine Idee skizzieren, nur kurz, auf so 1,2 Seiten.
Falls dir da was einfällt, sag Bescheid.
Wir brauchen Ideen für jüngere Leute. Ja, für die CC2.
Für den Sonntagabend ist das keine gute Idee.
Super Idee! Wir bleiben bei der ersten.
Sendet eure Ideen ein, die beste wird mit 3000 Euro prämiert.
Also wenn du da ne Idee hast, die anderen überlegen auch mal.
Guck mal, das hat die KI ausgespuckt, vielleicht hilft das ja bei der Ideenfindung.
Die Idee finde ich an sich gut.
Sehr schöne Idee. Vielleicht hat ja noch jemand eine bessere.
Abends:
Hast du ne Idee, wo wir heute Abend hingehen könnten.
Ich bräuchte ne Idee für ein Restaurant, ich bekomm Besuch.
In welchen Film könnten wir gehen, hast du ne Idee?
Wo sollen wir uns treffen, du hast doch immer so gute Ideen.
Oktober 2024 – sitzt
Café in Mitte.
Ich bestelle einen Cappuccino am Tresen. Als ich ihn an der Ausgabestelle abhole, frage ich, ob ich ein bisschen Zucker haben kann. Die Barista schaut mich an und sagt:
We don’t work with sugar.
Oktober 2024 – Manchmal
Manchmal, wenn ich mich sehr außen vor fühle, denke ich an Herrn M.
Ich erinnere mich an das, was er gesagt hat, als ich ihm die Situation im Schwimmbad geschildert habe. Alle gehen jauchzend ins Wellenbad und ich stehe am Rand. Ich bin ein Geist in dieser Welt, unfähig, an ihr teilzuhaben und mir ihre Regeln zu eigen zu machen. Aber sie waren doch dabei, hat Herr M. gesagt. Sie haben es beobachtet. Und sie erzählen mir so davon, dass ich das Gefühl habe, dabei gewesen zu sein.
Das ist meine Position, die Position des Beobachters. Und die, hat Herr M. gesagt, ist doch okay.
Manchmal hilft das.
Oktober 2024 – die Weltlage
Ich unterhalte mich mit J. über die Weltlage.
Ich weiß nicht, sagt er irgendwann, muss das jetzt sein, dass ich in meinem Leben noch einen Krieg erlebe?
Oktober 2024 – der schmale Grat
Ein Kind überrollt mich von rechts aus einer schmalen Einfahrt kommend mit seinem Buggy, SUV-Style. So heftig, dass mir die Hand noch den ganzen Tag weh tut. Ich schreie es unwillkürlich an: Pass doch auf, Mann! und schaue mich suchend um bei den Umstehenden. Wem gehört dieses Kind, frage ich. Eine Frau, die sich nicht gerührt hat, kommt jetzt mit einem halben Schritt auf mich zu. Entschuldigung, sagt sie leise.
Wow. Der Grat zwischen: Ich will, dass mein Kind eine freier Mensch wird und ich will, dass mein Kind ein rücksichtsloses Arschloch wird, ist verdammt schmal, lady. Speak up, sonst frisst es dich eines Nachts.
Oktober 2024 – The world is my oyster
Ich bewerbe mich auf Stellenanzeigen für Aushilfsjobs bei Dussmann, Zeit für Brot, Butter Lindner, Thalia.
Ich bekomme nur Absagen.
Oktober 2024 – Blümchen in der Vase, saß und schlief
Filterkaffee in der Bäckerei ums Eck. Auf dem Tisch ein hübsches Blümchen in einer kleinen Glasvase. Eine puschelig rosa gefüllte Chrysantheme steht im Wasser, dazu passend ein Zweig mit kleinen grünen Blättern. Mich macht das ganz zufrieden.
Irgendwann, es dauert eine ganze Weile, kapiere ich: nichts ist hier echt! Die dichten rosa Blütenblätter wie Papier, der grüne Zweig aus Plastik, die Vase aus Plexiglas, sogar das Wasser darin ist fake: Die Drittelfüllung, in der die Stiele versinken, ist eine gallertartige transparente Masse mit dekorativem Blaseneinschluss. Einmal mehr fühle ich mich: naiv.
September 2024 – schön wärs
Wenn man den Rassismus aus Texten killt, killt man nicht den Rassismus, sondern die Chance über Rassismus in Geschichte und Kultur reflektieren zu können. Im schlimmsten Fall verleugnet man ihn, tut so, als habe es ihn nie gegeben. Macht ihn unsichtbar, ungeschehen. Rassismus ist nicht nur ein Wort. Rassismus steckt zwischen Zeilen, ereignet sich vor Hintergründen, wird bewusst aufgerufen, um von ihm zu erzählen, liest sich in Kontexten von Figuren und Konstellationen.
Will sagen. Einfach is nich.
September 2024 – Meno-Baby
Schon wieder ein Baby-Traum. Was will mir mein mittelalter menopausaler Körper damit sagen. Denn der ist es, der hier spricht, mein Hormonkörper, mein Torschlusskörper. Ich habs geahnt, ich habs vorhergesagt, ein paar Jahre ist das schon her: der Gedanke an ein Kind kommt dann nochmal, wenn man aus dem Gröbsten raus ist. Wenn der Körper sowieso unattraktiv geworden, Sex nicht mehr gar so wichtig ist, bzw. aus Mangel an Gelegenheit einfach nicht stattfindet, man viel von dem gemacht hat, was man machen wollte, und das, was übrig ist, auf der Liste, sich vielleicht gar nicht mehr so brennend anfühlt, und man sich mental vielleicht zum ersten Mal im Leben soweit aufgestellt fühlt, dass man denkt, jetzt würde ich fertig werden mit so einem Kind. Jetzt könnte ich mir vorstellen, all die bindenden Aufgaben, die es mit sich bringt, zu bewerkstelligen. Bei gleichzeitigem Wissen darum, dass der Körper keines mehr bekommen kann. Er längst darüber hinaus ist, Schlaflosigkeit, Lärm, emotionalen Stress und hohe körperliche Anstrengung auszuhalten. Und der Gedanke, den die Träume wie auf einer Welle tragen, ist nicht das gleiche wie ein Wunsch.
September 2024 – Wasserbetriebe
Auf der Toilette vom Galeria Kaufhof. Eine Frau beobachtet, dass ich meine Wasserflasche auffülle. Trinken Sie das? fragt sie. Ich: Klar, warum nich? Sie: Das Berliner Wasser ist voller Medikamentenrückstände! Ich: Das Berliner Wasser ist hervorragend. Sie: Nein, ist es nicht, ich weiß es, ich arbeite da! Ich, natürlich nur in meinem Kopf: Als was? An der Kasse?
September 2024 – Buchtitel
Ab hier wirds langweilig … sage ich irgendwo auf einer Strecke im Auto.
U: Wär auch ein guter Buchtitel.
September 2024 – Die Angst der Autorin vorm Feminismus
Eine junge Kollegin, Anfang dreißig, Theaterautorin, berichtet von nächtlichen Alpträumen und ihrer Angst, nicht feministisch genug zu sein und demnächst gecancelt zu werden.
August 2024 – Dessau im August – Verlauf
Ich erkunde die Stadt, meist allein. Die anderen sind oft nicht da. Ich laufe, ich fahre mit dem Rad. Ich fahre durch Parks, über alte Brücken, am Wasser entlang. Ich arbeite alle Museen ab, alle Plätze, alles was es zu besichtigen und zu entdecken gibt. Bibliotheken, Führungen, Rathausfeste, Sportveranstaltungen, Märkte. Ich lasse nichts aus, nichts unversucht.
Ich registriere den Leerstand – Foto, Standort – den ich insgesamt nicht so schlimm finde wie befürchtet. Die Wochenenden und Abende sind nicht leicht. Wann waren sie das je, wenn ich allein war. Ich habe zu tun, schreibe ein Hörspiel im Co-Working-Space. Beim Projekt muss viel organisiert, es müssen viele Leute getroffen werden, Kontakte zu Initiativen gesucht, eigene Initiativen ins Leben gerufen werden. Ich staune und bin sehr froh, wie gut ich in der Gruppe klarkomme. Ich klappere die Cafés ab und fange sehr schnell wieder von vorne an. Ich staune, wie teuer essen gehen hier ist, ich stöhne unter den Preisen. Wie können die Leute sich das leisten? Die Restaurants sind voll. Ich dachte, die sind hier alle arm und arbeitslos. Die Radwege sind super ausgebaut. Die Tramlinien fahren in hohem Takt, es gibt ein sinnvoll-pragmatisches Nachtfahrsystem mit Großraumautos. Nur auf Google Maps zu finden ist der ÖPNV nicht. Ähnlich wie bei den nicht vorhandenen Schildern am Bahnhof hat man den Eindruck, die Leute denken, wir wissen ja eh, wo was ist bzw. was wann fährt. An die von außen denkt man nicht. Aber das ist ja vielleicht überall so.
Am Ende bin ich froh über die Erfahrung. Froh über meinen Mut. Wie so oft bei diesen Flöhen, die ich habe, den Abenteuern, die ich eingehe, den kleinen und größeren Challenges, die ich annehme, und ziehe ich weiter. Es bleibt nichts. Andere aus der Gruppe finden über die vier Wochen Jobs, Perspektiven, Freunde, Wohnungen, es baut sich was auf, es entsteht und verändert sich etwas. Ich habe mich wie meistens mit der Position der teilnehmenden Beobachterin auf Zeit identifiziert.
Meine Idee, Leute zu interviewen, einfach so, auf der Straße, ich habe extra ein Aufnahmegerät dafür mitgenommen, habe ich nicht realisiert. Zu scheu, zu schüchtern. Nicht in der Lage, mich dazu mit jemandem aus der Gruppe zu verbünden, was vielleicht geholfen hätte.
H. wird in meinem Leben bleiben, so hoffe ich, und dass ich mir genug Mühe geben werde, dass es so kommt. Eine neue, wenn auch lose Freundin, das ist viel.
Als U kommt, um mich nach den vier Wochen mit Sack und Pack abzuholen, er war drei Wochen an der Atlantikküste, ist er mir zunächst fremd. Das war ja klar.
Zurück in Berlin bin ich froh zu erleben, dass sich – anders als in der Kleinstadt, wie ich jetzt erst begreife – in meinem Inneren keine Langeweile oder Dumpfheit ausbreitet.
Ich gehe essen, klappere alle Cafés ab.
Ich
bin in dieser Stadt
trotz meines häufigen Leidens an ihr
viel
möglicher.
August 2024 – Dessau im August – Notes
Der winzig kleine Strand an der Mulde. Urbanes Feeling, so mit der Stadtkulisse im Hintergrund, bisschen abhängen, bisschen kiffen und trinken. Einmal nackig rein in die Mulde. Die Dessauer leben ihre Flüsse nicht. Elbe und Mulde, so viel herrliches Wasser mitten in der Stadt und keine richtigen Zugänge, Strände, Badestellen. Keine Boote.
Später erzählt mir jemand, dass die Flüsse bei der Bevölkerung noch immer mit von der Industrie eingeleiteter Chemie assoziiert sind, man früher manchmal nur Schaum darauf gesehen hat und der Gestank durch die Stadt gezogen ist. Heute gelten Mulde und Elbe als sauber. Aber kann man der Sache trauen?
—
Sehr viele sehr patente Frauen machen hier sehr patente Arbeit. Im Café, bei der Stadt, im sozialen Bereich, wahnsinn, was die rocken. Die können quatschen, denken, organisieren bis zum Burnout und sind dabei herzlich, ruppig – und manchmal zu dominant.
Sie arbeiten sich alle ab, an der Bürokratie, die alles ausbremst, aussitzt, was an Energie aus der Stadtgesellschaft kommt, an den Netzwerken, denen sie eigene entgegen zu setzen versuchen, an den Verteilungskämpfen, in die sie sich werfen, am System, das sie verschleißt, an den grundsätzlichen Motzereien, die hartnäckig bleiben, egal was man alles auf die Beine stellt und obwohl hier so viel Tolles passiert,
Immer wieder staune ich, was es hier alles gibt, wer hier alles lebt und sich wie einbringt. Immer wieder werde ich mit den eigenen Vorannahmen konfrontiert, die sich als falsch erweisen.
—
Natürlich liegt es an meiner aktuellen Perspektive auf die Stadt, am Framing meines kuratierten Aufenthalts, aber ich habe noch nie so nah mitbekommen, wie eine Stadt und ihre Menschen sich in einer Demokratie organisieren.
—
Im Hausflur begegnet mir eine Frau, Moment, sagt sie, und stutzt irritiert, geht’s jetzt hier durch oder wie? fragt sie. Ich frage zurück, wo sie hinwill, denn es ist hier wirklich etwas labyrinthisch, mit einem Zwischengang und einem Fahrradraum, dessen Tür man für einen weiteren Eingang zum Treppenhaus halten kann.
Sie entschuldigt sich, erzählt mir, dass sie eine Rücken OP hatte, sie immer noch ein bisschen verwirrt ist, wie schlimm die Schmerzen waren vorher, wie unerträglich, dass es nun, so langsam, besser wird. Ich erwähne kurz, dass ich das kenne, mit dem Rücken und den Schmerzen. Sie fragt mich, ob ich jetzt hier wohne? Ich erzähle, dass ich nur vier Wochen da bin und berichte kurz vom Projekt – Stadtentwicklung, Gruppe Freiwilliger, möglicherweise um zu bleiben. Sie nickt, irgendwie erfreut, wie alle, die hören, dass man sich für Dessau interessiert, gleichzeitig etwas verständnislos und distanziert. Warum genau finde ich nie heraus. Ist es: Hier ist doch eh nichts mehr zu retten oder Hier ist doch alles okay oder Wer seid ihr, dass ihr, wahrscheinlich Großstadt-Wessis, von außen die Stadt verbessern wollt (der Kolonialismus-Vorwurf, den ich von Freunden höre und selbst problematisch finde) oder Tss, da seid ihr nicht die ersten? Wie sich herausstellt wohnt sie direkt über mir, mit ihrem Mann. Wieder orientiert stapft sie die Treppe hoch.
—
„Schmecken lassen!“ sagt der Mann am Wurststand als er mir die Wurst rüber reicht. Das ist nett, ich weiß.
Diese Promptheit oder Ruppigkeit in der Sprache, was ist das, herzliches Militär.
—
Auf dem Flohmarkt eine Tupperbox. Darauf ein Indianer.
—
Ein mittelaltes Ehepaar, das über drei Radfahrer motzt. Die fahren nicht auf dem Radweg, sondern auf der elend breiten Straße an ihnen vorbei.
Ach, herrlich, Kleinstadt, deine Probleme.
—
Im Kartoffelhaus
Ein Mann isst seine Folienkartoffel
mit einer Umsicht für das Aufschieben der Alufolie und einer Hingabe an das Ablösen des dampfenden Kartoffelinneren von ihrer groben Schale
als habe er sich die ganze Woche darauf gefreut.
—
Eine aufgedrehte Gruppe von Kids, vielleicht so zwölf, dreizehn? Neiiin, kräht einer der Jungs, die sind aus Japan! Wer gemeint ist, ist unklar, eine Band vielleicht, irgendwelche Leute, die sie gesehen haben? Ching chang chong macht er, um die Sache zu veranschaulichen, tänzelt mit erhobenen Armen herum und zieht sich die Augen zu Schlitzen.
—
Zwei aus der Gruppe berichten, dass sie mit ihrem Baby in der Kinderklinik waren. Die Ärztin habe, um sie zu beruhigen, von ihrem eigenen Kind berichtet. Das sah auch einmal, als es schweren Durchfall hatte, aus wie ein Buchenwaldmaskottchen
Ich schaffe es beinahe nicht, das hier aufzuschreiben.
August 2024 – Dessau im August – WG
Wie lange habe ich nicht in einer WG gewohnt. Wie schwer es mir gleich wieder fällt, die Übergänge hinzubekommen. Zusammen sein, auseinander gehen, in den Kontakt gehen, soziales Leben (Nähe, Kennenlernen) vs Rückzug, allein sein. Das Warten, Hoffen, Fantasieren ist sofort wieder da. Beim anderen sein, nicht bei mir. Sehnsucht empfinden, Enttäuschung Traurigkeit, Einsamkeit, Melancholie, Anflüge von Depression mit denen es umzugehen gilt. Wie sehr ich gleich wieder leide.
Ich fahre nach der Arbeit noch ein bisschen rum. Das Wetter ist schön. Vielleicht ist sie ja da, wenn ich nach Hause fahre. Dann könnten wir auf dem Balkon abhängen. Vielleicht kauf ich auf dem Nachhauseweg was ein dafür? Einen Wein vielleicht. Eigentlich könnte ich auch einen Salat machen. Oder gleich ne Pasta? Aber wenn sie schon gegessen hat. Wenn sie ihre Ruhe habe will.
Ich komme nach Hause, habe Wein, Pasta, Salat besorgt, schadet ja nichts, kann man ja auch noch morgen. Ich stecke den Schlüssel ins Schloss, muss zweimal drehen und weiß, sie ist nicht da. Ich räume die Sachen in die Schränke, gehe in mein Zimmer. Vielleicht kommt sie ja gleich. Oder später. Ich mach irgendwas, aber ich bin unruhig. Ich bin bei ihr, vielleicht hat sie sich verabredet, vielleicht fährt sie Rad, das macht sie gerne, ich bin in der sozialen Fantasie, beim Kochen, Sprechen, auf dem Balkon, ich bin nicht hier, bei mir, ich kämpfe dagegen an, gegen das Abhängigkeitsgefühl an, gegen die needyness, nichts hasse ich mehr, was macht sie mit mir, das lass ich mir nicht gefallen. Ich gehe selber wieder raus. Denn ich bin stark und unabhängig. Dabei bin ich müde, ruhebedürftig. Doch jetzt ist es ein Wettbewerb. Wer kommt später nach Hause. Wer hat mehr zu erzählen, wer hat mehr Kontakt mit Menschen gehabt.
Sie ist so autark, so bei sich (Überhöhung) Wahrscheinlich mag ich sie deswegen. Sie entzieht sich wie sie will, sie lässt sich nicht einfangen, lässt sich nicht täuschen von meinen Manövern.
Auf solche Typen steh ich. Die müssen so sein, damit ich mich nicht komplett verliere. (Verschmelzungsfantasie). Seltsam wie viel man weiß (Therapie) ohne etwas zu wissen.
August 2024 – Dessau im August – Aufstand
Die Montagsdemo. Leute denen man es ansieht, Leute, denen man es ganz und gar nicht ansieht, so etwa 20 bis 30. Jede Woche. Oben ist jetzt unten links ist jetzt rechts alles mäandert verkehrt herum durcheinander alle Kategorien sind aufgehoben, bedeuten nicht mehr was sie bedeutet haben sondern etwas anderes oder gar das Gegenteil. (Freiheit, Frieden)
Man hat sich in der DDR schon gegen den Staat gewehrt (oder waren das womöglich andere und man traut sich nur jetzt auf die Straße, wo man von nichts und niemand was zu befürchten hat?), also lässt man sich auch von diesem Staat nix sagen.
Freiheit! Klingt irgendwie immer wie: Prost. Aufrechte (anständige, siehe oben) Menschen versammeln sich hier. Die wachsamen, rebellischen, die, die schon einmal die Revolution gemacht haben (really?), die, die sich nichts bieten lassen, nichts sagen lassen, schon gar nicht von einer Ideologie, die sie enteignet und entrechtet hat. Wir im Osten. Hier bei uns. Ihr könnt ja machen, was ihr wollt, aber. Mit uns hat das nichts zu tun. Die Bastion wird verteidigt, das Leid weitervererbt, kultiviert und genährt.
August 2024 – Dessau im August – Anstand
Auf der Terrasse eines Cafés in der Innenstadt. Am Nachbartisch sitzt ein Mann mit zwei anderen Leuten, Mann und Frau, und spricht laut und in einem schärfer werdenden Empörungston als ich die Terrasse betrete. Er spricht so wie Leute sprechen, die unbedingt wollen, dass sich jemand an den anderen Tischen provoziert fühlt, dass jemand aufschaut, von seinem Laptop, den er gerade erst aufgeklappt hat, und widerspricht. Ich zum Beispiel.
Der Mann, dem das Café gehört – und der eine ältere, asiatisch aussehende Bedienung hat, die regungslos ihrer Arbeit nachgeht, und mich fragt, was ich möchte, ich kenne sie schon – war offenbar gerade schon mit den dreien im Gespräch. Er fragt ihn: Woher kommen Sie denn. Ausm Osten! schnaubt der Mann. Wir ham noch Anstand gelernt! Er haut auf den Tisch.
Der Anstand wählt nur eine Woche später zu 32 Prozent die AfD
August 2024 – Dessau im August – Zyklon B
Auf der langen Autobrücke, die neben der Zuckerfabrik über eine breite Schienentrasse führt, gibt es einen Mahnort. Ich werde darauf aufmerksam, weil ich zwischen den ganzen touristischen Flyern rund ums Bauhaus, die Wörlitzer Gärten und das Junkers Technikmuseum in der Touristeninformation einen finde, der von der Machart her ein wenig amateurhafter wirkt.
Die Geschichte geht so: In flüssiger Form wurde Zyklon ursprünglich als Schädlingsbekämpfungsmittel verwendet. Mit dem später entwickelten Blausäuregas Zyklon B, das in nur geringen Dosen zur Lähmung der Atmung führt, wurden in den Konzentrationslagern von 1941 bis 1945 eine Million Menschen fabrikmäßig ermordet. Die Dessauer Werke für Zucker und Chemische Industrie waren Hauptproduktionsort von Zyklon B, von hier wurde es via Schiene in die Vernichtungslager transportiert.
1996 (zu meiner Überraschung nicht zu DDR-Zeiten, sondern erst nach der Wende, in einer Zeit von Pogromen und wachsendem Rechtsradikalismus, wieso denke ich immer, die DDR war so aufgeklärt mit dem NS, ist das alles falsch …?) hat sich eine Gruppe von Dessauerinnen und Dessauern zusammengetan, um sich mit dem Thema zu beschäftigen.
Ihre historische Forschung haben sie 1999 dem Stadtrat vorgestellt und 2000 ein Projekt für einen Informations- und Mahnort vorgeschlagen. Viele Ausschussmitglieder haben das Projekt abgelehnt, so ist es im Flyer zu lesen, woraufhin sich andere Unterstützergruppen und Einzelpersonen aus der Zivilgesellschaft hinter das Projekt gestellt haben.
Im Rahmen eines Design-Wettbewerbs wurden Vorschläge zur Umsetzung erarbeitet und der jetzt installierte ausgewählt. Nach weiteren vier Jahren Finanzierungssuche wurde das Projekt 2007 vor allem mit Spendengeldern realisiert.
Soweit der Flyer. Aus dem man gerade mal erahnen kann, welche Diskussionen in den 11 Jahren bis zur Realisierung von einer kleinen Gruppe engagierter Menschen ausgehalten, aufgefangen und durchgehalten werden musste. Auf offene Ohren und Unterstützung seitens der Stadt scheinen sie jedenfalls nicht gestoßen zu sein.
Ich fahre auf die Brücke, um mir den Mahnort anzuschauen. Die Brücke ist lang, steil und von Autos dominiert. Ab und an radelt mal jemand auf dem Radweg vorbei.
Ich finde keinen Hinweis auf den Ort, suche mal wieder nach Schildern, schaue nach unten Richtung Schienen, dann auf das alte Gebäude, die Zuckerfabrik – da vielleicht? Dann verstehe ich, dass ich erstens auf der falschen Seite der Brücke bin. Und zweitens, dass das Mahnmal in das Geländer der Brücke eingearbeitet ist.
Mehrere Tuben aus Metall, etwa 40 Zentimeter lang, sind auf den Holm des Metallgeländers aufgezogen, so dass sie drehbar sind. Darin eingraviert sind Informationen zur Geschichte von Zyklon B. Um sie zu lesen, müssen die Tuben gedreht werden. Als ich den ersten Tubus drehe, höre ich ein Geräusch, ein leises, Rauschen, das das Lesen begleitet. Es klingt wie Sand, der sich im Innenraum des Tubus mit dreht. Zyklon B wurde als körnerförmiges Material in Dosen verpackt.
Selten habe ich so ein fein durchdachtes Konzept gesehen.
Ich rege mich sofort darüber auf, wie ignorant man damit in dieser Stadt umgeht. Kein Hinweis, keine Erwähnung, damit auch ja niemand was davon mitbekommt und nur die völlig Verrückten auf die Brücke fahren und aktiv danach suchen, nur weil ein paar engagierte Menschen bereit sind, sich seit Jahrzehnten an der institutionalisierten Ablehnung abzuarbeiten und wahrscheinlich auch noch auf eigene Kosten Flyer drucken und in der Touri-Info vorbeibringen. Ich hab sofort den Impuls denen zu schreiben und mich zu bedanken.
August 2024 – Dessau im August – Tierwelt
In meiner EG-Wohnung stinkts nach Abfluss. Besonders wenn ich dusche scheint das Wasser sich eine direkte Verbindung in die Kanalisation zu bahnen, das Tor zur Hölle und zurück zu öffnen.
Ich fühle mich nicht wohl. Ich putze. Es gibt unfassbar viele Spinnen in Dessau. Warum? Sie hängen in meiner Wohnung rum und ich versuche, sie zu ignorieren, aber das geht nicht immer. Eine sitzt direkt über mir, wenn sie sich geradeaus runterlässt, landet sie direkt auf meinem Gesicht.
Ich verschiebe das Bett.
Irgendwann sehe ich eine sehr hübsch geformte kleine Fliege am Rand der Spüle sitzen, die Flügel in einem zarten Grau, das Körperchen schwarz. Ich frage bei Google Lens nach, wer sie ist. Eine Schmetterlingsfliege. Ihr natürliches Habitat ist der Abfluss. Dort legt sie ihre Eier. Nach weiteren Recherchen schütte ich einen Liter Essig in den Abfluss. Das bringt kurz Befriedigung, aber kein durchschlagendes Ergebnis.
Für die beiden letzten Wochen ziehe ich zu H., die wohnt im fünften Stock. Da gibt’s keine Schmetterlingsfliegen, aber erstaunlicherweise immer noch haufenweise Spinnen. Aber H. macht die Spinnen für uns weg.
August 2024 – Dessau im August – Park Life
Ein älterer Mann, obdachlos, hager, noch ganz manierlich zurecht. Ich assoziiere Rumänien vom Aussehen her, aber was weiß man schon. Er trägt seine Sachen in einem alten Koffer mit sich herum. Das macht ihn zu einem Filmstar. Auch das abgerissene Sakko, die Anzughose, die lange getragene Lederschuhe.
Er dreht seine Runden, schaut in Mülleimer, hat dabei etwas Ruhiges, Vorsichtiges. Er ist auf der Hut, hält sich im Hintergrund, ist beinahe unsichtbar.
—
Eine Gruppe ukrainischer Frauen trifft sich regelmäßig auf den Sitzmöbeln. Sie reden laut und viel. Ich verstehe nur Putin.
—
Drei im Boden verankerte Tisch-Stuhl-Kombinationen, sie gehören den black guys. Refugees, I suppose. Sie hängen hier ab, spielen, hören Musik, quatschen. Ab und zu mal wird es laut, es gibt Streit, man macht sich Sorgen, dann ebbt es wieder ab. In welchen Sprachen sie sprechen, wer woher kommt, inwiefern das eine Rolle spielt, von außen ist es nicht zu verstehen. die Polizei fährt regelmäßig durch, Präsenz zeigen, aber alles wirkt friedlich, Co-Existenzen im Park.
—
Hinter dem Bauhausmuseum an den Cafétischen, hier bleibt man recht unbehelligt. Ein älterer Mann, einer dieser Spazierradler, parkt sein Discounter-Rad, setzt sich, guckt immer, will mit mir ins Gespräch kommen. Ich lege schließlich mein Buch weg und lasse es zu.
Seine Frau ist gestorben, 2021, er hat dort drüben gewohnt, in einem der Y-Häuser, im 13. Stock. Die Hochhaus-Platten in Y-Form sind, genau wie die längste Platte Deutschlands, die auch hier in der Dessauer Innenstadt steht, berühmt und quasi ikonisch für Dessau. Jetzt wohnt er woanders, im Parterre.
Er zeigt mir Fotos, von seiner Küche, von seinem Enkelsohn, Noah, der Lehrer werden will. Alles zu intim, aber was solls.
Er erzählt, dass er wie sein Vater Schlosser war, und beim VEB Waggonbau gelernt und gearbeitet hat. Dessaus Hauptarbeitgeber. Der nach der Wende die üblichen Verkaufs- und Abwicklungsphasen bis zur Schließung mitgemacht hat. Er wiederholt sich, hört nicht zu, fragt nichts. Nach einer Weile verstehe ich, dass er Anzeichen von Demenz hat.
Ich werde ihn in den nächsten Wochen beinahe jeden Tag mit dem Rad herumgurken und immer mal irgendjemand vollquatschen sehen. Kein ganz schlechtes Leben.
August 2024 – Dessau im August – Im Café
Filterkaffee bei Bäckerei Lantzsch in der Mini-Mall – Cafe Lily hat heute wohlverdienten Ruhetag. Ich schreibe eine Mail an H., weil ich in Dessau wegen Chemnitz an ihn denken muss. H. kommt aus Chemnitz und wir haben mal gemeinsam zwei Drehbücher geschrieben, die er verfilmt hat. Thema: Junge Frau aus dem Osten trifft junge Frau aus dem Westen, sie freunden sich an. Der erste Film spielt in Berlin, wo sie sich kennen lernen. Der zweite in Chemnitz. Wo die junge Frau aus dem Westen, die aus dem Osten besucht. Es gab noch einen dritten, aber bei dem war ich nicht mehr beteiligt. Viele unserer Ost-West-Gespräche, ein wiederkehrendes Thema für uns bis heute, ist in die Bücher eingeflossen.
Ich mache ein Foto, weil ich den Blick in den sonnigen Stadtpark gegenüber so schön finde: Die Parkaufräumer in ihrer orangenen Kleidung machen vor der grünen Kulisse eine Pause vor ihrem orangenen Gefährt. Sie schwatzen mit einer Anwohnerin.
Eine der Brunnenfiguren ist mit offenen Armen in ihre Richtung ausgerichtet, als begrüße sie sie alle oder wolle auf sie zugehen.
Vor einer der Parkbänke sitzt ein älterer Mann lässig auf einem schicken, fast Mofa artigen Rollgefährt, so eins für Menschen mit mobiler Beeinträchtigung. Die rote Karosserie glänzt in der Sonne. Er unterhält sich flirtend mit einer Frau in seinem Alter.
Die langen Bänke und sonstigen Sitzmöbel, haben alles andere als ein Hostile Design. Es gibt sie zuhauf in dieser Stadt – ich streiche das Thema, wie im Lauf der Zeit noch viele andere Problemthemen, derer man sich im Rahmen des Projektes vielleicht annehmen könnte, von meiner Liste. Ich schaue zurück auf meine Mail an H. – Sie ist weg. Nein! Entwürfe-Ordner: Leer! Papierkorb: Empty. Meine Mail, verschluckt in Dessau.
Mein Kaffee ist alle. Ich gehe los, einen Bodenwischer und Kehrblech kaufen. Die Mail schreibe ich später nochmal. Jetzt erstmal: Aktion Bude putzen. Dieses Loch im Erdgeschoss ist nämlich alles andere als in der Sauberkeitswohlfühlzone.
August 2024 – Dessau im August – Ankommen
Als ich zum ersten Mal ankomme, verstehe ich, wie so oft im Osten nicht, wie der Bahnhof und die Stadt zusammenhängen. Der Bahnhof ist irgendwie draußen, in die Stadt muss man erstmal rein. (Noch spezieller in Dessau: Die Schienen teilen die Stadt in zwei Teile, aber das verstehe ich erst später). Vor dem Bahnhof ein architektonisch unsortierter, aufgrund fehlender Beschilderung undurchschaubarer Ausgangsort. Später wird jemand aus der Gruppe, das als Frage nach der Willkommenskultur bezeichnen.
Als ich in der Innenstadt ankomme und den Veranstaltungsort nicht finden kann, spreche ich eine Postbotin an, die gerade ihre Runde macht. Hallo, guten Tag, Entschuldigung, wissen Sie wo die Soundso-Straße Hausnummer Soundso ist?
Stadt! bellt sie. Mehr nicht. Ich verstehe nicht, was meint sie? Ich frage vorsichtig nach. Stadt! bellt sie erneut und wedelt mit der Hand um sich. Wie, Stadt? frage ich, so langsam genervt von ihrem Einwortsatz. Dann dämmert mir, was sie meint. Eine Adresse von der Stadt, vom Rathaus, der Kommune. Ich schlage ihr das vor, ach, Sie meinen von der Stadt, vom Rathaus? Wir stehen nämlich direkt an der Längsseite des Rathauses. Aber wo ist die Hausnummer? Sie zuckt mit den Achseln. Müssense gucken.
Ich irre zweimal um das Rathaus und seine angrenzenden Neubauten mit diversen Eingängen, die, wie sich herausstellt, alle dieselbe Hausnummer haben und finde irgendwann durch Zufall den richtigen Eingang.
Juli 2024 – Der Vorleser
Sommer. Nicht heiß, aber warm. Ich bin unterwegs, durch die Straßen dieser Stadt. Es beginnt zu regnen. Nicht so stark, dass ich nicht bereit wäre, nicht sogar Lust hätte, mich dem auszusetzen, aber doch genug, dass ich es nach Hause schaffen will, bevor es schlimmer wird. Ich will nicht, dass meine Turnschuhe nass werden, sie halten nicht lange durch, Textil.
So etwas beschäftigt mich.
Schnellen Schrittes also gehe ich die Straße entlang, es ist nicht weit bis nach Hause. Ich komme an einem Eckhaus vorbei, einem Altbau, vor dem traditionell ein Regal steht. Man kann dort Sachen ablegen, die man nicht mehr braucht, zum Mitnehmen für andere. Auch ich habe dort schon aussortierten Kram hingebracht, Kleidung, Bücher, Geschirr.
Ich höre jemanden sprechen. Die Stimme eines Mannes dringt an mein Ohr, melodisch, fein. Doch auf der Straße ist niemand zu sehen. Die Sprache klingt gewählt, wie getextet, jedoch lebendig. Nur zwei Schritte weiter die Wand entlang und ich entdecke ihn: Im Hauseingang sitzt er, auf den schmalen Stufen zur Haustür. Er ist etwa dreißig. Hinter ihm liegt sein Hab und Gut in zwei Taschen, offenbar ist er obdachlos, hat hier Unterschlupf vor dem Regen gesucht. Die Mauern des Hauseingangs und die hohe Decke umrahmen ihn, machen ihn für den Augenblick, an dem ich an ihm vorbeigehe, zum Bild: Porträt, Hochkant. Auf seinen Knien liegt ein Buch, dort, auf den aufgeschlagenen Seiten, ruht sein Blick, liegt seine ganze Konzentration.
Er liest vor.
Das Buch: gebunden, ohne Einband, es wirkt alt. Er muss es aus dem Mitnehm-Regal genommen haben. Er liest gut. Der Text wirkt solide, literarisch. Er füllt den Raum damit, die Mauern geben seiner Stimme support, seinem Vortrag, den er hält,
in den Regen hinein, wie in ein geöffnetes Fenster.
Als ich an ihm vorbei bin – nur anderthalb Schritte dauert der Moment – verklingt seine Stimme in der Sommerluft so rasch wie sie zu mir gekommen ist.
Juli 2024 – Das Kissen
Mein neuer Lieblingswerbeclaim:
Kissen erobert Land im Sturm.
Was würde Pixar daraus machen?
Juli 2024 – Attentat
School officials said Mr. Crooks did not have any disciplinary problems in high school, and was sent to detention once, in eighth grade, for chewing gum, according to school records released on Friday. He rarely missed a day of school, and teachers noted that he participated in class and was interested in learning.
Juli 2024 – EOB
Ein sehr junger Mann neben mir im Café beklagt sich bei seiner Freundin: „Jour Fixe heißt das jetzt immer, kann man da nicht einfach Meeting sagen?“ Ich muss lachen. Er bekommt es mit, fühlt sich bestätigt. Fügt noch hinzu: „Genau wie EOB, End of Business Day.“ Er schüttelt den Kopf wie ein bekümmerter Großvater, das Kind.
EOB, kannte ich noch nicht, notiere heimlich. Dann mach ich: Feierabend.
Juli 2024 – unter Lesben
Ich gerate in eine Runde Lesben am Biertisch eines einschlägigen Lesbenclubs. Obwohl ich mit zwei lesbischen Frauen da bin, scheint hier niemand auch nur eine Millisekunde davon auszugehen, dass ich lesbisch sein könnte. So hetero sind meine Vibes offensichtlich. Keine flirtet, gut, die ein oder andere macht auf dicke Hose oder lästert über die alteingesessene Freundin daheim, aber das geht nicht in meine Richtung. Ich bin ein kleines bisschen beleidigt.
Ansonsten alles recht hemdsärmelig und irgendwie rollenverteilt hier, ein sichtbarer Generationen-Gap, die jüngeren am Nachbartisch, so kommt es mir vor, habens deutlich leichter und sind nicht ganz so geschlagen mit ihren Geschichten. Ich glaube nicht, dass hier in der Runde der älteren (45 bis 55) irgendjemand nicht irgendwann mal in Therapie war. So siehts aus.
Juli 2024 – Gedanke
Ich lese mal wieder Eribon. In seinem Buch „Eine Arbeiterin“ begegnet mir seine Beobachtung, dass es die Frauen sind, die das Wissen über die Familie haben, dass sie es sind, die die Familiengeschichten weitergeben, sie wieder und wieder erzählen, die detailliert über Verwandtschaftsverhältnisse sprechen könnten, darüber, wer mit wem welchen Grades verwandet ist, wer wen geheiratet und wie viele Kinder bekommen hat.
Das kommt mir bekannt vor. Auch meine Mutter – keine Arbeiterin – hat es geliebt, diese Geschichten zu erzählen. Und sie zu hören, zumindest habe ich das immer mit der Frauenwelt zusammen gebracht, in der sie aufgewachsen ist und in der sie sich wohlgefühlt hat, in der sie in der Küche mit Mutter und Großmutter und den beiden Schwestern gelebt und getratscht hat, wo gekichert und geheimnisvolle Andeutungen gemacht und tragisch der Kopf geschüttelt und geseufzt wurde. So kenne ich es von ihr.
Die Stammbaum-Erstellung hingegen ist etwas, dem sich, so mein Eindruck, die Männer widmen, gerne im späteren Lebensalter, Bücher darüber lesen, Akten und Standesamteinträge recherchieren, nachforschen, wer wann wohin gezogen ist und wer auf welchem Friedhof liegt.
Ich frage mich, ob darin nicht der Versuch einer Aufwertung der eigenen Herkunft, der Familie liegt. Wird man nicht praktisch zum Adelsgeschlecht, zur Dynastie, wenn man einen Stammbaum vorweisen, sich genüsslich die Namen auf der Zunge zergehen lassen kann? Während die Familienerzählung der Mutter lebendige Geschichten aufruft, und versucht, den lauschenden, meist nur mäßig interessierten Kinder einzubleuen, welche Großcousine einen Arzt geheiratet hat und später von ihm mit drei Kindern sitzen gelassen wurde, interessiert sich die Stammbaumforschung des Mannes für die Mechanik der Familiengeschichte, für Orte, Namen und Berufe.
Eribons Gedanke, dass die Alten und Pflegebedürftigen sich selbst nicht mehr als Gemeinschaft definieren können, um ihre Rechte zu vertreten. Wer kann ihr Fürsprecher sein, wenn sie nicht mehr selbst dazu in der Lage sind zu sprechen?
Die Thematisierung des Alters geschieht selten aus der Position des alten Menschen heraus, eher aus der Perspektive der Kinder, die das Altern der Eltern verarbeiten. Viele Bücher gibt es dazu. Das eigene Altern, ein Prozess, der doch meist lange vor dem Altern der Eltern beginnt, ist kein Thema.
Für mich schon. Finde ich.
Juni 2024 – Verkehrtrum Smiley
Jemand erzählt seinem Kumpel an der Ampel:
Stellt sich raus, ich hab das Paket von Amazon mit den Airpods zurückgeschickt an Sixpm, und den Pulli von Sixpm zurück an Amazon!
Juni 2024 – Weird German Culture
Im Café. Drei Tische weiter eine Dreierrunde junger Expats, zwei Männer, eine Frau, in ihren late twenties, Start-up-Leute?, vielleicht noch Studis. Sie unterhalten sich im Lästermodus über die Germans und ihre Eigenheiten. Einer der Jungs, ich schätze Australier, erzählt, dass er jemanden kennt, der bei seinen Eltern wohnt und dort Miete zahlen muss. Er geht voll darauf ab, kann es nicht fassen. Die anderen schütteln ebenfalls verständnislos den Kopf, aber er ist wirklich maximal empört: Das sind seine Eltern! And he has to pay rent!!!
Sie scheinen alle drei insgesamt nicht besonders angetan zu sein von der weird German culture.
Ich bin irritiert. Ich ertappe mich bei dem Gedanken, dass ich das unter bestimmten Umständen nur richtig finde, dass so ein Lümmel oder so eine Lümmeliene Miete zahlt, wenn er oder sie Geld verdient und den Alten noch immer auf der Pelle hockt, sie als Eltern sieht, an denen man nuckeln kann, statt als Menschen.
Ich staune einmal mehr, wie German ich bin. Very German. Soziale Kälte, voll mein Ding.
Mir gehen diese Prenzlberg-Kinder ja eher auf die Nerven oder vor allem ihre Eltern, die sich nicht abgrenzen können und ihre selbstgefälligen, auf maximale Bequemlichkeit des eigenen Egos trainierten Kinder im Nest behalten, um sich selbst zu schonen und sich den Herausforderungen ihrer Midlife-Crisis zu verweigern.
Jedoch. Frage ich mich. Warum meine eigene Familien- und Lebenserfahrung inklusive meiner politischen Haltung, mich dazu bringt, so zu denken. Statt sich zu freuen, wenn es jemand für selbstverständlich hält, dass man sich kümmert, no matter what. Care-Manifesto. Lese ich gerade.
Ich habe in den letzten Jahren gelernt, dass man Familie auch anders sehen und denken kann. Warum denn nicht, sollen sie doch in Berlin bleiben, ist ja auch toll hier, wir wollten schließlich auch hier leben. Warum denn nicht, soll er wieder bei uns einziehen, wenns in der WG nicht mehr geht, ist doch schön, zusammen frühstücken, und mit seiner Freundin verstehen wir uns auch so gut.
Doch wenn ich jetzt genauer drüber nachdenke: In einem Fall war am Ende jemand tot (Elternteil, Suizid), im anderen Fall wurde dem herzigen Bub durch permanentes Schnittchen schmieren das Leben verkackt, weil er irgendwann vor lauter Schonwaschgang nur noch zum Gamen in der Lage war.
Vielleicht ist das aber auch einfach eine Geschichte über die Wohnungskrise.
Juni 2024 – Das Symptom
Ich gehe auf meine Haustür zu. Vor mir auf dem Gehweg zwei Frauen, die sich unterhalten, middle aged, also my age, gut aussehend, selbstbewusst, etabliert wirkend – so mein Eindruck aufgrund von Sprache, Kleidung, Kontext und all den anderen, auf irgendeinem unteren Bewusstseins-Level in Sekundenbruchteilen wahrgenommenen und interpretierten, trügerischen ersten Codes.
Eine der beiden hat einen Hund an der Leine, einen dieser kniehohen Rassehunde mit längerem Fell, nicht zu kraftvoll outdoorig, nicht zu cute, eher so freundlich solide und streichelbar. Und dann diese ganzen Männer 50plus!, sagt die Frau mit Hund gerade zu ihrer Freundin, da haben doch Frauen die Profile geschrieben! Sie bleibt abrupt stehen, die Leine ragt jetzt straff gespannt quer über den Gehweg, weil ihr Hund abrupt gestoppt hat, um die kleine Grünfläche vor meiner Haustür nach Urin, Kot und sonstigen Ausdünstungen anderer Hunde abzuschnüffeln. Auch die Freundin ist stehen geblieben und hört wartend zu, wie die Frau über die Diskrepanz zwischen den durch die Beratung der wahrscheinlich besten Freundin oder gar von Mutti? entstandenen Profilen und den real existierendem Männern beim Date klagt, die sie für so enorm hält, dass man die Profile praktisch als Betrug bezeichnen muss. Einem Betrug, an dem andere Frauen sich auch noch beteiligt haben!
Ihr Hund wiederum liest derweil in der Grünfläche die Dating-Profile anderer Hunde mit der Nase ab und kommuniziert schließlich in breiter Hocke mit Urin zurück. Ich kann nicht zu meiner Haustür, weil Frauen, Leine, Hund sich davor zu einer Familienaufstellung angeordnet haben, zu der ich nun unfreiwillig dazu gehöre, obwohl ich schon von weitem in ihrer Sichtachse war und meine Absicht durch das Zücken meines klappernden Haustürschlüssels längst klar gemacht habe. Doch die Frau ist zu vertieft in ihre Berichterstattung einerseits und ihre Hundefürsorge andererseits, die den regelmäßigen Besuch von öffentlichen Bedürfnisanstalten, in diesem Falle unserer Grünfläche vorsieht. Weswegen sie auch nichts dabei findet, dass ich dabei zusehe, wie ihr Hund die Pflanzenruinen vor dem Haus, in dem ich ersichtlich wohne, mit seinem ätzenden Urin weiter ruiniert. Die Freundin fällt den Satz: Oh, möchten Sie durch?, über die Szene, um die andere darauf hinzuweisen, dass ich da bin. Was die längst weiß.
Wir, drei mittelalte Frauen vereint in Traurigkeit und Frustration über das Abhandenkommen von Liebe und Illusionen, warten gemeinsam bis der Hund soweit ist, der nach vollendeter grundehrlicher, beratungsfreier Profilerstellung noch mit den Hinterbeinen zwei schwungvoll kratzende Striche hinter sich ins Gelände setzt, wie eine Unterschrift unter ein Gemälde oder eine Geste des Dirigenten am Ende der Partitur.
Der Weg wird frei, ich stecke den Schlüssel ins Schloss und kann nicht umhin zu denken: Der Hund ist das Symptom der Frau.
Juni 2024 – Mittesprech
Im Café am Nebentisch. Ein Typ telefoniert. Sehn wir uns noch in Ibiza? Ja, ich freu mich drauf, das wird mega, richtig mega. Na, letztes Jahr waren da hauptsächlich so Single Girls aus England und USA. Nee, auf jeden Fall! Nee nee, wir gründen. Klar, gegründet wird noch vor Ibiza, ja.
Juni 2024 – unvorstellbar vorstellbar
Muss ich jetzt in meinem Leben auch noch einen Krieg erleben, sagt ein Freund.
Ein anderer erzählt mir von Wasserflaschen und Vorratsdosen.
Juni 2024 – The Power of Goodbye
In einem Artikel über Ghosting lese ich folgenden Satz:
“How could I be so worthless that someone would not care to say goodbye?”
Juni 2024 – Eine Frau
Ich sehe von weitem eine Frau auf der Straße. Ich kenne sie. Ich weiß, wie sie heißt. Ich weiß, dass T. was mit ihr hatte. Als wir noch zusammen waren, als wir gerade nicht mehr zusammen waren, womöglich ist sie heute noch seine neue Freundin, wer weiß das schon, ich nicht.
Sie kannte mich. Das hat sie nicht daran gehindert. Vielleicht im Gegenteil. Und warum auch? Seine Entscheidung. Was hat er ihr erzählt? Dass es eh zu Ende ist? Obwohl es noch nicht zu Ende war. Dass es schon okay ist? Obwohl es nicht okay war. Oder war es einfach kein Thema, war ich kein Thema, da schon eine Null, nicht vorhanden, egal, übersehbar. Von beiden.
Sie ist alt geworden. Wie ich. Sie geht die Straße entlang, innerlich beschäftigt, auf dem kauend, was sie heute bei der Arbeit erlebt hat. Wie ich. Sie hatte, hat wahrscheinlich noch immer einen tollen, sicher anstrengenden Job, einen Job, den ich mir nie zugetraut hätte, obwohl ich mal in derselben Institution gearbeitet habe. Genauer: Ein Praktikum gemacht habe. Na klar.
Ich erinnere mich, dass ich damals, als sie auftauchte, versucht habe, mich mit ihr anzufreunden. Kläglich, peinlich, habe ich ihr einen Veranstaltungsbesuch vorgeschlagen, sie auf FB angefragt. Weil ich sie nett fand, interessant. Sie mich nicht. Sie fand T. interessant. So war es meistens.
Ich wusste nicht, dass die beiden schon mittendrin waren. Ich erinnere mich an einen Kalendereintrag. 90s-Ausstellung mit K. Der Kalender lag mit der Notiz offen auf seinem Tisch. Warum?
Ich erinnere mich an eine Szene auf dem Balkon bei T. Während einer Party. Wie er und sie rauchend, lachend, dort standen. Ich weiß noch, was sie anhatte, ein Kleid, wie immer. Ich weiß noch, wie sie den Kopf zurück gelegt hat, eine kleine, zierliche Person, die Haare schwarz im French Cut, genau sein Typ, und laut gelacht, ihr Gebiss entblößt hat. Das ich abschreckend fand.
Ich weiß noch, was ich anhatte.
Ich weiß noch, dass ich in der Küche nervig viel Zeit mit irgendeiner Vorbereitung irgendeines Snacks verbracht habe. Am Herd stand. Abgesprochen mit T., mein support für seine Party.
Ihre Verachtung dafür. Für die Frau in der Küche.
Diese ganzen Demütigungen. Das Gefühl, danach, später, vor seinen Freunden, vor ihr, vorgeführt worden zu sein. Dumm gewesen zu sein, naiv. Dooftreu. Needy. Voller Angst, ein vom herannahenden Auto geblendetes Tier, in kindlicher Verweigerung verharrend, um die längst beschlossene, längst gelebte, aktive Ablehnung, die Aggression nicht an mich heran, mich nicht erfassen zu lassen.
Der ferne Anblick einer sehr fremden Person schafft es, das alles aufzurufen als wäre es gestern gewesen. Als wäre sie noch sie, ich noch ich und T noch T.
Ich bin noch ich.
Mai 2024 – Japan im Mai – Im TV
Baseball, Soccer, Turnen, Sumo, die Japaner lieben Sport.
Ein junger Sumo Ringer hat das Mai Tournament gewonnen, (Tickets zu bekommen unmöglich). Er wirkt schüchtern. Die Antworten, soweit ich das beurteilen kann, bescheiden. Wie zur Hölle funktioniert das mit diesen Frisuren, die auf ihren Köpfen liegen wie das kleine Handtuch im Onsen, jederzeit, hat man das Gefühl, könnte sie herunterfallen.
Die Sendung mit dem Koch. Er ist lustig, weil: dick (das zieht sich hier durch, dicke Leute sind funny). Außerdem hat er eine Frisur wie ein Beatle und trägt bunte Klamotten. Alle Signale auf Clown.
Anscheinend funktioniert das so: Er wird von Leuten angeschrieben, die sagen, mein Vater macht die allerbesten Wagyu-Spießchen oder: in dem und dem Laden machen die beiden Betreiberinnen die besten Ramen-Suppe, und dann geht er hin und isst. Auf dem Bildschirm sind dabei in kleinen runden Fenstern Leute im Studio zu sehen, B- und C-Promis, schätze ich, die, wie wir, dabei sind, das beobachten und kommentieren. Er geht da also hin und redet erstmal mit denen, die ihm geschrieben haben, die Töchter oder die langjährige Kunden, und dann bekommt er das Essen serviert und dann schauen alle ganz gespannt, wie sein Gesichtsausdruck ist und was er sagt, und jedes Mal wenn er sich den ersten Bissen in den Mund schiebt, macht er Geräusche und Grimassen, weil natürlich alles so überirdisch lecker ist, und dann sagt er so witzige Sachen, dass sich alle kaputt lachen und allen das Wasser im Mund zusammen läuft.
Mai 2024 – Japan im Mai – Fotos
Noch nie habe ich in so kurzer Zeit so viele Fotos gemacht. Alle sind schlecht. Ich renne vorbei und halte drauf, in Panik irgend etwas zu vergessen. Nichts wird was. Als ich später durch scrolle bei dem Versuch ein Album zu erstellen, scheitere ich. Das Foto kein Foto, ab und an eine Erinnerungshilfe. Irgendwie hab ich das irgendwie nicht auch noch geschafft.
Mai 2024 – Japan im Mai – verkehrt rum
Alles ist verkehrt herum. Gelaufen wird links, gelesen wird von rechts, gefahren wird links, die Karten sind nach Süden ausgerichtet, also wer macht denn sowas?, der Schlüssel wird rechts herum gedreht, um sie zu öffnen. Wir gehen links die Rolltreppen in Tokio, in Osaka dann plötzlich rechts und in Kyoto bitte in Zweierreihen, um Fenster zu öffnen, drehen wir den Griff nach oben (unsere Kippstellung) …
Mai 2024 – Japan im Mai – Sento
Vor der Badeanstalt: Schuhe aus. Ab in den Spind. Da sehen wir uns noch, dann verschwinde ich hinter dem roten Vorhang mit dem chinesischen Zeichen für Frauen, U. hinter dem blauen für Männer. (der Vorhang heißt Noren, hängt an vielen Ladentüren, oft mit Aufdruck).
Im Vorraum zum Bad. Ein Fernseher. Spinde. Darin: Körbe aus Plastik, weiß. Regale mit Manga. Eine Holzbank. Eine Spiegelwand. Ein einzelner Fön auf der Ablage darunter. An der anderen Wand: Zwei Trockenhauben. Alles irgendwie alt, auch die nette, gut gelaunte Dame, die alles managed.
Die Verschlüsse der Spinde, ein Rätsel, wohin mit meinen Sachen, ah, in die Körbe, ziehe ich alles aus, nehme ich das Handtuch mit in den nächsten Raum, hülle ich mich in das Handtuch ein, ab wo bin ich nackt, hier schon oder erst im nächsten Raum? Im TV über mir das Wetter – tenki, mindestens so wichtig wie Sport hier. Magazine für Frauen auf einem Tischchen neben der Holzbank.
Die alte Frau, die Bademeisterin, sitzt leicht erhöht wie in einem Stand, sie kann zu den Männern und den Frauen schauen. Manchmal hört man die Geräusche, die die Männer auf der anderen Seite machen. Die Frau lacht viel, wenn ich etwas frage, das ist gut für mich, nichts was ich falsch mache, ist wirklich schlimm, und am Ende scheinen doch alle individueller mit allem umzugehen, als man auf den ersten Blick denkt.
Vom Vorraum geht es in den eigentlichen Baderaum, besser: Waschraum. Kacheln. Rosa Plastikhocker, gelbe Schüsseln, aufeinander gestapelt.
Die gespreizten Beine der alten Frau. Die Frau (mein Alter), die sich um ihre alte Mutter kümmert, ihr den rund gewordenen Rücken abreibt, das ist hier überhaupt sehr beliebt, sich einzuseifen und kräftig mit Tüchern abzuschrubben, später, im Vorraum dann, wird sie ihr etwas zu trinken kaufen. Weil ihr schwummrig ist. Das Getränk in der kleinen braunen Flasche, das ich später auch versuche.
Aha, auf den rosa Hocker setzt man sich also, nackt, an einen der Plätze vor der Spiegelfront. Die ist auf entsprechender Höhe zum Hocker – also niedrig und geht die ganze Wand entlang. Am Boden eine Rinne, alles, alles gekachelt hier, alle barfuß, keine Latschen. Ausnahmsweise. Zwei Tretpedale am Platz, in der Rinne am Boden, links blau, kalt, rechts heiß, rot. Über mir außerdem: ein Duschkopf. Die Frauen mischen das kalte und heiße Wasser in der gelben Schüssel an und begießen sich damit. Über die Schultern, den Kopf. Viele haben – professionals eben – kleine Plastikkörbe mit ihren Sachen dabei, Seife, Handtuch, ich weiß erst nicht, wohin mit meinem Kram, nehme mir dann einfach eine zweite gelbe Schüssel, lege mein Handtuch da rein, naja, suboptimal, das hätte ich im Vorraum lassen müssen. Aber ich hab mich geniert.
Ich drehe den Riegel am Duschkopf, nichts passiert. Ich schaue verstohlen zur Nachbarin, sie hat ihn auch nach rechts gelegt. Ich versuche den Duschkopf am Platz links neben mir, aha, der funktioniert. Ich rutsche mit Hocker und Schüssel nach links. Elegant ist was anderes.
Alle, so habe ich den Eindruck, registrieren, dass ich nicht kapiere, wie alles funktioniert, aber keiner mischt sich ein.
Ich lasse also heißes und kaltes Wasser in der Schüssel zusammen fließen, gieße es über meine Schultern, den Rücken, den Kopf. Ich seife mich ein, das muss richtig schäumen, Signal für Sauberkeit, shampooniere die Haare, rasiere meine Achseln, meine Beine, das darf man hier, das macht man so, das Sento stammt aus einer Zeit, in der die Menschen noch keine Bäder in ihren Häusern hatten.
Ich kauere auf dem Hocker vor dem Spiegel und sehe mein Gesicht, meine Brüste, meinen Bauch, will man das? Die Nähe zu mir selbst ist mir unangenehm. Auch wenn jeder in dieser japanischen Art bei sich bleibt, ein unsichtbares Raum-Zelt um sich herum: ich sehe die Frauen, die hinter mir an den Plätzen der anderen Spiegelwand sitzen, im im Spiegel vor mir, so wie sie mich, verborgen bleibt hier wenig. Faltige Haut, krumme Hüften, knochige Knie, Scheiden, Schamhaare, Brüste, man sieht sich, in Gleichheit und Abgrenzung, sieht, was man war und was man wird, das Schöne und das Knorrige, das Krumme und das Ehemalige, ich bin ein bisschen verschreckt, das ist viel.
Der Körper im Bad ist als individueller sichtbar, gleichzeitig ist er Teil einer Gemeinschaft. Ein Gemeinschaftskörper. In Gemeinschaftlichkeit wird sich ihm gewidmet. Mit den Gesten von Waschung und Pflege wird er gesund gehalten, ihm soll Wohlbefinden zuteil werden, ein persönliches wie gemeinschaftliches Anliegen. Wie sich jemand wäscht und pflegt ist ein intimer Vorgang, dessen Zeuge wir sind, anders als bspw. in der Sauna. Gleichzeitig zeigen diese Gesten ein allgemeines, gemeinschaftliches Wissen um diese Vorgänge.
Erst nach einer Weile komme ich rein, das Wasser überm Kopf, immer wieder, über die Schultern, nochmal einseifen, wie mach ich das mit dem Po, da sitz ich ja drauf. Viele, besonders die älteren Frauen, sitzen nicht auf den Hockern, sondern im Fersensitz auf dem Boden, also auf den Unterschenkeln, wie man es in Japan oft sieht. Auch die Gärtner zum Beispiel sitzen so, in den Wohnungen wird so gegessen, ist mir völlig unklar, wie man das lange aushält.
Es gibt drei Becken, nicht allzu groß, ähnlich den Eintauch-Becken, wie man sie aus der Sauna kennt. Ein rotes, ein mittleres, ein erstes. Gibt es eine bestimmte, heilige Reihenfolge? Ich nehme das Becken, in dem nur eine Frau ist, außerdem schaut sie mich einigermaßen freundlich an. Das Wasser ist herrlich heiß. Ich liebe es. Die anderen Frauen in den Becken haben sich noch gar nicht die Haare gewaschen, bemerke ich, aber so wirklich schlimm kann das nicht sein. Das Becken mit dem rot gefärbten Wasser ist mir suspekt, das meide ich. Die Frau darin guckt aber auch mürrisch. Bei der zweiten Runde finde ich das winzige Kaltwasserbecken. Da geht niemand rein. Aber ich! Das mag ich nämlich am Allerliebsten. Meine Haut ist rot, ich pumpe, so soll es sein.
Schnell hab ich keine Lust mehr. Zu fremd ist das alles. Es gibt noch eine kleine Kammer, ist das ein Dampfbad? Niemand benutzt es, ich trau mich nicht rein. Ein Mädchen, vielleicht zehn, kommt in den Baderaum, ihr Körper so anders in seiner Geschmeidigkeit, Festigkeit, es ist unfassbar. Rasch setzt sie sich ins Becken, schnell ist sie weder raus, sie bewegt sich so sicher hier, ist sie alleine da, zu wem gehört sie?
Ich gehe durch die Glastür in den vorderen Raum zurück. Ich ziehe mich an, alles mit Bedacht, dann kann ich besser schauen, wie andere ihre Abläufe gestalten, außerdem hab ich das gelernt hier. Die Dinge, die man tut, ernst zu nehmen und sich Mühe mit ihnen zu geben.
Ich föhne mir die Haare. Das Mädchen – ich verstehe jetzt, dass die Bademeisterin und das Kind sich kennen, sie muss die Enkeltochter sein – guckt ein bisschen nach mir. Zack ist sie wieder angezogen. Sie muss das alles seit sie ein kleines Kind ist tausendmal gemacht haben.
Die Frau versucht mir etwas zu sagen, anscheinend habe ich irgendwas verpasst, vielleicht die Sauna, das Dampfbad, keine Ahnung. Es ist nicht schlimm, ich habe genug Abenteuer erlebt. Ich will jetzt auch so ein braunes Fläschchen trinken. San hyaku en (Dreihundert Yen) wiederhole ich, denn das hab ich verstanden, was mich freut, und ich betrachte die noch immer sehr ungewohnten Münzen in meiner Hand. Das Kind hilft mir, zählt die kleinen Münzen aus meiner Hand, die Frau lacht. Ich will raus mit dem Getränk, aber das Kind schüttelt energisch den Kopf, zeigt mir den Kasten, in den die leere Flasche gehört. Ich setze mich auf die Holzbank. Gut so. Nicht davon rennen. Langsam machen. Die süße Gummibärchen-Limonade trinken, die sich in der kleinen braunen Flasche befindet. Auch das mit dem Drehverschluss musste das Mädchen mir zeigen. Es hatte eine gute Zeit.
Später, als ich draußen bin und auf U warte, bin ich ein wenig erleichtert. Es fühlt sich an, als sei ich nah an etwas herangekommen, vielleicht zu nah. Ein Eindringling bin ich gewesen. Das Bad war kein schickes Onsen, nicht auf Touristen ausgerichtet oder auf junge, urbane Japaner, es war ein kleines, altes Bad in der Nachbarschaft. Zu U werde ich sagen, dass ich es erstaunlich finde, dass man in dieser Nachbarschaft weiß, wie die Lehrerin nackt aussieht, die Frau mit den zwei kleinen Kindern, die in der dritten Etage im selben Haus wohnt oder die Frau, die am konbini hinter der Kasse steht. In der sich sonst so bedeckt gebenden Kultur in Japan würde man diesen im Bad plötzlich so offensiven Umgang mit Nacktheit und Körperlichkeit nicht vermuten.
Mai 2024 – Japan im Mai – Tourismus-Broschüre
In Kanazawa finde ich eine kleine Broschüre, die Touristen darüber aufklärt, wie sie sich verhalten sollen. So ist das hier. Das ist das Grundprinzip. Nicht-Japaner, Touristen, gaijins (Fremd-Menschen, höflich: gaigokujin: Fremd-Land-Menschen, aber das sagt eigentlich keiner) wissen nicht, wie man sich in Japan verhält. Man muss es ihnen erklären, beibringen, damit sie erträglicher sind, weniger Störfaktor in den Abläufen. So ist die Setzung, das ist die Basis. Bei uns wäre diese Haltung (Reizwort „Leitkultur“, die sollen sich anpassen) nicht denkbar, bzw. problematisch, weil sie als xenophob bis rassistisch empfunden würde.
Touristen, Ausländer sollen das Land nicht prägen, nicht verändern, sie sind willkommen, aber sie sollen auch wieder gehen. Sie sollen temporär anwesend sein, und wenn sie da sind, sollen sie sich einfügen, sich benehmen, damit niemand in seinem Alltag allzu sehr gestört werden. Es ist oft lustig, was die Fremden alles nicht wissen, was sie falsch machen, wo das doch so logisch ist, wie man es macht. Aber manchmal nervt es eben einfach auch, sie sind anstrengend, diese zur Rücksichtslosigkeit, zum Lautsein und zum ausgelebten Individualismus neigenden Anderen. Sie wissen nicht, dass man in der Ubahn den Rucksack nach vorne nimmt oder zwischen die Beine stellt, dass man nicht laut spricht, dass man im Café seine Tasche nicht auf den Tisch stellt, sondern in extra dafür bereit gestellte Körbe, dass man im Gehen nicht isst oder trinkt, dass man seinen Müll in der eigenen Tasche mit nach Hause nimmt. Also muss man es ihnen erklären, mit Schildern auf dem Markt und in der U-Bahn oder eben in dieser Tourismus-Broschüre, die über das „normale“, das erwünschte Verhalten aufklärt. Es muss also ein kollektives Wissen darüber geben, was dieses Verhalten ist. Ein Wissen darüber, was „Japanisch“ ist. Ich glaube nicht, dass das in Deutschland so ist.
Mich entspannt das. Ich bin gerne die Fremde, die sich anpasst. Die lernt, wie man sich benimmt, die es unangenehm findet, es nicht zu wissen, der es gefällt, darüber aufgeklärt zu werden, wie man sich in bestimmten Situationen verhält, wie etwas „üblich“ ist. Für mich ist Japan ein Seminar, ein Kurs. Erst spät regt sich ab und an Widerstand bei mir und ich mache nicht immer meine Hausaufgaben.
Dass die Japaner Rassisten sind, darüber ist oft gesprochen worden. Doch wie immer ist auch das komplex und widersprüchlich, und Japan ist, wie alle Länder auf seine sehr eigene Weise rassistisch und xenophob. Shinzou Abe jedenfalls, der rechtskonservative bis rechtsextreme, jahrzehntelang immer wieder gewählte Premierminister Japans, hat das Land auch während der Flüchtlingskrise dicht gehalten und zwischen 2013 und 2018 laut Wikipedia 134 Flüchtlingen Asyl gewährt.
Es ist natürlich ein Unterschied, ob man eine schön gestaltete, in freundlichem Ton verfasste Tourismus-Broschüre in der Hotelauslage findet oder einen abgelehnten Asylantrag in die Hand gedrückt bekommt.
Mai 2024 – Japan im Mai – Jazz
Kanazawa. Wir gehen in eine Jazz-Bar. Ich kann gar nicht fassen, wie schön die ist. Ich shazamme alle Titel, die an dem Abend aus zwei hervorragenden, gut aussehenden Boxen perlen und kratzen. Wir bestellen was zu essen, ich bekomme Home Made Pickles (wie ich später lerne: Tsukemono) und flippe total aus, weil die so unfassbar lecker sind und so wundervoll aussehen. Auch der Wein ist wunderbar ausgesucht und die kleine Margarita mit feinem Salzrand wird mir in einem Tropfenglas serviert. Später im Hotel höre ich den ganzen Jazz nochmal, lasse mich davon tragen, davontragen. Sex geht dazu auch gut.
Mai 2024 – Japan im Mai – Care
Kanazawa. Im Hotel Pacific, einen Namen, den ich liebe schon als ich zum ersten Mal das Logo sehe und das kleine Café betrete, das gleichzeitig als Rezeption des Hotels dient, leihen wir uns Fahrräder. Es hat gestern und am Morgen noch geregnet und die junge Frau, die die Räder für uns bereitstellt, bittet uns, vorsichtig zu sein, es könne noch rutschig sein. Sie fragt, ob wir Helme möchten. Nein, wir sind ready to go. Als ich schon auf dem Rad sitze und mich nochmal umdrehe, stehen dort der Chef, ein netter Typ um die 50 mit Peter Lustig-Latzhose und die beiden Mitarbeiterinnen an der Tür, um uns zu verabschieden Sie winken, machen ihre kleinen Verbeugungen. Mir kommen die Tränen. Ich kann mich nicht erinnern, je von von meinem Eltern so verabschiedet worden zu sein.
Mai 2024 – Japan im Mai – Im Flugzeug
Im Flugzeug zurück eine junge Japanerin, Studentin, in ihren 20ern schätze ich. Sie schaut Barbie ohne dabei über die gesamte Länge des Film auch nur eine Miene zu verziehen. Versteht sie die Anspielungen nicht, ist es schlecht übersetzt oder findet sie es nicht witzig? Wie kann man da nicht lachen?
Die Japanerinnen lachen oft mit vorgehaltener Hand.
Mai 2024 – Japan im Mai – Fächerahorn
Ich bin verliebt in Fächerahorn. Wunderschön, wie das Licht durch die hellen, feinen Blätter dieser Bäume fällt. Sie wachsen hier überall.
Erst spät fällt mir auf, dass man den Blättern auch als in Pflaster eingelassene Gehwegverzierung und als Logo begegnet, ähnlich wie das Maple Leaf in Kanada ein icon für Japan.
Noch später, zuhause, fange ich an, Perfect Days zu gucken, einen Film, den ich vor Japan aus Spoileralarm-Gründen nicht sehen wollte, und relativ früh im Film, dem ich lieber mal von vorne herein schon mal ordentlich Kitsch und evangelisches Pathos unterstellt habe, Wim Wenders eben, gräbt die Hauptfigur, der Toiletten-Mann, einen kleinen Fächerahorn aus, um ihn mit nach Haue zu nehmen und ihn bei sich aufzuziehen. Ich bin hin und weg. Danach schalte ich trotzdem lieber erstmal aus.
Mai 2024 – Japan im Mai – fernsehen
Ich glotz TV. Was ist hier eigentlich mit diesen Fernsehkanälen los, in den Hotels, Apartments nur fünf komische Programme plus QVC-artige Sender? Die paar Kanäle sind das Öffentlich-Rechtliche?
NHK heißt es, ich recherchiere es, kostet die Japaner genau wie uns Gebühren und das und das Programm werden schwer kritisiert. Es gab sogar mal eine Partei, die sich nur darauf fokussiert hat. Nun ja, kommt uns bekannt vor.
Mai 2024 – Japan im Mai – Eki ben
Man nimmt sich etwas zu essen mit in den Zug, ein Sandwich, eine Bento-Box! Die isst man dann, auf dem Tablett am Platz. Ein Platz, der so viel Beinfreiheit lässt, dass U. glücklich lacht und ich ein Foto von ihm mache. Der schönste Eki-ben-Laden ist in Tokyo, direkt unterhalb des Gleises von dem aus wir nach Hiroshima fahren. Bento-Boxen in allen Größen, ihre Beispiel-Plastiken hübsch einzeln platziert in den Vitrinen rund um das Ladenfenster. Man soll nichts nehmen, was starke oder unangenehme Gerüche verbreitet, lese ich, knisternde Tüten hört man hier im Zug nicht, alle essen artig. Die Toiletten wie immer ein Traum, das Internet geht allerdings auch hier nur sporadisch und das Design der Polstersitze wirkt angestaubt.
Zum ersten Mal fühlen wir uns orientierungslos, allein gelassen, wie heißen die Haltestellen, wann werden wir sie erreichen? Google, was wären wir alle ohne maps, lens und translate? Noch hilflosere, nervige Deppen.
Der Shinkansen derweil unbeirrt vorbei am Häuschenmeer. Irgendwann ein paar Reisfelder, kleine, abgesteckte Areale, trocken heute, doch dann wieder Häuser, Häuser als Landschaft bis zum Horizont. Die kleinen Orte voller Eigenheime, wie bei uns.
Die Züge fahren so schnell, dass ich öfter mal enttäuscht bin, gerade erst haben wir uns gesetzt, nun müssen wir schon wieder aussteigen?
Mai 2024 – Japan im Mai – Dörrie
Ich lese Leben Schreiben Atmen von Doris Dörrie, mein Buchtrack zur Reise, erstaunlich passend, weil sie so ein Japan-Fan ist, erstaunlich anrührend, weil es um Verlust geht und sie mich damit trifft.
Ich frage mich, warum ich sie immer so beiseite geschoben habe, man könnte auch sagen, sie überheblich ignoriert habe. Vielleicht wegen ihres München-Appeals, das aus der Berliner Perspektive ja immer schön oberflächlich mit oberflächlich assoziiert ist, konservativ, kommerziell; vielleicht wegen ihrer auffallenden Brille, die für mich immer auf eine unangenehme, generationell verortbare, sprich irgendwann veraltete Art war, „Kunst“ und „ich bin ne ganz Verrückte“ zu schreien, wie so ein roter Schal. Vielleicht wegen ihrer Filme, die mir immer seicht vorkamen oder zu sehr auf die Zwölf, ohne dass ich natürlich je mehr drei ihrer Arbeiten gesehen zu haben, nicht einmal Hanami mit Wepper. Vielleicht wegen ihres Hangs zum Spirituellen, das mich an die Frauenbewegung der 80er erinnert und an die Regale mit „Frauenliteratur“, die damals in jeder Buchhandlung standen und in denen direkt neben dem „Emanzipationsbuch“ der Tarot-Ratgeber einsortiert wurde. Möglicherweise ist an all dem was dran. Dennoch schäme ich mich. Denn unterm Strich ist Dörrie doch ne Sis! Eine dieser älteren Schwestern, ohne die wir nicht wären, wo wir sind. Eine die mutig war, ohne ein Macho zu sein, eine die sich mit bewundernswertem Selbstverständnis und erstaunlicher Kraft in der verdammten mens mens world des Films und des Schreibens bewegt hat und als nun ältere Frau noch immer bewegt. Eine, die ganz anders als ich feige Kuh, um die Welt gereist ist, mit einer solchen Lebenslust, Offenheit, Neugier und einer Fähigkeit zu Freundschaft und Liebe, dass ich mir (sagen wir beinahe) wünsche, ich hätte mich in München an der Filmhochschule beworben und wäre in den Genuss ihres sicher hervorragenden, zugewandten Unterrichts gekommen. Eine Mentorinnen-Figur, wie ich sie mir immer vergeblich gewünscht habe, die mich gesehen und verstanden und unterstützt hätte, wäre sie vielleicht gewesen. Aber wer weiß, vielleicht hätten wir uns ja auch NULL verstanden.
Ihr Buch jedenfalls war so, dass ich all das gedacht habe und noch dazu eine Menge anderes.
Mai 2024 – Japan im Mai – Natur
Naoshima. Als U, der sich wundert, wie man angesichts einer solchen Meeresbucht bei bestem Wetter auch nur eine Sekunde außerhalb des Wassers bleiben kann, die junge Frau an der Rezeption fragt, weshalb die Japaner eigentlich nicht im Meer baden, sagt sie: too cold und reibt sich mit den Händen über die Oberarme. U. irritiert das zutiefst. Hier und sonst. Die Japaner sind Drinnies. So so langsam der Eindruck. Eine starke Verbindung zur Natur scheint es bei den Japanern zu geben, gleichzeitig fürchten sie sie enorm. Das Meer gibt zu essen, Bäume werden liebevoll gestützt und gepflegt, die Erde wird bepflanzt, Gärten kultiviert, die Blumen gehütet, jedes verdorrte Blütenblättchen mit der Pinzette weggemacht, auf den Knien der Rasen gestreichelt und gekämmt, ich schwörs, wir haben’s gesehen. Natur ist wertvoll und bedrohlich zugleich. Vor aggressiven Raben wird gewarnt, die Fenster bitte geschlossen halten, sonst kommen Insekten rein, die Schuhe nicht draußen lassen, sonst holt sie der Waschbär. Natur wird kultiviert, zivilisiert, gebändigt. Vielleicht ist das die Antwort auf Erdbeben und Tsunami. Baden gehen kann man im Onsen oder im Sento. Da ist es niemals too cold, die Abläufe sind klar, es gibt nichts Unberechenbares.
Als wir einige Tage später in Kanazawa an den Strand fahren, liegt dieser tiefe, aus wundervoll seidigem Sand bestehende Strand alleine da. Wir mussten lange fahren und laufen, um ihn zu erreichen, das erste Bild, das wir von ihm sehen, ist von einer Autobahnunterführung gerahmt. Gut, es regnet ein bisschen und ist windig, doch generell scheinen sich außer ein paar Surfern und verrückten Touristen niemand von den Einheimischen für ihn zu interessieren. Was wäre an so einem Strand in Europa los!
Warnungen Informationen Verhaltensweisen. Wie ist den Dingen zu begegnen. Wie lässt sich über Verhalten das Entsetzliche, das jederzeit herein- oder herausbrechen kann, bändigen, wie kann man dem Unbändigen, dem Unberechenbaren Herr werden. Auch eine Bombe ist ihnen vom Himmel auf den Kopf gefallen. Was mich wundert, nirgendwo finde ich Anweisungen zum Verhalten bei Erdbeben oder Tsunami. Ich fühle mich sicher, in diesem Land, das meine Ängste zu teilen scheint, mich für alles rüstet, mich beständig freundlich aufmerksam darauf macht, wohin ich gehen, wie ich stehen soll. Doch die ganze Zeit beunruhigt mich, dass ich nicht weiß, was ich tun soll, wenn die Erde bebt. Wei en Tabu kommt mir das vor. Alle müssen das hier mit der Muttermilch aufgesaugt haben. Erdbebenübungen schon im Kindergarten. Vielleicht deshalb? Aber so ganz passt das nicht. Touristen werden Bringt es Unglück, darüber zu sprechen?
Mai 2024 – Japan im Mai – Water Lilies
Man bittet uns, die Schuhe auszuziehen. Es liegen Pantoffeln bereit, ich nenne sie mal so. Weiches Leder, schmale Sohle, vorne eine rundliche Haube. Sogar die Hausschuhe sind hier edel, sie passen zum Boden, auch farblich (helles Beige). Auf einer langen Bank, die mich an den Turnunterricht erinnert, sitzen wir neben anderen An- und Ausziehern.
(Man lernt ja auch immer was über andere Kulturen auf Reisen, weil einem die fellow tourists auf Schritt und Tritt begegnen, die gleichen fragenden Blicke in ihren Gesichtern, die gleiche schäfchenartige Bereitschaft, sich lenken und mit den Regeln vor Ort konfrontieren zu lassen, in ihrem Touri-Sein dennoch kulturell wiederum sehr unterschiedlich. Die Asian tourists voll gewöhnt an die Schuhsache, wir Europeans eher immer so, echt jetzt, schon wieder der Hassel? Unangenehm, die Sneakers auszuziehen, die dampfen könnten, unangenehm, sich der Welt in Socken zu präsentieren, entmachtet fühlt man sich.)
Dann dürfen wir rein. Ich weiß gar nicht „wo rein“, keine Ahnung, was genau mich erwartet, bis hierher war es anstrengend, ein Hin und Her zwischen zwei Kunsthäusern, Chichu Museum, Benesse Art, zurück zu Chichu, weil unser Plan, in einem der Gebäude zu frühstücken, nicht aufgegangen ist. Ich habe den Überblick verloren. Ich gehe also mit meinen schlecht sitzenden Pantoffeln in Richtung der jungen Frau, die, mit diskretem Blick kontrolliert, ob wir die Pantoffeln tragen und mit freundlich leitender Geste und angedeuteter Verbeugung auf den vor uns liegenden Raum verweist. Eine Geste, die ich inzwischen aus anderen touristischen Situationen gut kenne. Ich wende mich dem offen vor mir liegenden Raum zu – und für einen Moment stockt mir der Atem. Ich höre mich irgendetwas Absurdes sagen, wie „Die haben hier die Seerosen“, weil ich so verblüfft und erfasst bin vom Anblick von Monets Bild (Water Lily Pond) an der hinteren, mir gegenüberliegenden Seite des Raums. Ich sehe jetzt, dass der Raum sich in einen vorderen und einen hinteren unterteilt. Die Öffnung des hinteren Raums, das Gebäude selbst also, gibt den Seerosen von hier aus betrachtet, einen Rahmen, betont ihr Cinemascope-Format (2mal6 Meter).
Ich gehe auf die Seerosen zu, nähere mich ihnen. Alles um mich herum ist weiß, ein weißes Meer aus Boden, Wänden und Decke, alles streichelt mit seiner hellen, seidigen Wärme meinen Blick. Ich gehe auf die Seerosen zu, komme ihnen näher. In all dem Weiß sieht das Bild aus als würde es schweben, sein Blau noch blauer.
Der Boden über den ich gehe, besteht aus unendlich vielen kleinen, weißen Kacheln mit schmalen, feinen grauen oder schwarzen Schlieren darin. Marmor. Später lese ich in den kleinen Katalog des Museums, dass er aus Italien importiert wurde, aus der Carrara Region, aus der Michelangelo seinen Marmor hat liefern lassen. Kein Wunder also, dass wir hier nur mit Hausschuhen reindürfen. Die Ecken der Kacheln sind leicht abgerundet, ich folge meinem Impuls, beuge mich hinunter und berühre sie. Sie sind weich, sehr weich.
Ich nehme (wer hat mir beigebracht, das zu tun, mein Vater) unterschiedliche Abstände und Perspektiven aufs Bild ein. Man darf hier nicht fotografieren, ich versuche mein Gedächtnis zu benutzen wie einen Fotoapparat, natürlich wird das nichts nützen und es schmerzt mich, gleichzeitig bin ich froh, dass ich nicht fotografieren darf, ich würde etwas anderes erleben.
Als ich an die Decke schaue, wird mir klar, dass der Raum mit einer Art transparentem Plexiglas bedeckt zum Himmel offen ist. Das Licht, das auf Monets Seerosenteich fällt, ist natürliches Licht. Wie mag er aussehen, sich verändern, wenn der Himmel in Naoshima mit dunklen Wolken bedeckt ist oder die Sonne bei klarem Himmel in der Mittagszeit steil in den Raum fällt? Tadao Andos architektonische Entscheidung fügt dem Bild – und den zwei weiteren Seerosen-Gemälden, die in diesem Raum hängen – den Außenraum hinzu. Er verändert die Bilder je nach Wetterlage, wie das Wetter es eben tut, wenn wir an einem Teich stehen. Mit dem Weiß der Wände lassen sich Häuser in mediterranen Regionen assoziieren, die Kacheln an einen Pool denken, mit dem sich das Blau des großen Bildes nüchterner verbindet, dem Blick darauf etwas Kühles verleiht.
Was mich berührt: An vielen Stellen kommt mir das Bild schattig und unklar vor, als habe jemand dort Klarheit, Deutlichkeit gesucht, jedoch lediglich diese flirrende Diesigkeit gefunden und sie dann auch abgebildet. Vielleicht sind es nur die Weiden, die sich in der Abendsonne auf dem Teich spiegeln, aber mir kommt Monets Augenkrankheit in den Sinn, die hier vielleicht schon eine Rolle gespielt hat, so sehr bildet sich eine Dynamik des Gegenhaltens, des dringlichen Festhaltens im Bild ab. Plötzlich erzählt das Bild auch davon.
Mai 2024 – Japan im Mai – Schreiben
Es passiert so viel, jeden Tag, dicht an dicht, dass ich den Stift nehme und es aufschreibe, abends, spätestens am nächsten Tag. Damit nicht alles Flöten geht. Zwei Heftchen voll sind es am Ende. Ich finde das schön. Und dennoch ärgere ich mich später, dass ich nicht gleich hier reingeschrieben habe. Nun macht es umso mehr Mühe.
Wie immer sehe ich die Heftchen in den Händen derer, die einst meine Wohnung ausräumen werden und sie in den bereitgestellten Container werfen. Aber so ist der Lauf der Dinge.
Mai 2024 – Japan im Mai – Miyajima
Quer durch Hiroshima mit der Tram bis zum Hafen. Auf die Fähre, die schon wieder anlegt, kaum hat man sich an Deck begeben, um aufs Meer zu schauen. Gleich wenn man aussteigt und die belebte Promenade betritt, sieht man sie: Rehe. Verblüffend, ihr Anblick. Sie bewegen sich selbstverständlich unter den Passanten, kommen ihnen nah, und sind dennoch mit dieser merkwürdigen Abstands-Aura ausgestattet, wie jedes wilde Tier. Ich mag sie nicht, sie machen mir Angst. Ihre Forschheit, ihr Drängen. Ihre Unberechenbarkeit. Ich mag nicht, dass die Leute sie füttern und fotografieren. Doch auch ich werde sie fotografieren.
Wie Profis posieren die Rehe, die hier heimisch sind, vor diesen Rechtecken, die man ihnen vor die Nase hält, sie scheinen Posen einzunehmen, den Hals noch etwas eleganter zu legen. Offiziell soll man sie nicht füttern. Im Gegensatz zur sonstigen Hinweis-Wut gibt es hierzu aber nur wenige, versteckte Schilder. Der Reiseführer hatte die Rehe für Nara angekündigt, weswegen ich gar keine Lust hatte, dorthin zu fahren. Nun sind sie auch hier.
Als ich später eines am Strand sehe, bin ich zunächst beruhigt. Vielleicht weil der Strand, trotz Spaziergängern, Hafenpanorama im Hintergrund, wie ein natürlicheres Habitat wirkt. Das Reh frisst Seegras, wenigstens irgendwas, was nicht aus Tüten oder Taschen stammt. Ich fotografiere das Reh. In diesem Moment fällt mir eine Fotografie von Wolfgang Tillmanns ein und ich bin geschockt. Tillmanns Foto (es heißt Deer, ich recherchiere es später) geht so:
Ein Hirsch, schlank und schmal, nicht so gewaltig wie die Hirsche, die es in unseren Wäldern gibt, und ein Mann – Tillmanns selbst? – stehen auf einem ansonsten leeren Strand einander gegenüber und schauen sich an. Der Mann hat die Hände ausgestreckt, gespreizt, ein bisschen als wolle er das Geweih des Hirsches nachbilden. Die beiden scheinen zu kommunizieren. Ein magischer, rarer, wunderschöner Moment des Kontaktes, verletzlich und mutig zugleich. Der Mann ist barfuß, die Hosenbeine sind hochgekrempelt, neben ihm steht ein Rucksack am Boden. Weit im Hintergrund sind links ein paar Häuser zu sehen, undefinierbar, ich jedenfalls habe ihnen nie Beachtung geschenkt. Ich habe diese Fotografie immer geliebt. Doch in diesem Augenblick wird mir klar, dass das Foto wahrscheinlich hier oder in Nara entstanden ist. Mir wird klar, dass ich es immer falsch gelesen habe, falls es so etwas gibt. Der Moment ist viel weniger magisch als ich dachte, weniger witzig auch. Denn jeder hier geht in Kontakt mit den Tieren, jeder hier hat einen Fotoapparat, um diesen Moment festzuhalten. Das Foto bekommt plötzlich einen Shift hin zu einer ganz anderen Bedeutung, plötzlich ist seine Erzählung eine andere. Es ist ein Foto über Tourismus.
Ich fühle mich betrogen und beschämt zugleich.
Mai 2024 – Japan im Mai – Kürbis
Naoshima. Ich spaziere ans Ende der kleinen Bucht, zu Kusamas gelbem Kürbis, der von seinem leicht erhöhten Platz aus so friedlich wie keck aufs Meer schaut. Von unserem Wohnwagen aus haben wir ihn die ganze Zeit schon gesehen, jetzt will ich mal auf Tuchfühlung gehen.
Wie alle anderen – der Kürbis ist selten allein – bin auch ich gekommen, um ihn zu fotografieren.
Eine Frau spricht mich an, fröhlich klingt sie, freundlich, mittleres Lebensalter wie ich, eine hübsche, sympathische Frau, einen Rock trägt sie, die Sonnenbrille in die langen, hellen Haare gesteckt. Sie fragt mich, ob sie ein Foto von mir vor dem Kürbis machen soll, ich zögere. Would maybe funny, because I am wearing my polka dot dress, überlege ich. Right!, ruft sie, und: Oh, of course you need a picture! und nimmt mein Handy entgegen. Sie macht drei Fotos von mir im schwarzen Kleid mit weißen Punkten vor dem gelben Punkte-Kürbis, wie schon befürchtet, gibt das ein verkrampftes hässliches Bild ab, das ich so schrecklich finde, dass ich später alle drei Versuche lösche und darüber nachdenke, das Kleid nie mehr anzuziehen, überhaupt kein Kleid, und mich ganz konsequent einfach nicht mehr fotografieren zu lassen. Dann tauschen wir. Kann gut sein, dass das der Grund war, warum sie mich eigentlich angesprochen hat, weil sie ein Foto von sich vor dem Kürbis wollte.
Ich mache drei Fotos von ihr, sie sieht gut aus in ihrem Rock und ihr Lächeln ist auch nicht so ein verzerrtes Horror-Grinsen wie meins. Bestimmt hat sie Kinder, denke ich. Und vielleicht einen Ex-Mann. Nun reist sie allein durch die Welt, denn das tun sie, die Frauen im mittleren Lebensalter: Ihre Kinder sind aus dem Haus oder liegen beim Therapeuten auf der Couch und schimpfen über ihre Mutter, also sie, die Männer sind bei Jüngeren, mit neuen Jobs und neuen Herausforderungen beschäftigt und die nun allein stehenden Frauen, was für ein Wort, entwickeln ungeahnte Kräfte und denken sich, soll ich jetzt heulen und depressiv werden oder soll ich das ganze Geld von meinem Mann nehmen und mich der Kultur widmen und Reisen machen und eine nie gekannte Form der Zufriedenheit finden. Oder beides im Wechsel.
Wir sprechen kurz. I dont recognize your accent …? sagt sie. Das scheint die zur Zeit anerkannt korrekte, am wenigsten als offensive geltende Frage nach der Herkunft zu sein, das hab ich jetzt schon öfter gehört von Englisch sprachigen Reisenden. Sie erzählt, dass sie aus Neuseeland kommt oder dort zumindest schon lange lebt, ihre Eltern sind aus Australien. Ah, sage ich, interesting, und dass es mir so vorkommt, als seien viele Australier in Japan unterwegs? Sie wird ganz aufgeregt, wedelt protestierend mit ihren schlanken Händen, sie sei aus New Zealand!, sagt sie dreimal, New Zealand!, completely, really completely different country! So war das gar nicht gemeint, bin nur beim Stichwort Eltern/Australien dumm hängen geblieben. Ich sage ihr, dass ich das sehr genau weiß, dass das zwei very different countries sind, spätestens seit ich Flight of the Conchords gesehen habe. (Ach, mein Bildungsfernsehen). Ooouh! staunjubelt sie, you know Flight of the Conchords? Did you like it? (Das findet sie verwunderlich, dass ich das liken könnte, vielleicht weil ich aus Deutschland komme). I found it hilarious, sage ich. Und erkläre nochmal, dass ich seither sehr genau weiß, dass Australien und Neuseeland two very different countries sind. Ah!, jetzt fällt der Groschen und sie lacht. Wir reden kurz über Jermaine und wie hieß der andere, nur Murray fällt uns noch ein, was aber glaub ich der Agent und nicht der buddy war. Ich erzähle, dass die beiden, Jermaine und der buddy, als ich damals in New York war, sogar eine Show auf dem Broadway hatten.
Dann verabschieden wir uns. Sie bleibt noch ein bisschen beim Kürbis. Der Kürbis, der das alles mitgehört hat. Ich kann ihn ja noch am nächsten Tag streicheln, weil ich praktisch neben ihm wohne.
Als wir zwei Tage später Richtung Fährhafen zurück fahren, zwischen Koffer und Rucksack im Bus eingequetscht wie auf der Hinfahrt, steigt sie an einer der Stationen zu. Sie spricht fröhlich mit zwei Frauen, ach, denke ich, doch mit Freundinnen unterwegs! Doch später am Hafen sehe ich sie ohne die Frauen, die längst ihrer Wege sind und ich höre, wie sie ein Ticket nach Taeshima bucht. Ihre Reise geht allein weiter.
Warum fand ich allein essende trinkende reisende Frauen früher so wahnsinnig cool und stark und heute finde ich sie so wahnsinnig … einsam? Warum ist etwas, das mir unglaublich emanzipiert, um mal dieses alte Wort aus alten Zeiten zu benutzen, unabhängig und selbständig vorkam zu etwas verkommen, was auf mich wie ein tragisches Schicksal wirkt. Bin das nur ich und mein projiziertes Selbstbild oder bin das ich im Namen einer misogynen Gesellschaft, die die älter werdende, von allen verlassene, nicht mehr begehrbare Frau nur als unglückliche begreifen kann? Deren Beteuerungen, es sein eine große Zeit der Befreiung niemand ernst nehmen will.
Ich stelle mir vor, dass sie ein schönes Haus hat und Freunde, die sie auf ihre Terrasse einlädt. Und einen Hund. (So kenn ich das aus australischen Serien). Ich bin ein bisschen traurig, weil sie eine dieser Frauen ist, die mir das Gefühl geben, nicht erwachsen geworden zu sein. Wir könnten nicht befreundet sein. Aber als ich sie so alleine weiter reisen sehe, bin ich ein bisschen versöhnt. Noch so ne Frau, die einfach versucht, irgendwie klar zu kommen. Ihre professionelle, leicht überhebliche Freundlichkeit, nach meiner Erfahrung typisch für soziale Interaktion mit englischen Muttersprachlern, ist eben auch nur: professionell und hilft durchs Leben.
Vielleicht sollte ich auch mal nach Neuseeland fahren. Wenn da alle so nett sind. Aber der Flug ist ja noch länger.
Mai 2024 – Japan im Mai – Naoshima 2
Natürlich habe ich Angst. Dass der Waschbär kommt, wenn ich nachts aufs Klo gehe, dass ein Mann mir auf die Toilette folgt und versucht mich zu vergewaltigen, dass ein Tsunami kommt und den kleinen Wohnwagen in dem wir in Doppelstock-Betten schlafen (ich oben, weil das Bett nur bis max. 70 Kilo hält), wie ein Spielzeug nach oben wirft, ihn dort kurz tanzen lässt, um ihn dann in seinem riesigen Maul mit sich in den Abgrund zu reißen. Ich habe Angst, eine riesige Spinne zu sehen, eine riesige Kakerlake, eine riesige Hornisse, ich habe Angst, von einer Mücke gestochen zu werden, die eine böse, von unseren schlecht geschulten Ärzten zuhause über lange Zeit unentdeckte Krankheit überträgt, ich habe Angst, dass der Flug eine Thrombose bewirkt haben könnte, eine Embolie, die jetzt, wo wir auf einer Insel sind, weit weg von medizinischer Versorgung, meine Lunge blockiert, ich habe Angst, dass U etwas passiert und ich nicht damit fertig werde, weil ich nicht mal die einfachsten Dinge von ihm weiß, wie bspw. die Telefonnummer seiner Töchter, Mütter, Brüder, Frauen. Es ist schön hier. Deshalb habe ich Angst.
Mai 2024 – Japan im Mai – Naoshima 1
Als wir aus dem viel zu kleinen, mit Touristen und ihren Koffern viel zu vollgedrängelte Bus steigen und ich die kleine Bar mit den paar Tischen und Stühlen unter Kiefern vor der Meeresbucht sehe, ist alles gut.
Dieser Ort wird sich in mein Gehirn einbrennen. Ein Trost-Ort.
Das Essen, das wir in dem kleinen Restaurant von den beiden Frauen bekommen, ist das beste der ganzen Reise. Im Tablett serviert, die einzelnen Tellerchen, Schalen gestellt gedreht gerichtet und gerückt, jedes für sich, jedes für dich.
In meiner Suppe schwimmt ein einzelnes längliches Fischlein wie zur Deko, nun wieder Barthes: ein Zeichen. Der Fisch als Ausdruck seiner Essenz, die Suppe, klar, besteht aus ihm und seinesgleichen, der Fisch markiert sich selbst, signalisiert sein Fischsein, den Vorgang, den Prozess, die Welt, die diese Suppe aufruft bis hierher.
Auf meinem Reis in der Schale winzige weiße Geschwister von ihm, white bait, wie Nudeln mit winzigen Augen, proteinreich, hängen geblieben im Schwarm, in einem Netz, so fein, muss es gewesen sein. Und natürlich, ein wenig Gemüse, eingelegt, wie meistens hier, mit starken Farben versehen, ihre Ursprungsfarbe ausgebleicht darunter, ohne noch etwas mit ihr gemein zu haben.
Ich sitze zwei Stunden lang am Wasser unter Kiefern, schaue aufs Meer, die Brise leicht, die Wärme warm, und lese. Das. ist der richtige Ort. Für einen Moment.
Das Gehen im Sand ist wie die Auffrischung einer ungeheuerlichen Erinnerung.
Zu selten!
Mai 2024 – Japan im Mai – Notes 2
In Kanazawa. Wir sind mit dem Rad am Fluss entlang gefahren, jetzt schauen wir aus dem Fenster eines Cafés. Rechts von uns sind Wohnhäuser zu sehen, Neubauten, noch nicht lange erschlossen, so scheint es. Wir sind in einem Wohngebiet. Auf der Straßengabelung steht ein kleines torii, ein Tor, das einen Schrein markiert. Ein Mann kommt angelaufen, eine noch leere Einkaufstasche in der Hand. Er macht eine kurze Verbeugung vor dem Tor, bevor er hindurch geht.
Immer diese kleinen Überraschungen.
In Hiroshima morgens in der Tram keine freundlichen Gesichter, müssen die Jetzt! zum Bahnhof fahren mit ihrem ganzen Gepäck, jetzt?, mitten in der Rush Hour wo wir wie die Zombies, Anzug an Anzug an Kostüm dicht an dicht stehen.
Mai 2024 – Japan im Mai – Hiroshima
In der Ausstellung zum Atombomben-Abwurf höre ich Besucher weinen. Ich will auf keinen Fall weinen, es scheint mir wie so oft keine angemessene Reaktion. Ich kann aber auch nicht so ganz anders.
Irgendwo zwischen den Zitaten von (kurzzeitig) Überlebenden, ein Junge. „Ich war bereit, dem Feind entgegen zu treten“. Das bleibt mir im Gedächtnis. Es ist das einzige Zitat, dass offen patriotisch ist. An diesem Tag waren viele Jugendliche (ab 13) in Gruppen in diesem zentralen Bereich der Stadt unterwegs. Sie sollten als Baustellentrupps dabei helfen, Schneisen zwischen die Häuser zu schlagen, damit das Feuer bei Bombenangriffen nicht so leicht übergreifen kann. Besonders viele junge Menschen sind deshalb an diesem Tag gestorben.
Auch die Aussage eines Fotografen bleibt haften. Er erzählt, dass er angesichts dessen, was er gesehen hat, als er am Ort des Einschlags ankam, seinen Fotoapparat hoch hielt, aber zunächst nicht fotografieren konnte. Er beschreibt, was er gesehen hat. Es war die Hölle, schließt er. Dann erst. Dann. Hat er angefangen zu fotografieren. Es sind die Bilder, die wir sehen.
In der zweiten Abteilung des Museums sind an Schautafeln die historischen Abläufe dargestellt. Von den wissenschaftlichen Ursprüngen der Atombombe übers Manhattan Project, die Entscheidung der Amerikaner, die Atombomben zu werfen, bis hin zu den japanischen Bemühungen für Abrüstung und den Bann der Atombombe einzutreten.
Von der Verbindung zu Deutschland im Nationalsozialismus und dem sehr spezifischen japanischen Faschismus keine Rede. Vielleicht ist es richtig, sich angesichts eines Atombombenabwurfs auf eine Ebene der Grundsätzlichkeit (Frieden, Abrüstung, nie wieder) zu begeben, aber das nicht zu erwähnen, finde ich problematisch. Es kommt einem doch sehr ausdrücklich vor.
Mai 2024 – Japan im Mai – Kleidung
Die Kleidung locker, bequem, irgendwie „gesund“, auch hier den Bedürfnissen des Körpers gegenüber zugewandt, sorgend. Leinen- und Baumwollstoffe, Hüte und Schirme, gegen Sonne und Regen. Weite Schnitte, keine Enge für Brust, Taille, Hüfte. Socken und Schuhe mit Platz für Zehen, die Sohlen weich. Das Haar gut geschnitten in klaren Frisuren. Angenehm, praktisch, komfortabel, das ist die Ausrichtung.
Die Signale der Individualität bei den kichernden Costume Teenies dann ganz anders: Plastik, Synthetik. Die Kleidung als Verkleidung, die Feier des Schrillen, die Lust am skill des Aufbrezelns. Färben, Drehen, Binden der Haare, die Kleidung als Beschäftigung.
Die Hipster-Jungs gerne cool in Dunkel, interessante, eher kastenartige Designer Schnitte, weite Hosen, dicke Sohlen, gerade Shirts aus dichtem, wertigem Gewebe, Caps und hats.
Vor allem und zunächst mal: Der Anzug und das Kostüm.
Die Masse der Angestellten lassen an Kracauer denken. Stumm sitzen und stehen sie in den Ubahnen, jeder in seiner selbst erzeugten Kapsel aus In Ears und Handy und diesem erstaunlich untrüglichen Gefühl für Abstände, eine Verhaltenheit in den Körpern, noch bei höchstem Menschenaufkommen. (Wie die inneren Kämpfe der Angepasstheit aussehen müssen, wie der Körper sich ausufernd Bahn bricht oder zumindest die Fantasie davon, kann man erahnen, wenn man die Frauenabteile in der Ubahn sieht, die zu bestimmten Tageszeiten, erstaunlicherweise nicht nachts, installiert werden. Abends und am Wochenende dann wird der Anzug abgelegt (zur Reinigung gebracht, gebügelt, gehängt?), man kommt zu sich selbst, auch in seiner Kleidung. Die Tracht, der Kimono bei Frauen wie Männern durchaus beliebt und sichtbar. Das Sonntagskleid, die Freizeithose wird gegen das Arbeitskostüm getauscht wie Identitäten, die man sich anziehen kann. Kleidung ist weniger sich ausdrücken als vielmehr Anlegen, Ablegen. Das Kleid macht dich, es ist die Facette deines Ichs, deines Lebens, das jetzt gerade angesagt ist, zu dem du angehalten bist.
Wie man sich vorstellen kann, wie sie gestern Abend noch in der Izakaya saßen, in Chinos und Sneakern oder locker fallenden Sommer-Hängern, und mit ihren Freunden gelacht, getrunken, gesprochen, gegessen haben. Nun stehen sie still in ihren eng anliegenden Anzügen, stecken in ihren taillierten Kostümen, auf dem Weg zur Arbeit.
Mai 2024 – Japan im Mai – birru
Das Bier ist hier so lecker luftig leicht und wird meist in so hübschen kleinen ladyliken Gläsern serviert, dass ich in den 17 Tagen erstaunlich häufig „birru o kudasai“ bestelle. Wo ich doch Bier gar nicht mag!
Mai 2024 – Japan im Mai – Taito Store
1
Shibuya. Ich will so ein verdammtes Stofftier aus einem dieser verdammten Kraken-Automaten gewinnen! Crane oder Claw Machine heißen die glaub ich offiziell. Es gibt sie in großen, lauten, mit Neonlicht clean ausgeleuchteten Läden über zwei oder drei Etagen verteilt. Die Stufen zu ihnen sind oft leicht abgeschrägt und mit Metall beschlagen, es ist immer ein bisschen, als betrete man ein Fahrgeschäft auf der Kirmes. Die Musik ist lauter J-Pop.
Es gibt kleine süße Stofftiere und riesige kuschelige. Die meisten sind, das muss man sagen: krass hässlich. Egal. Ich werfe ein 100 Yen Stück nach dem anderen ein, positioniere den Greifer, ich lass mir Zeit, ich mach das richtig gut, finde ich. Dann drücke ich den Knopf, die Krake fährt nach unten, greift, fährt hoch, das Stofftier schwankt – und fällt zurück ins Weiche, auf seinen Berg an Kumpels, statt runter in die Öffnung, also zu mir. Mir erscheint die Sache aussichtslos. Wie soll das gehen, rein physikalisch, wie viel Geld muss man da reinwerfen, damit da endlich mal was rauskommt?
Ein Junge, etwa 14, dunkle Jeans und Shirt, die übliche lässige Pony-Frisur, bearbeitet die Maschine ein paar Meter weiter. In der Plexiglas-Vitrine vor ihm eine Horde aus unanständig über- und quer zueinander liegenden riesigen Puh der Bärs. Eine fröhliche Orgie in Knallgelb. Jedesmal, wenn die Krake einen von ihnen bewegt, gehen kleine Rucks durch ihre Formation, liegen sie in neuen Konstellationen beieinander. (Ach, du! auf dich hab ich ja schon von da drüben ein Auge werfen können. Vor fünf Minuten lag ich mit meinen Kopf in deinem Schritt. Wenn du nicht bald mal dein Bein von meinem Gesicht nimmst.)
Ich versuche es noch einmal mit meinem Bunny, dann gebe ich auf. Als ich mich zum Gehen wende, steht da der Junge vor seiner Maschine und hat einen Puh der Bär in der Hand. Yes! rufe ich, mache beide Daumen hoch und lache. Er ist irre stolz, jubelt jetzt auch, beide Arme hoch, den Puh triumphierend hoch gereckt, wir gehen spontan aufeinander zu und machen High Five. Für einen kurzen Moment spüre ich seine trockene, überraschend kleine Hand. Er sagt irgendwas auf Japanisch, was ich nicht verstehe, ich irgendwas auf Englisch, das er so ungefähr versteht, so von wegen Oh my god, wow, how did you do that?
Seine Technik bleibt ungeklärt.
Da geht er hin, der dunkle Teenie-Junge, mit seinem Puh der Bär.
2
In der Nähe der Ueno Station gibt es lange Reihen mit Imbissen, kleinen Shops unter den Ubahnbögen, alles etwas rauer, räudiger, aufregend. Wir essen zwischen Häusern auf Plastikhockern, es gibt mit Käse überbackene Lobsterbeinchen, na sowas.
Wir bleiben in einer Ausschank-Bar an einer Kreuzung hängen, setzen uns dort an den Tresen. Es ist schon später jetzt, die Läden haben zu, die Restaurants und Bars noch offen. Ein junger Mann kommt, ich sehe ihn von hinten und schließt die storage Tür zu seinem kleinen Laden wieder auf. Dort liegt ein weißer Stoffbär, groß, den er wohl beim Taito Store ergattert und hier nach Feierabend vorübergehend zwischengelagert hat. Er nimmt ihn und stopft ihn kopfüber in den Rucksack. Geht nicht, zuvor muss er den blauen Bär, den er schon im Rucksack hat herausholen! Was zur Hölle mache ich falsch?! Alle haben Bärchen. Wie schaffen die es, diese Maschinen davon zu überzeugen, ihnen Bärchen zu geben? Und was macht er jetzt damit, schenkt er ihn seiner Freundin, seinem Freund, er dreht sich um, der junge Mann, den dick gefüllten Rucksack mit dem weißen und dem blauen Bär auf dem Rücken, nein, er sieht aus, als habe er Dutzende Bärchen zuhause, eine Sammlung, auf dem Sofa, im Bett, er ist selbst ein Bärchen. Er schließt die storage Tür zu. Jetzt aber wirklich: Feierabend.
Mai 2024 – Japan im Mai – Wäscheleine
Die Wäsche wird so akkurat aufgehängt wie ich es noch in keinem Land gesehen habe. Die kleinen Wäscheständer auf Balkonen und Terrassen zeigen eine abstrakte Abfolge an klaren, geometrisch wirkenden Flächen: Shirt, Hose, Handtuch werden an äußeren Enden mit Klammern befestigt und in exakt gleich groß wirkenden Abständen so gerade und straff gehängt, dass man sie durchblättern könnte wie Seiten in einem Buch.
Das fasziniert mich. Ich kann nicht aufhören auf diese Wäscheständer zu starren.
Mai 2024 – Japan im Mai – Was wenn
Was wäre gewesen, wenn ich Ende der Neunziger hier gewesen wäre, als ich begeistert war, von allem, was mit Japan zu tun hatte? Was in den frühen Nullern, als ich Japanisch gelernt habe? Was, wenn ich mit T. hier gewesen wäre? Der Reise haftet etwas Nostalgisches an, als sei ich schon einmal hier gewesen oder als sei sie ein Rückblick auf eine Zeit in meinem Leben oder die Erforschung von etwas Verpasstem. Die ganze Zeit bleibt sie etwas, das endlich gemacht werden musste.
Zugleich ist es, als fände sie im einzig richtigen Moment statt.
Mai 2024 – Japan im Mai – Pachinko
Ein Blick in eine Pachinko-Halle heilt mich ein für alle Mal von meiner aus der Ferne gepflegten Faszination. Der Anblick ist erschütternd. Zombies sitzen vor Maschinen. Das ist Armut, Elend. Jeder Knopfdruck eine Wiederaufführung von Kapitalismus-Erfahrung. Spielhölle.
Mai 2024 – Japan im Mai – Safety
In Shibuya dann zum ersten Mal ein leicht nerviger Durchgeknallter, allerdings der japanisch-sanften, nicht der herben Berlin-Sorte, der unruhig vor sich hin quatscht, zwei Touristinnen anspricht. Wir laufen auf der kleinen ruhigen Straße, statt auf dem schmalen, mit einem Geländer abgegrenzten Gehweg. Dann kommen wir in seinen Fokus. Ich gehe schon in die übliche Berlin-Deckung. In diesem Moment kommt ein Auto langsam von hinten, Safety! ruft er, unser Fehlverhalten kommentierend, Japan is Safety! Er selbst geht quer über die Straße von dannen.
Wie sehr kann man leiden unter der hohen Regulierungsfreude dieser Gesellschaft? Die wir ja gerade mal an der Oberfläche streifen, weil wir nicht hier leben, lieben, arbeiten. Doch auch die Ekstase und das Verbrechen haben in Japan ihren Platz, hier in Shibuya zum Beispiel.
Diese Orte des Amusements für welche der Freiheit und Regellosigkeit zu halten, ist ein gängiges Missverständnis.
Mai 2024 – Japan im Mai – Code inconnu
Einmal landen wir nach einem Kinobesuch (Toho Cinemas, Godzilla vs Kong, Monstergetöse, beim Abspann bleiben alle sitzen bis noch der letzte Mitwirkende, der letzte Song genannt ist!) in einem Viertel mit meterhohen Bildern von Jungs. Hübschen jungen Jungs, Solo oder Boygroup artig zusammengestellt. Dieselben Exemplare scheinen uns auf den Straßen zu begegnen, sie sitzen in den auffallend vielen Friseur- und Kosmetiksalons, Style, Frisuren, oben an den Wänden und unten in den Straßen identisch, was ist hier los? Wird hier in den Bars hinter den versteckten Türen, in den ersten Etagen, die man nie auf dem Schirm hat, gesungen, wird sich hier prostituiert oder beides, werden hier Weltstars geboren oder Jungs missbraucht?
Irgendwo macht ein älterer Typ U einen Antrag, ruft von einem Treppenabsatz herunter, dass er gerne seine Couch mit ihm sharen würde. Dann ein junger japanischer Mann, high?, der zwei junge Frauen anspricht, sie gehen weiter ohne zu antworten, ein älterer japanischer Mann, der eine Weile neben einer jungen Frau hergeht, auf sie einredet. Sie bleibt bei ihrem Tempo, geht Richtung Ubahn. Später sitzt sie in der Bahn uns gegenüber. Sie erinnert mich an eine japanische Emma Stone. Sie isst ein paar Nüsse aus einer kleinen Tüte, steckt sie in die Tasche als die Ubahn losfährt, essen ist in der Ubahn verboten. Was hat sie erlebt, was hat sie gesehen in den letzten Stunden und wohin geht sie jetzt? Ist sie irgendwie als Prostituierte erkennbar, waren die beiden jungen Frauen als solche erkennbar oder sind sie einfach nur junge Frauen, die im und durch den Kontext des Ortes legitimiert angesprochen werden. Ich weiß es nicht. Ich verstehe nichts.
Mai 2024 – Japan im Mai – Notes
Yuzu Limonade, unten kleine Stückchen drin, süßer Sirup, aufgegossen auf Eis mit Soda.
Lemon Sour: Shochu, ein japanisches alkoholisches Getränk, dem Gin nicht unähnlich, auf Eis mit Zitronensaft und Soda. Herrlich
Kleine Spießchen vom Grill, chicken, beef, Schweinebauch, deftiges Fleisch, kein Paradies für Vegetarier. Für mich schon.
Der Junge in der Tram in Hiroshima, vielleicht elf, Schuluniform, knielange Hosen. Die Schiebermütze keck ins Gesicht geschoben, darunter das dichte lange Manga-Haar. Wie Haar nur so fallen kann, in diesen schwarz-glänzenden spitz zulaufenden Zacken! Ich meine den Wind zu sehen, der im Anime immer weht, um diese Frisuren, diese Figuren lebendig wirken zu lassen, den Glanz zu betonen, der in blauen Streifen auf den schwarzen Farbflächen liegt. Er merkt, dass ich mich für ihn interessiere, guckt abwesend-überheblich, Model Blick. Ich drücke ab.
Gyoza, Gyoza, Gyoza. Google Translate: Knödel Knödel Knödel
Oktopus-Bällchen im Yoyogi-Park. Calpico dazu.
Im Zen Garten des Silver Pavillon in Kyoto gehen wir artig mit allen anderen die Wege ab. Vor uns ein junges japanisches Paar im Kimono: Es ist Sonntag. Er die Sonnenbrille cool von den Ohren aus nach hinten in den Nacken gehängt, sie mit Tussi-Täschchen von Gucci. Ich drücke ab. People from behind.
Der Rausch der Ubahn. Beschallung, freundliche weibliche Stimmen: Stimmen der Information. Es gibt viel zu sagen, Nummern, Strecken, Linien, Richtungen, Stationen. Always at your service, immer auf Nummer sicher. Zurückbleiben. Warten. An der Linie, bis die nächste kommt. Denn die kommt in drei Minuten. Nicht rennen, hechten, drängeln. Durchgehen, weitergehen, aufrücken. Sumimasen. Stimmen der Regulierung auch, was würde Foucault dazu sagen, nicht Barthes. Gleichzeitig: Stille. Es wird nicht gesprochen, gegessen, getrunken, gekichert, gelacht, diskutiert. Jeder schaut in sein Handy (Manga, Baseball), die In Ears drin, die Abstände, auch bei voller und vollster Ubahn, seltsam gewahrt. Wer mit dem Kollegen, der Freundin spricht, tut es leise, verhalten. Einer hört zu, nickt immer. Höflich. Was denkt er sich? Heimlich.
Grapefruitsaft, mit Soda leicht verdünnt. Auf Eis!
Die Abwesenheit von Müll auf den Straßen. Bei gleichzeitiger Abwesenheit von Mülltonnen im öffentlichen Raum. Müll wird in einer Plastiktüte gesammelt, die man in der Handtasche bereit hält. Zuhause dann wird er sorgsam getrennt und entsorgt. Bis 8 Uhr morgens müssen die Tüten neben den Häusern auf dafür vorgesehenen Plätzen abgestellt werden, jede Sorte Müll an einem anderen Tag.
Schirme. Die Läden stellen sie raus, sobald es regnet, stellen sie: Zur Verfügung. Große, durchsichtige Schirme mit festem Griff keine Knirpse, der Wind zu stark? Beim nächsten Laden stellen wir sie einfach wieder ab. Nichts wird nass. Nichts im Laden, nichts in meiner Tasche, ich nicht. Bedürfnisnah, gemeinwohlorientiert, logisch, praktisch. Komfortabel.
Priority Seating in der Ubahn. Nicht: Business class, sondern ausgewiesene Plätze für Alte, Kranke, Schwangere und Menschen mit Kleinkindern.
Die Zugbegleiter. Stolze Diensthabende in Uniform. Ihre weißen Handschuhe, nun doch Barthes: ein Zeichen. Der Dienst an der Sache, der Dienst an der Allgemeinheit. Eine von ihnen geht durch den Waggon im Shinkansen. Die kleine Drehung am Ende, vor der Abteiltür, uns zugewandt nun, die Schiebermütze auf dem Kopf, das Hemd weiß unter dem dunkelblauen Jackett: Eine kurze Verbeugung, vor uns, den Fahrgästen und weiter, ins nächste Abteil. Hab ich das jetzt richtig gesehen? Die beiden Zugbegleiter, Kollegen, die am Bahnsteig auf den Zug warten, um ihre schicht anzutreten. Wie alle geduldig an der Tür warten, bis alle ausgestiegen sind, die aussteigenden Fahrgäste mit ihrer nickenden Verbeugung grüßen. Wir alle sind hier an einer ehrenwerten Sache beteiligt.
Ich stelle mir vor. Es muss Spaß machen, für eine Bahn zu arbeiten, die funktioniert. Auf die Sekunde kommt der Zug, auf ein Mü hält er so, dass Wagen 3 vor den Bahnsteigtüren zu Wagen 3 zum Stehen kommt. Alle Türen auf, die Leute in Reihen nach rechts und links raus, dann perlenschnurt sich die Warteschlange auf dem Gleis von links und rechts in den Waggon rein. Wer nicht mehr rein kommt, wartet, als zarter Kopf der nächsten Schlange.
35 Millionen und ich bin so entspannt.
Der schüchterne junge Sumo-Ringer, der das Mai Tournament gewinnt. Alle seine gestandenen Gegner hat er weggedrückt. Im Fernsehen gibt er ein Interview. Wie funktioniert das bloß, dass diese Haardeckel mit Schlaufe auf ihren Hinterköpfen liegen bleiben. Wie die kleinen Handtücher, die man im Onsen auf dem Kopf balancieren muss und die nicht ins Wasser fallen dürfen.
Die Toiletten! Wie werde ich sie vermissen. Sie sind sauber, kostenlos und überall, auf jedem UBahnhof, im Konbini, im depaato, im Park, beim Schrein, nie hab ich mich blasentechnisch so entspannt und frei gefühlt, nie zuvor untenrum so sauber.
Ein Armaturenbrett neben der Toto (das häufigste Modell, diese Firma muss reich sein, wie Roca in Spanien) stellt zur Verfügung: Vogelgezwitscher gegen Geräusche sowie zwei verschiedene Wasserstrahl-Modi, einen für den Po, eine für „die Dame“. Das Icon für den Po ist meist ein sanft gerundetes W, das auf einer kleinen Wal-Fontäne sitzt. Bei der Frauen-Funktion sehen wir die gleiche Fontäne, mit dünneren, dichteren Strichen als sanfter angekündigt und obendrauf sitzt bzw. steht, um nichts Indiskretes abzubilden, eine ganze Dame. Die Stärke des jeweiligen Strahls lässt sich ebenfalls regulieren. Als ich alles zum ersten Mal ausprobiere staune ich, dass der Frauen-Strahl irgendwie verschämt nicht von vorne kommt und sich von seiner Verteilungsarchitektur her im Grunde genauso anfühlt, wie der Po-Strahl. Man muss sich ein bisschen rein lehnen. Toilettenpapier gibt es auch, das darf ins Klo. Toilettenbürsten gibt es im öffentlichen WC nicht. Spült man zweimal nach Number two ist wirklich alles weg, was sich an Schmierigem noch im Becken befunden hat, wie schafft die Toilette das nur?
Das Beste aber: Die Toilettenbrille ist angewärmt. Auch an diesem Ort also kehrt Ruhe ein und wird eine Freundlichkeit anfallenden Bedürfnissen gegenüber eingenommen, die ich erstaunlich finde. Nie war ich so entspannt auf Klo.
Shibuya Crossing eher eine leicht irritierende Enttäuschung, wo sind die 3D-Werbungen,Japan liegt nicht mehr vorne was den Futurismus angeht, I guess, nicht dass ich je in Singapur oder sowas gewesen wäre.
Doch dann, beim nächsten Mal, zur Abenddämmerung und in anhängenden und weiteren Gegenden entfaltet sich die Atemlosigkeit: Lichter, Masse, Höhe, Dichte. Die Sound-Kulisse ist gewaltig, die Straße rauscht, wird zum Meer. Man kann sich vorstellen, wie man hier auf- und untergehen kann. Meterhohe Bildschirme auf denen Werbung läuft in Bild und Ton, Protagonistinnen, die von oben mit uns sprechen, lachen, Songs deklamieren und immer wieder dieselben Claims in diese Welt aus Hochhäusern schicken, in die Straßen, über die Kreuzungen. Dann wieder winzige Shops, Bars, räudiger hier, ärmer dort, Ueno Station, jedoch immer noch alles irgendwie geordnet, organisiert, aufgeräumt. Üblich.
Automaten. Getränkeautomaten mit Limonaden oder Bier (!) oder Cold Coffee-Dosen. Manchmal einer allein, weit und breit sonst nichts, manchmal zwei nebeneinander, Brüder im Geiste, vor einem konbini. Falls der mal geschlossen hat, hat er aber nie. Automaten im Ramen-Restaurant, um die Bestellung abzugeben, Automaten mit Mikrowellengerichten auf dem Campingplatz, falls das Restaurant nicht geöffnet ist. Automaten, Automaten, der Automat charakteristisch im Straßenbild.
Das Thunfisch Nigiri auf dem Fischmarkt – media fat tuna – ist das klarste, rohste und weichste, das ich je gegessen habe. I swear. Noch.nie war ich einem Thunfisch so nah. Sorry.
Wer sich krank fühlt oder die anderen krank wähnt, trägt Maske. Man sieht sie noch viel. Besonders beim Service Personal.
Die Autos sind kleine Boxautos, sie passen noch in jede Lücke. Ich muss lachen, wenn ich sie sehe. So eins hätte ich auch gerne.
Mai 2024 – Japan im Mai – Erstes
Am Flughafen arbeiten wir den üblichen Algorithmus der Ankommenden ab: Geld abheben, Suica Card kaufen, sim-Karte erwerben.
Hinterm sim-Karten-Tresen zehn junge Menschen auf engem Raum, die bereit sind, uns behilflich zu sein. Personal kommt hier selten in der Einzahl vor.
Vom Flughafen in „die Stadt“, welche Farbe hat Japan? Links und rechts der Keikyo-Line: hell, weiß, grau. Kästchenhäuser, dicht an dicht, erstaunlich kleinteilig, zwischendurch mal was Hohes, selten was Breites, Tausende von Stromleitungen charakteristisch zwischen den Häusern, als hingen sie alle nach einem geheimen Prinzip zusammen, seien ein Organismus, als fütterten sie sich, ein logisches Gewirr aus Nabelschnüren.
Bedienungsanleitungen, Gebrauchsanweisungen, Regelwerke, Verhaltensempfehlungen, Durchsagen. Love it!
Im Apartment braucht es dann trotzdem einen Moment bis wir die Dusche zum Laufen bekommen. Hot water! in winziger Wanne nach 24 Stunden unterwegs sein.
Wir wohnen an einem kleinen Kanal. In der Abenddämmerung, wenn die Lichter angehen, stehen die Leute am Bahnübergang. Ein Ozu Film. Männer in Anzügen, Kinder in Schuluniform, junge Leute auf Rädern, Frauen mit Schirmen (Regen, Sonne).
Alles hat einen anderen pace hier. Ich werde ruhig.
Im Ramen-Laden verstehen wir: Nichts. Am Automat drücken wir auf Knöpfe mit Zeichen und hoffen das Beste. Das Beste kommt. Wir verstehen nur langsam. Beobachten, gucken ab. Der Mann neben uns holt sich gohan aus einem großen Reiskocher. Aha. Gibts for free. Die Suppe gibts in drei Varianten von thickness. Die Nudeln sind in drei Stärken zu wählen. Auf dem Tisch geheimnisvolle Soßen und Gewürze. Wir probieren uns durch. Japan ist nichts für Vegetarier
Jeder Schritt ein Abenteuer. Gleichzeitig alles total entspannt, schreibe ich nach Hause.
April 2024 – M im Heim
Jetzt ist es so weit. Alles in allem ein Glück: Eine Entscheidung, nicht generiert durch eine Katastrophe – Sturz, Erkrankung, Infarkt – sondern durch die Einsicht, dass es nicht mehr anders geht. Zwei Infektionen haben dich immobil gemacht. Es war die Entscheidung deines Mannes, der dich seit Jahren pflegt, eine Entscheidung auch über sein Leben. Du triffst lange schon keine Entscheidungen mehr über deins. Ein Platz, überraschend schnell – mit der Unterstützung von anderen, die dich seit Jahren pflegen, deine Situation und die deines Mannes kennen – im nahe gelegenen Wunschheim, also kein Auslagern an einen schwer erreichbaren Ort in irgendeine schlecht beleumundete Einrichtung.
Als ich komme, sitzt du in einem Rollstuhl am Tisch. Tief gebeugt über einen Teller, in dieser konzentrierten Art essend, die ich schon von dir kenne. Lustvoll im Grunde, das Essen als Attraktion wahrnehmend, als Ereignis. Als Aufgabe, der sich dein Körper noch immer stellt, die er abarbeitet, noch immer wissend, was zu tun ist, wenn da vor einem ein Teller steht. Du willst essen, doch es ist kompliziert, mühsam, mit all den Hürden, die dir das Besteck und deine Hände, knotig und steif, in den kurzen Weg zwischen Teller und Mund legen. Es dauert zu lange, du kannst nicht mehr ganz alleine essen. Du würdest nicht genug Nahrung aufnehmen.
Dir gegenüber und am Nachbartisch andere Frauen. Ich sehe in ihnen die Entscheidung, die jemand für sie getroffen hat. Mutti muss ins Heim, hat jemand gesagt. Wie allen sieht man auch dir an, wer du mal warst. Noch immer bist. Es lässt sich erahnen, wie du und diese Frauen einmal gewesen sind, wie sie gesprochen, gelacht, gedacht haben könnten. Wie sie aufgestanden sind, von Tischen wie diesen, rasch Dinge geholt und sich wieder gesetzt haben, als wäre es ein Leichtes. Jeden Moment könnte es passieren, denkt man, die Bewegung, die Regung ist aufgehoben in ihren Körpern, die Impulse hängen noch im Raum, als sei die Zeit nur mal kurz um die Ecke gebogen und gleich zurück. Doch es passiert nicht und wird nie mehr passieren. Die Menschen wirken wie aus dem Kontext gerissen, aus ihrem Kontext. Sie sind hier gelandet, auf diesem Planeten, ohne ihr Zutun. Sie sind abgekoppelt von dem, was sie waren und doch ist das, was sie waren, in ihnen und an ihnen noch immer präsent.
An der Kleidung, den Haaren, diesen äußeren, bei aller Egalisierung durch Alter und Pflege, sich hartnäckig haltenden Signalen von Milieus, Klassen. Man sieht auch, ob es jemanden gibt, der sich neben dem hier arbeitenden Personal noch kümmert.
Wir schieben dich in dein Zimmer, das ich hell finde, etwas zu laut, aber dich scheint es nicht zu stören. Ich reiche dir Essen. Füttern sagt man nicht. Es geht gut. Man muss sich tief zu dir hinunter beugen, um deine Augen zu sehen. Du schaust nicht zurück. Doch wenn ich lache, lachst du ein bisschen mit. Denn das hast du immer gerne getan, mitgelacht. Es hat bedeutet, dass die Stimmung gut war und hell, dass alles in Ordnung war, was du mochtest. Lachen ist ansteckend, auch das weiß dein Körper noch, in seinen Rudimenten funktionierend bis heute, also ansetzt, zu deinem Lachen. Du bekommst im Gegensatz zu allen anderen hier keine Medikamente. Wie machst du das nur?
Zufällig kommt der betreuende Arzt. Er untersucht dich nicht, spricht mit deinem Mann, lässt sich von ihm erzählen, wie es dir geht. Ich teile meine Beobachtung, dass du Kontraktionen bekommst, er erklärt, dass das im späten Stadium häufiger wird. Ob man etwas dagegen tun kann, ob er dafür sorgt, ob das Heim dafür sorgt, dass du regelmäßig bewegt wirst, wo du nun viel mehr sitzt und liegst, bleibt offen.
Als wir gehen, drehe ich mich noch einmal zu dir um. Hinter dir läuft leise das Radio. Es steht auf einer Kommode neben einer Vase mit Trockenblumen, das ist nicht das Schlechteste. So wie du, zumindest temporär, bei meiner Stimme warst, bist du nun bei der Musik des Radios. Du hältst etwas in der Hand, an dem du nesteln, das du berühren kannst. In der Küche klappert Geschirr, man hört die Stimmen der Frauen dort. Es ist schön, wenn was los ist. Doch müde macht es auch. Und wenn es zu viel ist, kann man sich nicht wehren.
Ich mache ein Foto von dir an diesem Tisch im Heim, wie immer wenn ich gehe mit der leisen Angst, dass es der letzte Anblick ist, den ich von dir haben werde.
April 2024 – Im Zug mit schöner Mutter
Ich fahre nach Süddeutschland. Ich freue mich sehr auf die Zugfahrt, ich werde schreiben! Im Zug schreiben ist herrlich, taktak taktak, da läufts immer so gut. Ich muss vorankommen außerdem, ein gutes Stück, die Fahrt ist lang, ich hab ne gute Chance, eine große Portion zu schaffen.
Alles läuft perfekt: Der Zug ist pünktlich, steht auf dem richtigen Gleis, ich entere meinen Waggon: Ruhebereich!, ich hab reserviert, kein Risiko wollte ich eingehen, beim Ticketbuchen waren mir zu viele Männchen angezeigt bei der Belegung, mein Platz ist frei. Ich sitze! Am Gang, so, wie ich es mag. Später vielleicht noch schön ins ICE-Restaurant, aber jetzt erstmal direkt hier den Laptop aufgeklappt, das Dokument geöffnet, die Finger gereckt und gestreckt, die Hände über die Tastatur. In diesem Moment höre ich von hinten Kindergebrüll. Oh nein, denke ich noch, schon nähert sich das Gebrüll unerbittlich und ein Buggy mit einem Zweijährigen, das Gesicht unschön verzerrt vor Wut und Empörung, schiebt sich genau in meine Sichtachse und … hält. Ich stöhne genervt auf, ich kann nicht anders, dem Kind praktisch direkt ins Gesicht. Dahin mein Plan, dahin die Ruhe, dahin die entspannte Zugfahrt und das Aufholen bei der Arbeit. Ich drehe mich um und sehe die Mutter, die versucht das Kind zu beruhigen, das andere, nur wenig ältere Kind, das sie auch noch dabei hat, auf den Platz hinter mir zu hieven, den Buggy zu zu klappen, das restliche Gepäck zu verstauen – und stelle erschrocken fest, dass ich sie kenne. Ich schäme mich fürchterlich. Denn natürlich hat sie mein genervtes Stöhnen gehört.
Etwas später, als sie sich installiert, das Kind sich beruhigt hat, alle auf Brezeln kauen, Getränke, Spiele, Stofftiere haben, gebe ich mich zu erkennen und wechsele ein paar Worte mit ihr. Natürlich ist sie auch noch eine Freundin von T.. Wir haben uns lange nicht gesehen, außer mal irgendwo kurz grüßend.
Sie erklärt, sie habe keine Reservierung mehr im Familienabteil bekommen. Es schmerzt mich, dass sie sich quasi entschuldigt, und mein schlechtes Gewissen wird noch größer. Sie fragt mich, ob ich immer noch Drehbücher schreibe. Worüber ich mich im Stillen ärgere. Dann frage ich sie, was sie so gemacht hat. Sie zeigt stumm auf die beiden Kinder. Du liebe Zeit, geht das alles noch peinlicher. Das wird nichts mehr mit uns heute.
Beim Aussteigen helfe ich ihr. Kind an die Hand, Rucksack auf den Rücken, ist das ein Stress und Geschleppe. Draußen stehen ihre Eltern und holen sie ab. Irgendwann hat sie mir auf einem Festival mal etwas Schönes, fast Zärtliches gesagt. Natürlich unter MDMA-Einfluss.
Als es vorbei ist, wir uns rasch verabschiedet haben und ich das Gleis hinunter laufe, um den nächsten Zug zu erwischen, stöhne ich nochmal. Diesmal ist es mehr ein Seufzen und geschieht aus anderen Gründen.
März 2024 – Post its
Die Bücher durchdringen
durchwandern
Markierungen setzen
Kleine Post its
Unterstreichung Hervorhebung Randbemerkungen
Kringel Verbindungslinie Fragezeichen
Reisen durch Räume, Orte
mit Schildern versehen
dreidimensional
wissend dass sie vergessen werden
doch für die Dauer
sind sie voller Bedeutung, Anregung
Dokument
sagt die Markierung
ich bin da gewesen ich habe das hier gelesen ich habe gedacht
kein Pfad
eine Spur
Februar 2024 – Die Rache
Ich erinnere mich, wie meine Mutter einmal, ich war Ende dreißig und seit längerem mal wieder zu Besuch, sagte: Tja, Ellichen, bald kommst du in die Wechseljahre.
Wie oft sie, hübsch verpackt, gehässig oder abwertend mir gegenüber war. Für was war das die Rache? Für ihre Enttäuschung?
Februar 2024 – Die einzige Kunst
Es ist etwas an mir
das die guten Dinge unmöglich macht
Es liegt an mir nur an mir
dass die Dinge verbrennen unter meinen Händen
dass sie verdorren
verfallen
verhungern
Das denke ich
das denken heimlich
meine Freunde
Es tut mir leid
Ich entschuldige mich
Ich höre nicht auf
die Dinge anzufassen
Es ist die einzige Kunst
Januar 2024 – Jahresanfang
1
Das neue Jahr hat begonnen. Ich freu mich drauf. Ich bin ruhig. Zuversichtlich. Ich hab Lust auf dieses Jahr. Ich weiß nicht, woran das liegt. Weihnachten und Silvester haben mich wenig beunruhigt dieses Mal.
Am Dienstag, den 2. Januar trete ich aus dem Hof (Müll) durch das große Gittertor auf die Straße. Frau L. geht vorbei, ein frohes neues Jahr, wünsche ich ihr. Das wünsche ich auch, sagt sie, vor allem ein gesundes. Da steht sie, in ihrem blauen Anorak. Keinen Zahn hat sie vorne mehr im Mund, außer einen, oben links. Sie ist schlanker geworden, ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist. Ihr Haar ist stumpf, dünn, aber es ist wieder da. Am liebsten würde ich sie umarmen. Wie sie da steht und mir ein gesundes wünscht, weil sie weiß, wie wichtig das ist, weil es das ist, was sie sich wünscht. Ein Impuls in mir schlägt vor, noch etwas zu sagen. Sind sie gut reingekommen oder gar: Wie geht es Ihnen? schießen mir durch den Kopf und für einen Millimoment stehen wir voreinander, bevor wir, bevor ich, nichts sage, und weitergehe mit meinem Großstadtschritt, immer auf der Flucht, immer auf der Jagd, immer im Vorübergehen.
In meiner Tasche liegt ein Päckchen, eins, das Frau L. früher angenommen hätte, bevor ich die Umleitung in die Filiale eingerichtet habe.
Ich weiß, dass ihr Enkelkind nachts oft weint.
2
Im Hermes Shop der auch nicht mehr ganz so junge Typ mit Knopf im Ohr, ich erinnere mich an Gespräche über seine Schulterverletzung. Auch wir wünschen uns ein frohes neues Jahr.
Wir plaudern über Wasserkocher (ich gebe gerade einen von wmf zurück), seine Frau wollte einen von Smeg, erzählt er, teuer, und er denkt sich, Ey, isn Wasserkocher, aber: Frauen halt.
Ich finde, das Jahr fängt gut an. Ich bin im Kontakt, vielleicht immer noch zu erschrocken und in Angst, wenn es passiert, aber im Kontakt. Das freut mich.
3
Später schreibe ich spontan eine Liste mit guten Vorsätzen in Anführungszeichen für 2024.
viel arbeiten
nicht so viel vom Kämpfen reden
viel unterwegs sein
viel in Kontakt treten
weniger motzen und meckern
November 2023 – Der obdachlose Mann
Der obdachlose Mann ist weg. Ich hoffe so sehr, dass es ihm gut geht. Meine Fantasie reicht von tot (tot wie Herzinfarkt, Corona, totgeschlagen) über: Seine Frau hat ihn zurückgenommen bis: Er hat Hilfe von einer Einrichtung bekommen und jemand hat ihm Wohnung und Arbeit verschafft. Jedes Mal, wenn ich an seinem Platz vorbeigehe, muss ich an ihn denken.
Sein Husten war so schlimm.
Oktober 2023 – Kreischende Mädchen
Ein Autor aus dem Bekanntenkreis hat ein Sachbuch über Popmusik geschrieben. In einem Absatz über die Beatles erwähnt er im Zusammenhang mit ihren Konzerten die „kreischenden Mädchen” im Publikum. Nach der Lektüre des Manuskripts haben die Lektorinnen ihn um Änderung dieses Ausdrucks gebeten, sie fanden ihn misogyn. Statt „kreischende Mädchen” steht dort jetzt: „jubelnde Menschen”.
Ich verstehe sehr gut, dass man als Lektorin am Ausdruck „kreischende Mädchen” hängen bleibt. Er macht einen verdächtigen Eindruck. Er wirkt überholt und abwertend. Im Rahmen der Beatles Rezeption ist er in den 60er Jahren aufgetaucht und zu einem nicht mehr hinterfragten Allgemeinplatz geworden, beziehungsweise zu so etwas wie einem stehenden Begriff. Einem Begriff, der versucht hat, ein damals neues, in Zusammenhang mit den Beatles auftretendes Phänomen zu fassen zu kriegen, das die Öffentlichkeit beschäftigt hat. Eine Form spezifisch weiblichen Fantums nämlich, das charakteristisch wurde für die Konzerte der Beatles: Junge Frauen schrieen begeistert und ekstatisch.
(Wer das Phänomen aufs Maximale reduziert erzählt bekommen möchte, schaut sich E10 von S4 von Mad Men an. Don Draper schenkt seiner Teenager-Tochter Sally, eine von vielen großartig erzählten Frauenfiguren der Serie, ein Ticket für ein Beatles Konzert: Watch her reaction!)
Sie fügten dem Konzert vom ersten bis zum letzten Moment ihren eigenen unüberhörbaren Soundtrack hinzu. Auf jeder Live-Platte der Beatles haben diese weiblichen Fans sich verewigt, auf jedem Foto von Beatles Konzerten sind sie zu sehen, junge Frauen mit weit aufgerissenen Mündern, eng aneinander gedrängt, ganz vorne an der Bühne, die Haare nass vom Schweiß, die Gesichter verzerrt. Diese jungen Frauen hielten mit der sensuellen Erfahrung, die die Musik, aber auch die physische Anwesenheit und Nähe zu den lange vor dem Konzert von weitem begehrten Musikern nicht hinterm Berg. Sie äußerten sie. Sie äußerten sich! Sie schrieen ihr Erleben, ihre Lust heraus und etablierten eine weibliche Fankultur, die sich an der Ekstase, dem Begehren, dem Gemeinschaftskörper und der Nähe zur Ohnmacht, zum Außer-sich-sein erfreute. Diese Frauen brachten sich lauthals in einen popkulturellen Zusammenhang, sie wurden (von Männern) diskutiert, fasziniert abgebildet und mit den vielen, man kann sagen, üblichen Varianten der Ablehnung bedacht. Man war entsetzt über den Sittenverfall der Frauen (der weibliche Fan als Beinahe-Prostituierte), machte sich lustig über sie, erklärte sie wahlweise für einfältig oder verrückt (Hysterie), und äußerte die Sorge, dass die jungen Frauen mit diesem Verhalten ihre Gesundheit (im Falle von Frauen gerne mit Gebärfähigkeit gleichgesetzt) gefährdeten. Das nützte freilich alles nichts, im Gegenteil, die Beatles betraten die Bühne und zuverlässig kreischten die Mädchen. Sie durch “jubelnde Menschen” zu ersetzen, kommt mir vor, als lösche man sie aus, ihr Begehren, ihre Lust, ihr Beharren auf ihrer Kultur der sinnlichen Erfahrungsäußerung, als lösche man also einmal mehr Frauen aus.
Zerlegen wir den Ausdruck vorsichtig in seine Einzelteile. Kreischen. Ein Schreien, das ins Schrille geht, ins Misstönige, ein Schreien, das aus dem als normal empfundenen Schreien kippt. Wer kreischt, ist „drüber“, in einer außergewöhnlichen, existentiellen Situation. Kreischen wird spezifisch Frauen zugeschrieben und das lässt sich tatsächlich kritisch betrachten. Über das weibliche Kreischen im Horrorfilm sind Magisterarbeiten geschrieben worden, die Frau als Opfer, als Scream Queen, als Schaulust-Objekt einer durch den bedrohlichen Mann oder „das Wesen“ ausgelösten puren physischen Reaktion.
Männer kreischen nicht. Sie johlen, grölen, brüllen. Aber kreischen, bewahre, kreischen ist weiblich und welcher Hetero-Mann möchte schon weiblich, sprich: schwul sein.
Im Englischen liegen schreien und kreischen im Verb „scream“ nah bei einander, möglicherweise hat auch die Übersetzung der screaming girls zu den kreischenden Mädchen beigetragen. Doch kreischen ist etwas anderes als schreien.
Sollten Frauen also aufhören, sich derartig zu äußern, weil es als „weiblich“ verpönt ist? Oder sollten Jungs ins Kreischen mit einstimmen?
Menschen zu schreiben statt Mädchen, könnte man gutwillig als Versuch interpretieren, alle mit reinzuholen und zu setzen, dass auch Männer beim Beatles Konzert gekrischen haben. Allein, das haben sie nicht. Sicher wird es den ein oder anderen gegeben haben, aber zum Phänomen hat es nicht gereicht.
Jubeln, das Verb, das nun im Buch steht, tut man vor Begeisterung. Man jubelt jemandem zu, man bejubelt jemanden, aber mit Sinnlichkeit oder Ekstase hat diese Form der Äußerung wenig zu tun. Es erinnert gar an die „jubelnde Masse“, die wir aus dem politischen Kontext kennen. Gejubelt haben die jungen Frauen auf den Beatles Konzerten nicht.
Mädchen. Früher ging das Wort leichter von der Hand, das Mädchen war deutlich langlebiger als heute. Wer heute Mädchen sagt, und eine Frau ab 16 meint, wird korrigiert: Junge Frau. Das klingt deutlich respektvoller, nimmt die Frau ernst, macht sie nicht klein. Es gab eine Zeit in den Neunzigern da war das Mädchen, genau wie das Girl, das Girlie, etwas positiv besetztes. Mädchen feierten ihr Mädchensein, sie hatten gar keinen Bock darauf, Frauen zu sein und die Erwartungen zu erfüllen, die man an Frauen stellt. Mädchen nahmen sich buchstäblich etwas heraus aus dem Frausein, sie beharrten auf ihrer spezifischen Girl Culture und weigerten sich gleichzeitig – Punk Girl, Riot Girl – ein angepasstes Mädchen zu sein. Sie wollten Mädchen bleiben – wild und gefährlich, so ein Pippi Langstrumpf-Postkartenspruch der Zeit, aber eben auch zart und verletzlich. Irgendwo zwischen Butlers Gender- und Cixous Differenzfeminismus wollten sie nichts Festes sein, sondern, wie man heute sagen würde, etwas Fluides, ein Wesen zwischen den Welten, das sich bewegt und wächst, das nicht angekommen ist, das Röcke tragen und Schlagzeug spielen darf. Begriffe haben ihre Geschichte, ihre Geschichten, ihre Zeit.
Vielleicht hätte man eine andere Umschreibung finden können – ekstatisch schreiende junge Frauen? Vielleicht hätte man die kreischenden Mädchen mit Anführungszeichen versehen, sie als Begriff im Kontext führen können und ihnen eine Fußnote mit Erläuterung zur Geschichte des Ausdrucks und des Phänomens hinzufügen können? Die Entscheidung aus ihnen „jubelnde Menschen” zu machen scheint mir eines der Beispiele zu sein, wo der Versuch, Frauen gerecht oder gerechter zu werden und die Misogynie, die in so vielen Begriffen virulent ist, nicht fortzuschreiben, dazu führt, Frauen zu verleugnen und sie, statt ihre Kultur und ihr Begehren festzuhalten und sichtbar zu machen, erneut ins Unsichtbare der (Pop-)Geschichte verschiebt.
Es ärgert mich, dass Lektorinnen so etwas tun.
Oktober 2023 – Wer was will, soll kommen
Mann und Frau. So sitzen sie. Nebeneinander auf Stühlen und Bänken, an Tischen. Der Mann nach vorne ausgerichtet, die Fläche des Stuhls voll ausgenutzt, die Knie geradeaus, den Rücken an Lehne oder Wand. So schaut er. Nach vorne. In die Welt.
Die Frau, an den vorderen Rand des Stuhls gerutscht, den Hintern auf Kante, in der Körpermitte die leichte Drehung nach rechts. In Richtung Mann. So schaut sie, zu ihm. Das Signal: Zugewandtheit, Aufmerksamkeit. Sie sprechen. Sie: Eine Berührung am Oberschenkel, am Unterarm, je nachdem, ein Streicheln über Wange, Ohr, durchs Haar. Betrachtung des Mannes beim Sprechen. Des Mann-Mundes. Der nach vorne spricht.
Im Bett genauso. Der Mann an die Wand gelehnt, die Beine ausgestreckt. Keine Berührung, keine Rührung. Das Signal: Wer was will, soll kommen.
Wie satt ich das habe. Ich setze mich: Nach vorne ausgerichtet, den Hintern volle Füllung auf der Stuhlfläche, die Knie geradeaus, den Rücken zur Wand. Ich rühre mich nicht. Wer was will, soll kommen.
Es kommt niemand.
Oktober 2023 – Notiz 6
Ich verharre in mir
Große Wünsche
still halten
Oktober 2023 – Kinderwelt
Neben mir im Ikea Restaurant, zwei Schülerinnen, ca. 15. Eine bekommt eine Nachricht aufs Hand. Von der Schule. Sie soll nicht kommen, Amokalarm, ein verdächtiger Schüler lief auf dem Gelände herum, die nächsten zwei Tage ist keine Schule. „Klassenarbeit fällt aus!“ jubelt sie. Die Freundin ihr gegenüber: „Fick dich.“
Sie erzählt, was man machen muss, bei Amok, in den Räumen bleiben, auf den Boden legen, in der Schule gibt es drei Stockwerke, einen Keller, da und dort sind die Notausgänge. Sie kennt sich aus. Es gab ein Training. Bombenalarm und Amok hatten wir schon, sagt sie. Bombe einmal in der Grundschule.
Ein Anruf. Wieder die Schule. Sie muss in eine andere Schule für die nächsten Tage, irgendwo in Neukölln. Bummer! Die Freundin futtert ihr Hühnchen-Gericht. Sie hat die Arme schwer zerschnitten, eine Schneiderin, tiefe Narben im Unterarm.
Kinder, was für eine Kinderwelt.
Oktober 2023 – Buch
Sie streicht, ohne den Blick von den Buchstaben zu lassen, mit dem Daumen am unteren Rand des aufgeschlagenen Buches entlang, um zu spüren,
wieviel sie schon gelesen hat,
und wieviel noch kommt.
Ist das Buch mühsam oder ist es toll zu lesen?
Wackel September 2023
Okay, diesmal:
Eine Krähe frisst die Eingeweide einer toten Ratte. Mein Würgreflex macht sich bemerkbar.
Oktober 2023 – Wespe
Eine Wespe setzt sich auf U.s hellgraue Jacke, die auf dem Tisch im Café liegt. Ich beobachte sie, wie ich diesen Sommer oft Wespen beobachtet habe. Kürzlich hat sich eine bei mir auf den Unterarm gesetzt. Sie hat einen Tropfen Wasser entdeckt, der dort vom Baden noch lag. Sie ist darauf zu gekrabbelt und hat ihn getrunken. Das war wunderschön. Ich hab mir vorgestellt, wie er aus ihrer Perspektive ausgesehen haben muss.
Die Wespe auf Us Jacke sieht wie alle Wespen seltsam aus, diese superdünne Sollbruchstelle in der Mitte, gruselig. Plötzlich reckt sie sich seltsam, die Bewegung kommt mir bekannt vor, tausend Mal hab ich sie gesehen, bei Mensch und Tier, so ein breitbeinig spreizige Bewegung, so ein Aufrichten des Rumpfes, und plötzlich fällt aus dem spitzen Ende ihres Körpers ein hellbraun-graues Kügelchen auf die Jacke. Ich bin verblüfft. Wespenkacke! Sowas hab ich noch nicht gesehen. Die Wespe entfernt sich umgehend. Das Krümelchen bleibt. Es ist winzig und unauffällig, aber eben doch ein sichtbares Krümelchen, dass ich mich frage, wie oft ich schon Wespen-Shit auf dem T-Shirt, in den Haaren und im Essen hatte, ohne es zu bemerken. Aber klar, auch ne Wespe verdaut.
September 2023 – Notiz 5
Und was machst du so?
Ich mache mir schriftlich Gedanken
September 2023 – GenX vs Boomer
Ich schnappe einen Fernseh-Schnipsel auf. Talkshow. Eine ältere Frau (besetzt für die Rolle des Boomers) und eine junge Frau (besetzt für die Rolle der GenX) sitzen in ihren Sesseln an den äußeren Rändern der Sitzreihe. Die Boomerin faucht rüber:
Mädchen, ohne mich würdest du gar nicht hier sitzen!
Sie hat so recht.
Aber so gehts natürlich auch nicht.
September 2023 – Löwenmutter
Gesprächsfetzen im Vorbeilaufen, eine Mutter, rundlicher Typ, im praktischen Parka, neben sich ihre kleine Tochter, vielleicht sieben Jahre alt. „Wenn dich einer anfässt“, sagt die Mutter mit Verve in der Stimme zu ihrem Kind, „ich bin sofort in der Schule!“
Mich beeindruckt das. So eine Löwenmutter, die anderen Kindern die Meinung geigt, wenn sie einen ärgern oder verprügeln, die Männern die Eier abklemmt, wenn sie einem sexuelle Gewalt antun, und Lehrern was hustet, wenn sie einen unfair behandeln, alle, alle müssen sich in Acht nehmen, vor so einer Mutter, die mit geballter Faust in die Schule läuft, wenn was vorgefallen ist, auf und abgeht, vor dem Zimmer des Rektors und dann reinstürmt, die beschwert, ihr Kind verteidigt, es raushaut, sich die Bösen vorknöpft, sich wehrt und empört, herrlich muss das sein, so eine Mutter zu haben, die nichts auf dich kommen lässt und keine Angst hat, sie alle auszulöschen, die Punks und Feinde da draußen, denn du bist ihr Kind, und deshalb, sei versichert, sei sicher, Hören und Sehen wird ihnen vergehen, Mama macht tamtam.
Das Kind guckt komisch bei dieser Ansage. Möglicherweise kann einem so eine Mutter auch unangenehm sein.
September 2023 – die Geräusche
Sie werden in unseren Ruinen nisten
und auf unseren Balkonen schlafen
Gras wird über uns gewachsen sein
das sie grasen werden
Sie werden unsere Dächer besiedeln,
unsere Wohnungen, Straßen und Läden.
Die Höhlen, die wir geschlagen haben
werden ihre sein.
Wir werden verbrannt sein verdurstet überflutet erlegen
wir werden ihr Leib werden, ihre Fäkalie
von ihren Kämpfen werden wir
keine Ahnung haben.
Die Geräusche
werden andere sein.
September 2023 – sagen / denken
Leute, die sagen: Ich sage, was ich denke!, sind die Schlimmsten.
Bevor man sagt, was man denkt, ists gut, wenn man was gedacht hat, bevor mans sagt.
September 2023 – Zeit / Wunde
Die Zeit heilt gar nicht alle Wunden
es wächst nur Gras über sie.
Tritt man rein,
ist darunter alles weich
wie Schlamm
Man sinkt ein
muss aufpassen
dass man schnell wieder rauskommt.
Die Zeit ist eine Wunde.
September 2023 – Notiz 4
Traum mit T.
Wie immer noch immer
Die Begegnungen werden versöhnlicher,
es gibt Übereinkünfte, Lächeln
und dennoch
Küsse
September 2023 – Fett
Mein Körper setzt sich
in sich selbst wie in ein
Kissen.
Er macht es sich bequem auf
seiner eigenen Couch –
ich habe dabei nichts mehr zu sagen.
September 2023 – Im Zug
Im Zug zurück nach Berlin
Die Wiesen fahren vorbei
so grün wie lange nicht
Es hat viel geregnet.
A. denkt über die Anschaffung einer Photovoltaik-Anlage nach.
September 2023 – Auf dem Land
Keine Ereignisse heute
sagt mein Kalender
und das bei 30 Grad im Liegestuhl.
Gibts was Schöneres?
Misstrauen bleibt.
September 2023 – Klima
These: Die Klimaanlage im ICE ist für Männer gemacht.
Alle Frauen frieren. Männer auch, aber die tun so, als ob nichts wär.
September 2023 – Zeit Shop
Ich blättere das Magazin des Zeit Shops durch.
Mit solchen Leuten will man nichts zu tun haben.
September 2023 – dissoziiert
Kürzlich folgende Situation: Ich will zu einem Treffen, viele Leute werden dort sein, ich hab Lust darauf, ich hab anderen davon erzählt, ich bin aufgeregt, ich kenn noch niemanden dort, ich stelle mir vor, wie ich jemanden kennen lerne, den ich nett finde, mit dem ich sprechen kann, es wird gut tun, nicht so viel allein zu sein, alles wird gut, dort sind Menschen, die die gleichen Themen haben in ihrem Job, es ist wichtig, sozial zu sein, sich da hin zu bringen, zu diesem Treffen, auch wenn man Angst hat.
Ich mache mich auf den Weg. Ich komme am verabredeten Ort an, ich suche die Gruppe. Ich sehe eine Gruppe von Leuten draußen vor der Kneipe und frage mich, ob sie das sind. Ich gehe rein, in die Kneipe, vielleicht sind die ja drinnen, ich hatte es so verstanden, aber drinnen ist es sehr eng und klein, da ist niemand. Dann müssen die das wohl sein, aber es gibt noch andere Gruppen, die da drüben? Ich checke die Leute, eher nicht, also doch die, ich laufe in Richtung der Gruppe, ich überlege mir im Kopf, was ich sage, scanne die Gruppe, wen spreche ich an, diese Frau, den Mann, die Gruppe ist kleiner als gedacht, die Leute sitzen um eine Bierbank herum, sie sprechen miteinander, bei wem bleibe ich stehen, ein paar Leute sehen mich an, ich laufe hier schon zum zweiten Mal vorbei, schaue mich suchend um, ich geh da jetzt hin, ich gehe da jetzt hin, ich spreche die jetzt an
– ich gehe an der Gruppe vorbei.
Ich gehe weiter, schneller, ich bin weg. Ich bin gegangen. In mir Aufruhr. Das gabs noch nie. In diesem Ausmaß. Ich habe Gruppen ganz sicher schon oft gemieden, vermieden, bin auf dem Absatz umgedreht, weil Besser nicht, ich schaffs nicht gewonnen hat, ich bin auch schon in Gruppen gesessen und offensichtlich verhaltensauffällig verstummt, habe nichts gegessen, mich aufgelöst. Aber diese Menschen haben mich gesehen, wie soll ich ihnen beim nächsten Mal unter die Augen treten, und es wird nächste Male geben, zumindest mit einzelnen von ihnen, was soll ich sagen, wenn sie mich wiedererkennen, wie kann ich das Wegflunkern, wie big müsste diese Ausrede sein? Ich habe mir vor diesen Menschen die Augen zugehalten und wie ein Kleinkind gesagt: Ich bin nicht da.
Ich mache mir Sorgen um mich.
G. sagt, das ist nicht so schlimm.
Ich glaube schon.
September 2023 – Krähe
Okay, diesmal:
Eine Krähe hackt auf dem Gehweg die Eingeweide aus einer toten Ratte. Mein Würgereflex macht sich bemerkbar.
Berliner sind einfach hart. Auch die Tiere.
August 2023 – Coworking in Brandenburg
RE7 Richtung Dessau. Unter der Woche, erstaunlich voll. Erstmal blute ich ab Höhe Wannsee den Zug voll: Nase. War die letzten Tage erkältet. Handy, Geldbeutel, Hände, Armreif, Buch, Tisch, Armlehne, alles voll mit roten Tropfen plus splashs drumherum. Eine Freude für jeden Ballistiker. Die Laptop-Frau mir gegenüber tut, als sehe sie nichts. Ich bin ihr dankbar.
Ich krame nach einem Taschentuch, dafür muss ich die Nase loslassen, jetzt ist auch noch die frisch angezogene Hose voll. Ich drücke und versuche mit kühlem Wasser, das ich am Bahnhof gekauft habe, die Blutung zu stoppen. Klemme und klettere mich durch bis aufs Klo, die Leute stehen und sitzen im Gang rum. Die Zugführerin fragt netterweise, ob ich Unterstützung brauche, eine Frau mit etwa 5jähriger Tochter gibt mir ein Taschentuch und sagt, manchmal hilft es, das unter die Zunge zu legen. (Diesen Tipp hab ich von allen echt noch nicht gehört, probier ich aber erst das nächste Mal.) Das erste Klo ist besetzt, im zweiten geht das Wasser nicht. Dafür gibts Papier.
Es hört ewig nicht auf, an Lesen ist nicht mehr zu denken, ich bin mit Papier auf die Nase drücken und hoffen, dass ich bald da bin, beschäftigt.
Bus 555. Ich bin die einzige Mitfahrerin, talke ein bisschen mit dem Bussifahrer, Bussi indeed, er ist 70, wie er mir stolz verrät, der Bus wird von einem Verein betrieben, sie sind alle Rentner, im Moment elf, das reicht gerade so, aber sie suchen wieder – ich mach mir wie immer bei offenen Stellen gleich mal ein bookmark hinter die Ohren. Bussifahrerin in Brandenburg, falls es mit dem Schreiben nicht klappt.
Weil sie auch Rufbus machen, frage ich ihn, wie das funktioniert, ob ihn da die Zentrale anruft oder so. Krieg ich alles hier drauf, er zeigt auf das Display vor sich, hier ist der ganze Plan. Cool. Er wirkt happy. Der Bus ist aber auch echt cute, acht großzügige Plätze. Ich frage, wie viele sie haben, das versteht er erst gar nicht. Na, einen! Die sind teuer! Wir fahren Bad Belzig Krankenhaus, Bad Belzig Marktplatz, wirkt alles recht pretty, kann man mal ins Eiscafé. Dann raus: Landstraße. Felder links rechts, Ortsschild Klein Glien. Das Haus da vorne ist es, sagt er, wenn sie dahin wollen? Will ich.
Arbeiten im Garten.
Grashüpfer. Fällt mich plötzlich von rechts an. Sitzt auf meiner Schulter. Bemerkt, erschrocken wie ich, den Irrtum, hüpft auf den Stuhl neben mir. Verarbeitet kurz. Von da aus weiter. Schmeißfliege. Sehr strange, fett, mit gelbem Kopf, noch nie gesehen, setzt sich auf nackten Oberarm. Weiter.
Wie sie alle mal vorbeikommen.
Rechts drei Falter, mausgrau vor weißer Hauswand, die sich allerliebst umtanzen, ein Schelm, wer nicht an Disney denkt.
August 2023 – Schöne Frauen
Schöne Frauen lösen Sehnsucht in mir aus.
Schöne Frauen sind nicht schön. Eher apart oder besonders oder gut gekleidet. Gut gekleidet spielt überhaupt eine wichtige Rolle bei schönen Frauen. Schöne Frauen sind jung oder alt. Die Sehnsucht nach ihnen ist leise und unbestimmt. Ein melancholisches Ziehen. Was ist das?
Es ist nicht so, dass ich die Strecke bis da drüben, bis dorthin, wo die schöne Frau sitzt, steht oder lehnt, zuhört oder gestikuliert, gerne überbrücken würde. Dann wär das Ziehen weg. Dort, wo sie sitzt oder steht, sitzt oder steht sie gut.
Ich wäre ihr nur gern nah. Ich wäre nur gerne wie sie. Ich wäre gerne eine schöne Frau, alles wäre leichter. Es ist mir nicht gegeben. So zu sein wie sie. Das ist es, wonach ich mich sehne. Die schöne Frau ist eine Möglichkeit, eine der vielen Möglichkeiten. Zu sein. Wie sie.
Ich sehe sie und sehne mich. Ich sehe sie, wie ein Mann sie sieht, ich sehe, wie ein Mann sie sieht, ich sehe, wie ein Mann sie sehen könnte. So wie ich. Ich betrachte die schöne Frau. Ich schau nach ihr, immer wieder. Heimlich. Verstohlen, hole ich mir etwas von ihr, ihrer Idee.
Wenn ich nur bei ihr wäre, in ihrer Nähe, ihr nah. Dann wäre ich gesünder, es ginge mir besser, man hätte es leicht mit mir, so schön wäre ich, so leicht. Ich wäre aufgehoben. Im Club der schönen Frauen. Ein Club, der da ist, auch wenn er sich nicht trifft. Die schönen Frauen sind allein. Sie brauchen niemanden. Sie sind mit anderen, aber sie brauchen niemanden. Ich sehne mich nach ihrer Ruhe, ihren Gedanken, ihrem Wissen, ihrer Balance, ihrer Autarkie. Ich sehne mich nach ihnen wie nach einem anderen Ich. Nach einer Freundin. Einer Mutter. Meine Sehnsucht ist die nach einer Mutter. Einer schönen, klugen, starken, selbständigen Frauen-Mutter. Eine Sehnsucht nach einem Bild vor mir, einem Vor Bild. Nach einer Mutter als Ort. Eine Mutter, die dort drüben steht und lehnt und gestikuliert. Eine Mutter, die frei ist und verbunden. Mit mir, mit anderen. Es ist diese Sehnsucht, die tief in mir vergraben ist, die sich über eine Leerstelle beugt, wie eine Brücke über einen tief unten liegenden See.
August 2023 – Schlägerei im Freibad
Super annoying wie der Rassismus-Trick es mal wieder schafft, dass es nicht um das geht, worum es geht. Fakt ist doch, da macht jemand öffentliche Räume kaputt, Gemeingut, Allmende. Räume, die für alle da sind, die wir uns teilen, die eine Form von Kultur und Bildung und Lebensqualität ermöglichen, die aus Steuern bezahlt wurden, Geld also, das wir ausgegeben haben, damit diese Räume da sein können. Bibliotheken, Bushaltestellen, Sitzbänke, Spielplätze, Parks! Räume, die ständig bedroht sind, weil noch jede Partei an der Macht es geschafft hat, sie kaputt zu sparen, sie so lange verfallen, verfaulen, verschimmeln, vertrocknen zu lassen, sie zu desorganisieren, mit Verachtung zu strafen, sie im Stich zu lassen, sie als Spielball für ihre politischen Zwecke zu nutzen, um sie dann zu verteuern, zu schließen oder – all time classic – an einen Investor zu verkaufen. Weil der Bürger ja die FREIHEIT haben soll, ins 25-Euro-Spaßbad zu gehen. Wo ist die Linke, wo sind die Grünen, wo von mir aus die doofe SPD, hat denn keiner die Eier einfach mal zu sagen, das geht nicht, dass jemand diese Räume angreift. Muss das dem CDU-Typ, dem Pächter und Wächter der Ressentimens überlassen werden, der das im Gestus des Big Aufräumers macht, des Law-and Order-Mackers, des Werte-Vertreters. Sorry, warum macht ihr das nicht? Einfach mal sagen, mit Schlägereien Angst und Schrecken verbreiten, Kinder und Erwachsene einer ausschließenden, gewaltvollen Atmosphäre aussetzen, sogar einer Gefahr, das Freibad in Verruf bringen, sodass sich keiner mehr hintraut, das geht gar nicht, das ist nicht gemeinschaftlich, nicht sozial, nicht solidarisch gedacht, und das ist ein Wert, den wir vertreten und den lassen wir uns nicht von den Ressentiment-Geiern wegnehmen, verdrehen, umschreiben? Und ja, uiuiui, wer wagts zu sagen, klar muss das bestraft werden. Schwimmbad is dann eben nich mehr diesen Sommer, hast du dir verkackt, oder mach ma dreimal Eispapier-Aufsammeln oder Rasen mähen oder Becken säubern, dann kannst du wieder rein. Und überhaupt, wieso macht keiner mal eine Bemerkung über Steuern, wieso kann man das nicht links stark machen, anders besetzen – das ist Geld für die Gemeinschaft, das ist Geld für Gehwege und Zebrastreifen und Kitas und Brunnen und Mülleimer und Parks, das ist Geld, das für uns da ist, für die Gemeinschaft in der wir leben und deshalb kann man auch Respekt und Rücksicht dafür einfordern, von der Politik und von allen. Schietegal übrigens, ob man diese Einrichtungen nutzt oder nicht (noch so ein Nerv-Argument, ich geh nie ins Freibad, ich fahr immer an den See … Was heißt das, Freibad schließen is mir egal?). Immer rennt man hinterher, wenn einem die Gegenseite den Rassismus-Knochen hinwirft, sodass man sich dann im Abgrenzungsmodus daran abarbeitet, statt das Freibad-Thema selbst zu besetzen?
August 2023 – hier
Ich lese nie, was ich hier geschrieben habe.
Zu peinlich, zu schmerzhaft, die Gefahr zu groß,
dass ich alles lösche,
ändere,
verfluche.
August 2023 – Die Löwin
Die Löwin ist ein Wildschwein. Ich bin, wie alle, enttäuscht. So herrlich wärs gewesen. Tagelang noch nämlich, hätte die Löwin die Polizei an der Nase herumgeführt. Sich hinter Mülltonnen, in Parks und auf Bäumen versteckt. Ihre Spuren hinterlassen in Hauseingängen, vor Spätis, in Gartenkolonien. Hier sieht man deutlich, hat sie sich gekratzt, hier hat sie geschlafen, nach Löwinnenart. Bestimmt wäre sie bis Neukölln oder Kreuzberg gekommen. Auf dem Weg hätte sie einen Hund gefressen, einen Dackel. Oder einen Chihuahua. Bestimmt hätte sie ein Kind angefallen oder einen Rentner oder wäre zumindest sehr nahe an einem Spielplatz vorbeigekommen oder direkt vor einem Seniorenheim von einer Bewohnerin mit dem iphone gefilmt worden. Und ganz sicher hätte sie am Ende einem Clan-Chef gehört. Der die ganze Zeit nicht die Eier gehabt hat, den Ausbruch der illegalen Löwin aus seiner dekadenten Luxusvilla der Polizei zu melden. Einer Villa, wie wir gesehen hätten, voller weißer Kunstledersofa-Landschaften und mannshoher Porzellan-Löwinnen und Frauen mit Lippen und Fingernägeln vollgestopft war. Ein Clan-Chef, der endlich in den Knast gekommen wäre, nun absurderweise wegen unangemeldeter und nicht artgerechter Löwinnen-Haltung, nachdem ihm wegen Drogen, Immobilien und Zwangsprostitution jahrelang keiner was anhaben konnte. Bestimmt hätte ein Polizeibeamter am Ende das Feuer auf die Löwin eröffnet und sie erschossen, der Spacko! Intern hätte er dafür eine Urkunde und einen neuen Computer bekommen, aber erstmal hätte er vorübergehend untertauchen müssen. Um Shitstorm und Morddrohungen zu entgehen, weil er das edle Wildtier erledigt hat. Statt den Jäger, plötzlich als Tierversteher erkannt und gefeiert, ranzulassen, der der Raubkatze eine sanfte Betäubungsspritze in den Hintern verpasst hätte, wenn auch nicht aus Johanniskraut-Extrakt wie von anderen Tierverstehern empfohlen. Um die Löwin dann schonend in den Zoo zu transportieren, wo sie glücklich und von den Berlinern in all ihrer schnauzigen Herzlichkeit geliebt, und nach einem Namensvorschlags—Wettbewerb der Morgenpost Leonie genannt, im Eigenuringestank des Löwengeheges bis an ihr Lebensende gelebt hätte und darüber hinaus als Präparat im Naturkundemuseum.
Oder: Es wäre klar geworden, dass die Löwin aufgrund des Klimawandels ihre Heimat verlassen hat und auf der verzweifelten Suche nach Nahrung und einem sicheren Ort, um ihr Kind zu gebären (neues Video enthüllt: Löwin schwanger!), bis nach Deutschland gewandert ist und es sein kann, dass wir uns darauf einstellen müssten, dass sie nicht die letzte gewesen sein wird. Und überhaupt auch möglicherweise der Vater des Kindes noch irgendwo rumläuft!
Egal was, alles wäre besser gewesen als: Ein Wildschwein.
Vor allem für den RBB, der endlich mal alles hätte vergessen können, was ihn in letzter Zeit so belastet hat, der, nicht wie jetzt nur in Ansätzen, sondern Twentyfourseven zu seiner eigentlichen Aufgabe hätte zurückfinden können, der Vor-Ort-Berichterstattung. Im bewährten Konzept von Information als Redundanz, wenn es keine Information gibt, ist das die Information, wenn es keine Geschichte gibt, hätte es eine geben können oder wird es möglicherweise noch eine geben (Wir stehen hier vor dem Baum, auf dem die Löwin zuletzt gesehen worden sein soll.) Wir hätten erleben können, wie Unser-Reporter-vor-Ort, ein junger Mann oder eine junge Frau, bisher beim Sender nicht groß in Erscheinung getreten, nun non stop und live vor der Kamera an den Herausforderungen der erforderlichen Spontaneität wächst, aufblüht geradezu, sympathisch wird in der persönlichen Verausgabung der auch noch nachts und in den frühen Morgenstunden vorgetragenen Berichterstattung, während andere Leute in seinem Alter im Club sind. Der an Orten steht, vor Hintergründen, aus denen jederzeit die Löwin hervorspringen könnte, um den talentierten, sich für uns ins Risiko begebenden Jung-Reporter vor unser aller Augen anzufallen, und der, nach Abklingen der Löwinnen-Geschichte von einem Privatsender zunächst für die Morning-Show, dann für die Kriegsberichterstattung aus einem abendfüllenden Krisengebiet abgeworben werden wird, wie also obendrein noch der Bewährungsprobe eines jungen Menschen und dem Beginn einer wundervollen Karriere beigewohnt haben. Aber nein. Eine schnöde Wildsau musste es sein. Dennoch: Es bleiben Fragen. Warum dauert eine Bildanalyse bei der Berliner Polizei eigentlich so lange? Warum eine Haaranalyse noch länger? CSI, Berlin, hallo! Also wenn die immer so lange brauchen, wenn was wichtig ist, dann gute Nacht. Typisch B. Da macht man doch auch mal Überstunden im Haaranalyse-Raum, wenn was Priorität hat, das kann man ja wohl erwarten, dass sich da mal jemand die Nacht um die Ohren schlägt, sowas ist doch Chefsache!
Ach, seufz.
Und was ist jetzt eigentlich mit dem Wildschwein? Um das kümmert sich natürlich mal wieder keiner. Denn dass das normal ist, kann einem doch auch keiner erzählen, dass die Wildschweine jetzt aussehen wie Löwen.
Na gut.
Dann eben wieder Ukraine und Ampel.
August 2023 – wie Weihnachten
Der Sommer fühlt sich an wie Weihnachten. Alle sind weg, das Wetter ist mies und mein Plan zuhause zu bleiben und Berlin zu genießen, fühlt sich an wie eine selbst gebaute Depressionsfalle ohne challenge-Charakter, idiotisch,
abgehängt, ausgebremst, selber Schuld.
August 2023 – Regen, non stop
Wenn noch einmal jemand sagt, aber für die Pflanzen ists ja gut, fang ich an zu schreien. Ich bin auch ne Pflanze, ich brauch Sonne! Das ist doch gleich schon wieder alles zu Ende, dann muss ich wieder Monate lang aushalten, bis die Wärme kommt!
August 2023 – Medis
Es kann doch nicht sein, dass es kein Medikament gibt, das mich aus der Depression rausholt, irgend so eine happy pill, von der man ständig liest, wie es sie in den USA gibt. Typisch, dass die Deutschen sowas nicht verschreiben, evangelische Arschklemmer. Die Psychiater bei Doctolib sehen aus wie Kinderschänder und sind nur auf Privatzahlbasis.
Juli 2023 – Barbie
Die heimliche Hauptfigur in Barbie ist Ken. Er ist die eigentlich interessante Figur in dieser Geschichte. Zusammen mit den anderen Kens, diesem sich selbst kommentierenden griechischen Chor, seiner GANG, der gesamten MANNSCHAFT, bringt er die Geschichte in den Film, die wir noch nicht kennen, die in die Zukunft weist, die Fragen aufmacht. Die andere Geschichte, die um Barbie, kennen wir – nicht zu Genüge, beileibe nicht, dazu sind noch immer zu viele überrascht oder wollen sie einfach partout nicht hören. Barbie erzählt vom klassischen Dilemma des Frauseins in a mans mans world und dem Versuch, sich in ihr zu emanzipieren – manchmal etwas zu sehr auf die Zwölf durchverbalisiert von der von America Ferrara gespielten Figur Gloria, manchmal etwas zu hollywoodig verkitscht und Matell getönt in der Mutter-Tochter-Beziehung in Barbies Begegnung mit ihrer Schöpferin. Vor allem aber erzählt der Film herrlich trocken und doch warm, mit großem Spaß an Popkultur, in der er sich verspielt und unbekümmert bewegt. In ADHsartiger Geschwindigkeit feuert Barbie Ideen, Gags und Punchlines ab, lässt Szenenbild und Kostüm Feste feiern und verliert trotz aller Blockbuster-Qualität nie den Indie-Ton mit Mumble-Core-Bezügen (Alter, was hier gequatscht wird!), wie man es von Greta Gerwig und Noah Baumbach erwartet hat.
Auch der Plot bleibt Anti. Zwischendurch, wenn man dem Drehbuch bei der Arbeit zuschaut, stellt sich klassisch die Frage, wie kommen sie denn da wieder raus? Jedoch nicht, weil sie in einer Höhle stecken und das Wasser steigt, sondern weil das Buch einen argumentativen Punkt macht und dem Thema als nächstes einen weiteren Aspekt hinzufügen oder einen Vorschlag machen wird, wie dieses ganze gender-Dilemma denn nun zu sehen oder gar zu lösen sein könnte. Barbie bleibt komplex.
Also zu Ken. Ken ist lost. Ken weiß nicht, was er soll, er weiß nicht, wozu er da ist. Niemand weiß es und Barbie nun ganz sicher nicht. Die ist ganz bei sich und in ihrer professionellen sisterhood zuhause. Ken ist der Mann in der Krise. Er definiert sich über eine Frau, für die er keine Rolle spielt, die ihn nicht braucht. Ken weiß nichts über sich, er hat keine Idee davon, wie er sein könnte, nicht, wie er sein möchte. Ryan Gosling spielt ihn in seiner ganzen anrührenden Bandbreite, wütend und verspielt, hilflos und depressiv, trotzig und gekränkt, selbstüberhöhend und größenwahnsinnig. Ken verliert sich in seinen Jungs-Wettbewerben, wird der Boss seiner Mannen, baut das dickste Haus am Platze und ist am Ende für Barbie, die längst alles ist und alles sein kann, doch immer nur: Just Ken. Aber Ken ist nicht einfach nur Ken, wie der Claim auf den Plakaten lautet, er hat ein größeres Problem. Ken ist die neue Frau. Er muss raus aus der Fremdbestimmung, er muss aufhören, sich über die Frau zu definieren, die ist längst über alle Berge. Er muss sich von den Zuschreibungen emanzipieren, die man ihm, die er sich auferlegt hat.
Ken ist eine Leerstelle. Er ist eine Frage, die sich stellt. Eine Frage, die der Film zu seinem Ende hin stellt, aktuell und weitsichtig, an alle Kens da draußen. Wer seid ihr, wer seid ihr wirklich, tief in euerm Inneren, welche Idee habt ihr von euch, wie wollt ihr sein? Fangt an, über euch nachzudenken, konzentriert euch auf euch, bildet Musicalgruppen und macht euer Ding. Wie das geht, könnt bei uns abgucken, wir machen das seit Jahrhunderten.
Mai 2023 – writers block – 3
Wie soll ich auch nur den Arm haben? Wie? Um ihn der Tastatur zu nähern. So sinnlos, so verschwendet.
Also gelähmt.
Erstickt,
im Keim.
Juli 2023 – Twitter heißt jetzt X
Heute morgen guck ich auf mein Handy, da ist es passiert. Twitter heißt jetzt X.
Das X sieht aus wie ne Mischung aus dem russischen Z und nem Hakenkreuz, weiß, auf schwarzem Grund.
Ich glaub, der Musk hat Großes mit uns vor.
Juli 2023 – gleichgültig
Alles ist gleich gültig.
Alles ist gleich ungültig.
Alles ist gleich. Nicht gleich hoch, nicht gleich tief,
gleich.
Alles zieht gleich an mir vorüber. Menschen, Tiere, Sensationen. Alles gleich bekannt.
Ich bin gleich da.
Vielleicht gleich nicht mehr.
Es ist mir gleich.
Ist es das?
Juli 2023 – Fuchs
Ein Fuchs isst Pommes vor meiner Haustür.
J. entdeckt ihn, euphorisch. Ich seltsam abgebrüht. Früher hätte er mir den Atem geraubt. Was ist nur los.
Juli 2023 – unsichtbar
Auf die Frage, welchen Superskill ich bevorzugen würde, fliegen können oder unsichtbar sein, antworte ich, natürlich, mit unsichtbar sein. Meine Liebe zum Beobachten von Situationen einerseits und meine soziale Angst andererseits, legen diesen Wunsch nahe.
Als ich ein Kind war, hat einmal ein Erwachsener in Anwesenheit meines Vaters über mich gesagt, ich sei ja sehr schüchtern. Ja, hat mein Vater gesagt, aber wer schüchtern ist, träumt eigentlich davon, im Mittelpunkt zu stehen. Das war ein erstaunlicher Moment für mich. Ein Moment von Erkenntnis. Zum einen der Erkenntnis, dass mein Vater mich gesehen hatte, dass er etwas von mir verstanden hatte, und zum anderen, dass sich hinter der, mit unangenehmen, ja, quälenden Gefühlen verbundenen Schüchternheit etwas anderes verbergen könnte. Diese Art von Erkenntnis löst die Schüchternheit nicht auf, sie bringt nur ein wenig Licht ins System.
Ich habe die Situation auch als schamvoll in Erinnerung. Sowohl in der äußeren Bemerkung, als auch in der Bemerkung meines Vaters, schwingt Kritik mit. Schüchtern sein ist in beiden Bemerkungen als defizitär markiert, als Verhalten, das den Erwartungen und Wünschen nicht so recht entspricht, an dem gearbeitet werden muss und, in der Bemerkung meines Vaters, zusätzlich als etwas Unehrenhaftes, als Versuch, die Wahrheit, nämlich einen narzisstischen Wunsch (im Mittelpunkt zu stehen), zu verschleiern, zu verbergen, und damit ihn, aber auch mich selbst zu betrügen. Ich habe mich gesehen (geschmeichelt) und entblößt (beschämt) gefühlt gleichermaßen.
Ich bin tatsächlich oft unsichtbar. Man übersieht mich. Ich glaube, es gibt dabei eine starke körperliche Komponente, ich bin klein, zierlich, weiß, habe ein unauffälliges Gesicht, unauffällige Haare, meine Stimme ist eher hell, manchmal leise, so leise, dass man mich leicht überhören kann. Ich bewege mich Situationen angepasst, bin eher ruhig, sage bitte und danke und weiß mich zu benehmen. Ich nehme nicht viel Raum ein. An Tischen, auf Stühlen, in Regalen. Ich gehe unter. In der Menge, der Masse. Ich steche nicht heraus. Ich bin eine von vielen, von Tausenden, von Millionen, manchmal werde ich verwechselt, weil es so einen Typus wie mich öfter mal gibt, Anke?, ach entschuldige, ich dachte, du wärst… Wenn ich auf einer Party herumstehe, gehöre ich nicht zu denen, die man im Raum entdeckt, deren Nähe man sucht, mit denen man ins Gespräch kommen möchte, ich werde selten angesprochen, man kommt nicht auf mich zu. Auf der Straße stolpert man über mich, man streift mich im Gedränge, am Tresen sieht man mich nicht. Mit Blicken hakt man sich an denen fest, die größer, kraftvoller, klarer sind, in ihren Umrissen, ihnen gewährt man Abstand, über mich sieht man hinweg. Am ehesten noch bin ich der Typ, den man nach dem Weg fragt. Ich laufe also mit einem Geheimnis durch die Welt. Das Geheimnis bin ich.
Ich mache mich nur selten oder auf verschlungenen Wegen sichtbar, nur wenige bekommen mich zu Gesicht. Ich verstecke mich. Im Schutz meiner Unsichtbarkeit fühle ich mich sicher, entlastet. Ich erzeuge sie. Durch Fragen an meine Mitmenschen, durch formelhaftes Sprechen, durchs Ausschweigen über mich selbst, bis hin zur Verstocktheit, zum pathologischen Verstummen, ja stumm sein. Ich bin also: Invisible Girl.
Wie bei allen Superhelden weiß nur ich, wissen nur wenige, dass ich eine Superkraft besitze, und wie alle Superhelden leide ich unter ihr. Sie schützt und sie quält mich, sie macht mich möglich, sie definiert mich, und sie verhindert mich, schadet mir. Ich bewege mich in ihrer Freiheit, unter ihrem Schutzschild, gleichzeitig ist sie mein schlimmstes Gefängnis, mein größter Feind. Classic double twist.
Unsichtbarkeit ist ein feministischer Klassiker. Die Unsichtbarkeit (und in ihren Verlängerungen Schüchternheit und Scham) ist eine weibliche Tugend – die Sichtbarkeit als attraktive Frau eine Pflicht. Auch hier liegt das Dilemma schön doppelt schizophren und damit unlösbar vor. Frauen im mittleren Lebensalter beschreiben häufig das Gefühl, unsichtbar geworden zu sein. Unsichtbar „als Frau“. Irgendwann mal also, waren sie sichtbar, nun sind sie es nicht mehr, sie verschwinden von der Bildfläche, lösen sich auf.
Dieser Eindruck referiert auf den männlichen Blick (der strukturell ist, also auch von Frauen geworfen wird), der nicht mehr stattfindet oder als abweisender, abwertender, gleichgültiger Blick zugeteilt wird. Der Superskill Unsichtbarkeit ist eine Möglichkeit, sich dem männlichen Blick zu entziehen, außerhalb seiner Sphäre zu agieren, sich auf die Seite des Beobachters begeben zu können.
Wer unsichtbar ist, ist draußen.
Im Draußen liegt immer beides, Schmerz und Freiheit.
Ich bin mir nicht sicher, ob die Person, die damals in Anwesenheit meines Vaters die Bemerkung über meine Schüchternheit gemacht hat, eine Frau oder ein Mann war. Ich meine, eine ältere Frau. Was ich sicher weiß, ist, dass mein Vater ein Mann ist. Wollte er mir Mut machen, nicht so schüchtern, nicht so „weiblich“ zu sein, ein empowernder Akt also? Wollte er durch die Aufdeckung meines Narzissmus, meiner bis zur Unkenntlichkeit vergrabenen inneren Idee, eigentlich grandios und etwas Besonderes zu sein – eine Idee, eine Sehnsucht, die jedes Kind, jeder Mensch von sich hat und die mir dennoch bis heute die Schamesröte ins Gesicht treibt, wenn ich sie nur aufschreibe – eben diese Idee auflösen? Beides ist möglich. Beides ist vielleicht irgendwie passiert. Ich habe aus beidem etwas und nichts gemacht.
Warum ich diese Fähigkeit wählen würde, wo ich doch bereits unsichtbar, ein Invisible Girl bin, ist im Grunde also rätselhaft. Müsste der ersehnte Superskill nicht die Sichtbarkeit sein? Oder grundlegender, die Fähigkeit keine soziale Angst zu haben, sich in der Gesellschaft und dem eigenen Ich sicherer und freier bewegen zu können. Sich das zu wünschen ist, als wünsche man sich, neu geboren zu werden und jemand anderes zu sein. Ich weiß heute, dass ich ein großes Bedürfnis danach habe, sichtbar zu sein und endlich nicht mehr unsichtbar. Ich kämpfe also gegen mich an. Ich versuche, mich aus der Unsichtbarkeit herauszuholen. Meine Enttäuschung darüber, dass es trotz großer Anstrengung nicht klappt, ist groß. Aber wie soll das auch gehen, ich habe einen starken Gegner.
In der Strategie der Unsichtbarkeit liegt eine gewisse Fuchsschläue, und auch etwas Überhebliches. Wer unsichtbar ist, kann dabei sein, ohne teilzunehmen, kann Wissen und Erfahrung sammeln, ohne je etwas beitragen oder am eigenen Leibe erfahren zu müssen. Die Unsichtbarkeit ist eine einfache Lösung, die Sichtbarkeit ein ständiges Risiko. Die Sichtbarkeit bedeutet Konfrontation, Gefahr, sie bedeutet, dem Ich als Fehler unmittelbar ausgesetzt zu sein. Die Unsichtbarkeit vermeidet das Leben. Sie quält ihre Besitzerin, weil sie sie zur Randexistenz erklärt und sie dem Ohnmachtsgefühl aussetzt, nicht oder nicht genug am Leben zu sein und niemals sein zu können. In der Unsichtbarkeit liegt eine Kraft, eine Möglichkeit, eine indirektes, beobachtendes, beschreibendes, eher analytisches Verhältnis zur Welt herzustellen.
Vielleicht ist es genau das, womit ich gerne sichtbar wäre.
Juli 2023 – Akteur
Plötzlich, sehr plötzlich ein Sturm. Der Wind peitscht die Bäume, bis an die Grenze ihrer Biegsamkeit, wirft das Wasser in Böen, Strömen, nein, Strudeln, durch die Luft an mein Fenster, wild, denke ich und zücke das Handy, filme aus dem Fenster, doch ich sehe nichts mehr: das Wasser jetzt so dicht, so laut an meiner Scheibe, dass mein Blick abprallt, wie an einem Autofenster in der Waschanlage, es gibt kein Dahinter mehr. Unwillkürlich weiche ich zurück, der Druck des Wassers so stark, dass ich nicht mehr sicher bin, ob das Fenster halten wird, lasse die Kamera sein, als die ersten Schläge hörbar werden, dem Rauschen des Wassers ein Prasseln und Knallen hinzufügen, Hagelkörner. Für einen Moment steigen Tränen in mir hoch. Die Erde ist wütend, denke ich. Sie schleudert sich mir entgegen. Der Planet ein Subjekt. Oder wie Latour sagen würde, ein Akteur.
Und ich kann ihn fühlen.
Juli 2023 – Notiz 3
Ich mag es nicht, wenn Leute mich anschauen.
Warum nicht?
Weil sie mich dann sehen.
Juli 2023 – Notiz 2
Es ist Sommer, du hast genug Geld, um über die Runden zu kommen,
also komm! über die Runden!
Juli 2023 – Notiz 1
Ich bin nicht einverstanden mit mir.
Juli 2023 – Unbekanntes Terrain
Die Stellen am Körper, die man nicht sieht. Nur der andere. Der einem nah ist. Kleine Flecken, Dellen und Beulen in Großaufnahme, rote Stellen, Bläuliches, Falten, Gruben und Hügelchen, in Ecken, Winkeln und Beugen. Die mir nicht einsichtig sind. Aber dem anderen. Ich bin mir nicht zugänglich. Ich habe keine Ahnung von mir. Aber der andere. Es gibt Orte an mir, die ich noch nie gesehen habe, nicht so, wie der andere sie sieht, an Hals und Rücken, in der Kniekehle, an Ohr, Hinterkopf, zwischen den Beinen. Ich kann mich nicht sichten, nicht so wie der andere begreifen, erfassen, ertasten, befühlen. Ich weiß nicht, was der andere sieht, ich weiß nicht, was der andere fühlt. Rauhheit, Zartheit, Weite, Enge, ich weiß es nicht. Aber der andere. Auch ich bin der andere. Beim anderen. Ich sehe viel.
Juli 2023 – Praktikind
Ich sitze im Buchladen, trinke Kaffee und lese Zeitung. Kann man da. Ein etwa 14jähriges Kind, Mädchen oder Junge ist nicht klar, wird auch nicht klar werden, ist es ein statement, eine Transformation, eine sexuelle Orientierung?, you never know, ein echtes wokes gender-Kid jedenfalls, den Pony lang über den Augen, als Versteck fürs Gesicht, den mageren Körper irgendwo unterm überdimensionalem Shirt und den Hosen, rührt mich sofort. Es steht neben der Buchhändlerin und schaut mit ihr in die Auslage. Die Buchhändlerin bespricht eine Aufgabe – Schülerpraktikum. In der Auslage liegen Schulbücher, Sprachbücher und anderes zum baldigen Schuljahresbeginn, high season für Buchläden.
Die Buchhändlerin bittet das Kind, die Bücher alle auszuräumen, Fläche und Bücher abzustauben und dann wieder einzuräumen wie es ihm gefällt. Das Kind setzt sich auf den Boden und macht sich an die Arbeit. Buch für Buch nimmt es heraus, betrachtet jedes einzelne, dreht es um, wenn es ihm interessant erscheint, studiert den Buchrücken, staubt jedes Buch ab, vorne und hinten, mit einem Staubwedel, den man ihm gegeben hat. Sorgsam, interessiert, mit einer Ruhe und Kontinuität, die mich erstaunt. Nicht einmal blickt es hilfesuchend oder unsicher hinter seinem Pony hervor, ich sehe nur seinen knochigen Körper, seine unaufgeregte Konzentration auf die Aufgabe. Mir kommen die Tränen. Was kann dieses Kind von sich sehen? Ich weiß es nicht. Aber ich finde es wundervoll. Wie muss es sein, ein solches Kind zu haben, was für ein schmerzhaftes Ziehen muss das sein.
Am Ende hat es alle Bücher wieder ausgelegt. Es nimmt noch kleine Veränderungen vor, legt das lieber zu dem, die beiden ein bisschen weiter weg, ich weiß nicht, nach welchem System. Es geht nach draußen, das Kind, um die neue Auslage nochmal von außen zu kontrollieren. Es kommt zurück und schubst ein Buch noch ein bisschen gerade. Dann geht es zur Buchhändlerin. Die geht mit ihm raus und nickt die Auslage ab.
Ich wende mich wieder konzentriert der Zeitung zu und verliere das Kind aus den Augen. Es wird schon werden.
Juli 2023 – depressiv
Alles was ich schreibe ist schlecht. Es ist ungeschickt, holprig, sitzt nicht.
Meine Träume sind lächerlich.
Meine Träume sind eine ständige Belastung.
Ich denke an Rasierklingen, an Bestrafung, an den Tod.
Ich kämpfe gegen die Gedanken, aber was bleibt dann.
Ich bin eine Depressive, die in der Lage ist, sich beim depressiv sein zuzuschauen.
Ich sehe mich selbst und sehe nichts, Nichts, ein elendes Nichts.
Das Scheitern lässt sich nicht aufhalten.
Die Fragen bleiben ohne Antwort.
ich verbiete mir, mich zu sehen.
Ich verbiete mir, mich so zu sehen.
Ich weiß nicht, wie ich mich sonst sehen soll.
Alle sind schneller, alle sind in der Lage
Ich bin nicht in der Lage
die Zeit läuft davon
die Zeit läuft nicht mehr davon
sie ist abgelaufen
und morgen schon
könnte es passieren und dann
ist nichts passiert
nichts
Nichts
schöne Grüße
Juli 2023 – Am See
Es ist heiß. Alle haben praktisch nichts an. Ein Teenie-Mädchen in Hose und Shirt allein auf einer weitläufigen Deckenlandschaft, um sie herum Kram, der auf andere Menschen hinweist, auf Eltern, Geschwister. Doch die sind nicht da. Bestimmt Baden. Standup Paddeln und so weiter. Sie liest. Ein dickes Paperback. Ich erhasche einen Blick auf den Titel:
How to kill your family.
Juni 2023 – Noch wach?
Am besten gefallen mir die Wörter in Versalien, rausgehoben aus den Sätzen, laut – wie die Headlines der Bild-Zeitung. Aufgeregt, wie Stichworte „zur Debatte“, in Talk-Shows, auf social media. Reihte man die Wörter auf Post-its aneinander, hätte man das Buch, ein Gedicht zum Skandal. Ein Mann hat die Geschichte aufgeschrieben, das war ein kritisches Thema in den Rezensionen. Ein berühmter Mann, der ja doch nur wieder einen Haufen Ego-Geld damit machen wird, der sich einfach nur einreihen kann, in den noise des Skandals, in die Selbstreferenzialität der Medien, zu denen er gehört, und seinen Ruhm vergrößert. Stimmt. Diese Ebene kriegt man nicht raus. Trotzdem bin ich froh, dass ein Mann die Geschichte aufgeschrieben hat, Frauen werden es auf ihre Weise tun. Der Mann dieser Geschichte stellt an keiner Stelle auch nur ansatzweise in Frage, dass da etwas passiert ist, was nicht geht. Im Gegenteil, er kapiert das sofort und die ganze Zeit. Er gewährt uns formal-inhaltlich brillant einen Einblick in Sprache und Struktur dieser abfälligen, misogynen Welt des Konzerns und seiner Macher. Hier ist keiner je über Mad Men rausgekommen, das Denken und Agieren wurde nur deutlich verfeinert. Die Bild-Zeitung/Julian Reichelt hat Frauen gefördert, Punkt. Der Kern dieser lässig, flüssig und mitreißend geschriebenen Geschichte ist, dass der Mann, der sie erlebt und aufschreibt, der Stuckrad-Barresche Ich-Erzähler, seine Freundschaft, oder genauer: seine Bromance zu dem aufkündigt, der die Sache immer weiter am Laufen hält: Döpfner. Nachdem er sehr lange neugierig, professionell, verständnisvoll, großzügig und unterm Strich dem Freund, dem Bro gegenüber loyal geblieben ist, findet er irgendwann endlich den Punkt ab dem es keinen Grund mehr gibt, mit der Beziehung weiterzumachen. Ist es nicht das, was wir brauchen? Männer, die anderen Männern sagen, ich kündige dir die Freundschaft? Es reicht, ich will nichts mit dir zu tun haben, nein, wir sind nicht gleich, nein, wir sind keine Bros, denn du bist kein Bro, sondern ein dummes Arschloch, ich muss dich nicht schonen, ich muss dir gegenüber nicht loyal sein, denn: I loathe you.
Der Ich-Erzähler gibt sich keine Mühe, sympathisch zu wirken. Er ist immer so dabei, kommt immer so mit, nimmt immer so mit, was geht: Pools in Promi-Hotels, Veranstaltungen mit Promi-Treff, Dinner in Promi-Restaurants. Er hält ganz betont nix von Moral, das haben ihm seine Christen-Eltern deutlich ausgetrieben, seine Aufgabe sieht er eben gerade darin, dabei zu sein. Gekauft zu sein, um viermal im Jahr zu schreiben, was er will. Das Privileg des Hofnarren, die Kohle stimmt. Er ist glücklicherweise auch nicht entsetzt, ihm wird auch nicht wirklich etwas klar im Sinne eines Entwicklungsromans. Das finde ich besonders angenehm. Nichts schlimmer als entsetzte und sich läuternde Figuren.
Auch die weibliche Hauptfigur, die ihn über die Praktiken im Hause Reichelt ins Vertrauen zieht, zeichnet er nicht als nette, sympathische Person. Er bildet ihren struggle ab, ihre Fragen, ihre Verunsicherung, ihre Wut. Aber niemand muss hier nett sein, um für uns Opfer werden zu können oder der Täterschaft zu entkommen.
Ein kühles Buch, im Grunde. Das einen spannenden Prozess erzählt, und die Grundlagen durchschaut. Letzteres gerät ironisch 90er manchmal etwas selbstgefällig.
Schön auch, dass er uns daran erinnert, dass die Bildzeitung Tod und Trauma produziert (Spielerfrau. Katharina Blum) und uns von der Fatzkenhaftigkeit erzählt, die ihr Vorstands-Personal an den Tag legt beim Bau von Gebäuden und Hand-Shakes mit Elon Musk. Da hat einer verstanden, wohin das Begehren geht.
Diese Zeitung ist brandgefährlich, das war sie schon immer.
Zur Ergänzung empfehle ich den Podcast Boys Club. Der ist von zwei Frauen.
Juni 2023 – Blueberry Man
Ich sitze bei McDonalds. Passiert. Blick aus der Höhe. Auf Busse, Menschen, Autos am Zoo. Die Fensterfront wie die eines Raumschiffs, Star-Trek-Architektur, McDonalds als Kantine, irgendwo im All. Ich sitze an einem der Zweier, träume aus dem Fenster.
Vor mir ein alter Mann, klein, hager, sehnig, ein Käppi auf, die Haare an den Seiten schütter. Er trägt ein Holzfäller-Hemd, reingesteckt, in die Blue Jeans, einen breiten Ledergürtel. Fehlen nur noch die Cowboy-Stiefel. Vor ihm ein Blaubeer-Muffin in seinem Förmchen aus Papier. Kein Tablett, nichts, nur dieser Muffin vor ihm auf dem Tisch, unberührt. Er guckt ihn an, zufrieden, als wär ne Kerze drauf und heute sein Geburtstag. Er nimmt einen Löffel, aus Holz sind die jetzt, drückt ihn mit der Seite in den Muffin. Er löffelt den Muffin. Muss ein bisschen nachhelfen, mit dem Finger manchmal, ein bisschen mit der Löffelspitze säbeln, aber es geht. Wir fliegen in unserer Kantine durchs All, ich und der Muffin-Mann, nicht viel trennt mich von ihm.
Als er aufgegessen hat, bleibt er noch ein bisschen sitzen. Schaut, wie ich, nach draußen, durch die Star- Trek-Fenster auf die unwirkliche Welt. Schaut, wie ich, auf den Jungen, der einen Tisch weiter mit der Nase am Fenster nach draußen sieht, auf Busse, Menschen, Autos am Zoo, auf die Symphonie der Großstadt, das Kästner-Kind. Plötzlich dreht der Mann sich auf seinem Stuhl zu mir um, den Arm auf der Lehne, die Augen wach. Er ist jetzt, wo er alles getan hat, gegessen, rum geguckt, auf der Suche nach ein paar Worten. Ich erschrecke, senke den Blick, mein Tablett voller leer gegessener Papiere, Cellulose und beschichtet, und kaue schnell auf irgendwas letztem, was sich daraus noch hervor scharren lässt.
Er steht auf, verschwindet hinter einer der Trennwände, vom Szenograph entworfen und ausgesägt, und spricht mit einer der Mitarbeiterinnen, die dort mit hüfthohem Besen und Kehrblech den Boden sichtbar macht, eine Latina. Er spricht, lacht, ich höre seine Stimme, ihre. Kommt er öfter hier her? Hat er sich nach ihr umgeschaut? Kommt er jeden Tag? Jeden Samstag? Isst seinen Blaubeer-Muffin. Nie etwas anderes. So wie andere ihren Kuchen in der Konditorei. Wechselt ein paar Worte, dann geht er.
Ich sehe ihm nach.
Was, wenn er wirklich Geburtstag hat.
Juni 2023 – back to
depression.
Ich weine viel und unbemerkt.
Juni 2023 – Nice shoes
Ich muss zu einer Veranstaltung mit einem Promi. Ich jammere bei Freunden herum, dass ich nicht weiß, was ich sagen soll. Noch dazu ist er englischsprachig. Die verstehen das nicht, es gibt doch immer was, was man sagen kann! Was denn? Wetter. Und Essen. Genauer: Was man grade gegessen hat. Das haben sie bei einem anderen Promi beobachtet, der jedes Mal wenn er auf eine Bühne kommt, erstmal erzählt, was er grade gegessen hat und wie das so war. Kann man sich abgucken. N. schlägt vor, sag doch einfach: Nice shoes. Nice shoes?! Ich bin begeistert. Das ist brilliant. Alle meine small-talk-Probleme scheinen mit einem Schlag gelöst. Nice shoes, das geht auf jeder Party, nice shoes hat alles, was man braucht. Es ist einfach, überraschend, aber nicht zu weird, es ist freundlich, wahrnehmend und drauf zu, es fällt auf und ist dennoch sozial total akzeptabel.
Als ich den Promi sehe, und meine Chance gekommen ist, für den großen Auftritt, trägt er leider alles andere als nice shoes. Genauer gesagt, trägt er ugly shoes, really ugly shoes. Ich bringe es nicht übers Herz, nice shoes zu sagen. Es wäre zu hart gelogen.
Egal. Nice shoes will save my life! Jetzt und immerdar.
Juni 2023 – Jott Ha
Ich lese Judith Hermann,
alles fließt, die Dinge beginnen zu tanzen
vor meinen Augen
die Menschen und ihre Bezüge.
An einer Stelle erzählt sie, wie sie / ihre Protagonistin das Tagebuch ihrer verstorbenen Mutter liest.
Ich habe Angst,
steht auf einer Seite. Sie schlägt das Heft zu, als habe sie sich verbrannt.
Das ist toll. Aus verschiedenen Gründen.
Mich bringt es zu zwei Fragen.
Wer wird sich je so für mich interessieren, dass er liest, was ich geschrieben habe. Der bereit ist auszuhalten, wer ich war, der mich so mag (liebt, etwas anderes wird nicht reichen), dass er das Interesse, das Begehren, den Mut aufbringt, mir zu folgen, durch meine Gedanken, meine Dummheit, meinen Irrsinn, meine Eitelkeit. Und warum ist das wichtig?
Zum anderen denke ich: Was hätte auf der Tagebuchseite meiner Mutter gestanden? Ich weiß es nicht. Das erste, was mir in den Sinn kommt, ist ein Tagesablauf, vielleicht die Beschreibung eines Familienfestes, im Grunde ohne Emotion erzählt. Das löst zum einen das übliche abfällige, verächtliche Gefühl aus, ich finde sie flach, passiv, brav, feige, einfältig,
und dennoch rührt sie mich.
Hinter der Abfälligkeit liegt die Sehnsucht.
Zum anderen aber auch wird die Gewissheit spürbar, dass ich sie nicht kenne, nicht gekannt habe und niemals kennen werde. Habe ich mich nicht genug für sie als Mensch interessiert. Sicher. Sie hat sich mir nicht als Mensch offenbart. Ganz sicher. Oder hat sie es versucht und ich habe es abgelehnt? Weil sie sich nicht für mich interessiert hat. Habe ich ihr eine Chance gegeben dazu? Immer hab ich sie geschont vor mir, aus Angst. Davor, dass sie noch fremder wird, noch blasser, dass sie mich fallen lässt, aussetzt, aussteigt. Dabei war sie das längst, ausgestiegen.
Ich weiß nichts von ihr. Nichts von ihren Ängsten, ihren Gedanken, ihren Ideen, ihrer Enttäuschung, ihrer Wut. Ich kann sie ahnen, aber nicht wissen. Sie hat sich mir nicht vermittelt.
Wie oft sie etwas Abfälliges, Abwertendes mir gegenüber hatte, wie spät ich das begriffen habe. Worüber war sie enttäuscht, worauf war sie wütend? Dass ich von Anfang an nicht das war, was sie sich gewünscht hatte. Dass ich eine Fremde war, geblieben bin, bleiben wollte. Dass ich ihr nicht verzeihen konnte, wollte, war es eine Reaktion darauf? Oder war es genau anders herum? Wollte sie die Fremde bleiben? Dass ich in Abgrenzung zu ihr entstanden bin und ihr doch niemals entkommen werde.
Was hätte ich darum gegeben so einen Tagebucheintrag von ihr zu finden.
Wie Judith Hermanns Protagonistin hätte ich das Heft rasch zugeschlagen.
Oder?
Juni 2023 – noch immer
Ich sehe, im Vorübergehen:
Eine Frau im Sommerkleid, vielleicht Anfang dreißig, das Kleid mädchenhaft geblümt, dazu DocMartens. Sie beugt sich, die Motorhaube offen, über die Innereien ihres alten Autos und pult fachmännisch an irgendeinem Kabel herum. Für eine Sekunde bleibe ich an dem Anblick hängen. Noch immer, bis heute, habe ich das Gefühl, etwas Besonderes zu sehen. Ah, guck mal, eine Frau, die ein Auto repariert.
Juni 2023 – in Frage gestellt
Manchmal werde ich wütend auf ihn. Wenn er etwas für mich ganz Selbstverständliches nicht versteht, ich werde wütend, dass ich überhaupt darüber reden muss, dass ich erklären, mühselig vermitteln, übersetzen muss, was ich meine, ich kann nicht fassen, dass er das nicht weiß, nicht begreift, wo es doch so klar ist, so selbstverständlich. Ich bin wütend, weil er nicht T. ist, ich bin wütend, weil T. nicht mehr hier ist, ich bin wütend, weil ich mich zufrieden geben muss, mit mir, die übrig geblieben ist, weil ich leben muss, mit jemand, der anders ist. Oder: weil ich unsicher bin, ob das für mich Selbstverständliche nicht so selbstverständlich ist, wie ich dachte. Ich bin wütend, weil ich mir nicht mehr sicher bin.
Juni 2023 – Beef
Bei McDonalds will ich das, was ich immer will, mein persönliches Schlechtgeh-Menü, kleine Pommes mit Mayo, Cheeseburger, kleine Cola mit Eis. Aber dann nehmen sie doch das Cheeseburger-Menü, sagt die Frau am Bestell-Tresen, bisschen älter als ich, asiatischer Background, Akzent, schätze Indien oder Pakistan, das ist doch viel günstiger. Und was ist da drin? frage ich. Pommes, kleine Cola und zwei Cheeseburger, sie deutet auf die Anzeige-Tafel hinter ihr. Aber zwei Cheeseburger, das ist mir zu viel, sage ich, das schaff ich nicht. Aber schaun sie, sagt die Frau, so sind sie bei 7 Euro 49, und das Menü: nur 5!
Ja, überlege ich, aber was mach ich dann mit dem zweiten Cheeseburger? Ich kann ihn doch nicht wegwerfen, nur weil’s billiger ist. Essen sie später! schlägt sie vor. Dann ist er kalt, sage ich. Ja, aber so viel teurer! sagt sie und schüttelt bekümmert den Kopf. Oder, sage ich, ich gebe den zweiten Cheeseburger Ihnen. Nein, sagt sie, ich esse kein Beef.
Ich lache. Sie macht mich glücklich.
Ich nehme die drei Sachen einzeln und zahle gut zwei Euro mehr.
Juni 2023 – contemporary
Was tun im Alter?
Ich lese was über eine Tanzensemble älterer Menschen, contemporary dance.
Ich will eine Schule gründen für alte Leute, Kunst kann man hier studieren, es gibt Ateliers.
Eine WG will ich gründen.
Ein Café will ich eröffnen, kleiner Raum, hell, hübsch, schnell, einfach, Zeitungen, Filterkaffee und Stulle, mal ein Kuchen, günstig. Vielleicht nur so wie das Fenster Cafe in Wien.
Aber keiner macht mit.
Juni 2023 – Paranoid
Kürzlich fragt mich eine Freundin, ob ich eigentlich manchmal paranoid sei. Sie fragt nicht, weil sie annimmt oder findet, dass ich paranoid sei, sondern aus ehrlichem Interesse und weil sie selbst manchmal solche Tendenzen an sich erlebt. Zu meinem eigenen Erstaunen antworte ich mit Ja. Ja, ich bin es geworden. In den letzten Jahren. Nicht auf diese Art paranoid, wie man das landläufig versteht, also eine Verschwörung vermutend, davon ausgehend, dass im Geheimen systemisch-personelle Vorgänge im Hintergrund der Gesellschaft vor sich gehen, die man auch noch als einer der wenigen Wissenden zu durchschauen glaubt und womöglich vorausschauend darauf reagiert, Alu-Hut. Nein, so nicht. Einfach nur paranoid meinen Mitmenschen gegenüber.
Früher war ich nicht paranoid. Natürlich habe ich mich manchmal gefragt, was hinter meinem Rücken vor sich geht, ich habe geahnt oder gewusst, dass die Menschen in meiner Umgebung manchmal schlecht über mich reden, dass sie nicht immer ehrlich zu mir sind, dass sie Dinge tun, die sie mir lieber verschweigen. Aber ich habe darin nie so etwas wie eine böse Absicht oder ein strategisches Vorgehen gewittert, das dazu da ist, mir zu schaden. Ich habe das eher als Teil von sozialer Interaktion begriffen, als Aspekt von Beziehung, als Versuch, Komplexität zu reduzieren, wenn Kommunikation, Gefühlslagen, Bedürfnisse zu fordernd sind, um sie transparent zu machen. Doch in den letzten Jahren habe ich Situationen erlebt, in denen die Menschen in meiner Umgebung Dinge getan haben, die sich mit den Umständen in denen sie stecken, nicht entschuldigen oder erklären lassen. Handlungen, die nichts anderes sein konnten als strategisch angelegte Aktionen zur Erreichung eines persönlichen Ziels oder Vorteils durch die absichtsvoll herbeigeführte Verschlechterung der Situation einer anderen Person. Meiner Person.
Auch wenn ein Kern von Verständnis immer bleibt, hat das eine andere Qualität. Es ist das Erlebnis eines Betrugs. Es führt dazu, dass etwas entsteht, was man den Verlust von Vertrauen nennen kann. Der andere ist potentiell ein Feind, er ist gefährlich. Er ist in der Lage, Dinge zu tun, die man sich SO nicht hätte vorstellen können, Dinge, von denen man nicht gedacht hätte, dass DIESE Person sie JEMALS tun würde. Väter, Lebensgefährten, Freundinnen, Kolleginnen zum Beispiel. Menschen aus dem nahen Umfeld also, dem Umfeld, in dem man gar nicht existieren und agieren kann, ohne zu vertrauen.
Man könnte jetzt sagen, muss man das gleich Paranoia nennen, ist das nicht eher sowas wie gesundes Misstrauen. Das paranoide Gefühl kommt aber anders als das Misstrauen als Überfall daher, es ist ein Schock, ein Erlebnis, eine plötzliche Erkenntnis, dass alles ganz anders ist, als man immer angenommen hat, es erfasst einen als Angst. Davor, dass es tatsächlich so ist, wie man gerade begreift oder noch schlimmer: dass die ganze Angelegenheit eine Dimension haben könnte, die man auch jetzt, in diesem Moment, nicht mal ansatzweise erfasst hat. Ein Wissen, das sich in aller Plötzlichkeit einstellt, eine bittere Wahrheit. Der Eindruck der Bodenlosigkeit ist die Folge. Einmal erlebt, kann sich das paranoide Gefühl in anderen Zusammenhängen genauso überfallsartig wie von selbst wieder einstellen und dadurch Angst machen. Es hat das Potential schwelend zu werden, wenn du nicht das Glück hast, es zu vergessen, oder die Stärke, es aktiv beiseite zu schieben, dich dagegen zu entscheiden. Hier ist sie, die Schnittstelle zum Wahnsinn oder korrekter zum Pathologischen.
Die Schwester der Paranoia ist also die Einsamkeit. Das paranoide Gefühl trennt einen ab von allen anderen. Es zieht einem den Boden unter den Füßen weg. Auf dem stehen die anderen, alle anderen, aber nicht mehr man selbst. Vertrauen kann ab hier nur noch temporär vergeben und mit längerem Anlauf eingegangen werden. Sie macht einen selbst zu einem absichtsvoll agierenden Wesen. Das Vertrauen, das man hat, das man großzügig und ohne Hintergedanken zu geben bereit ist, weil man es für richtig, ja, für einen Wert hält, diesen Vorsprung zu geben, fällt plötzlich auf die Seite der Naivität, der Dummheit. Was hast duu denn gedacht? Sieht man doch in jeder Serie.
Das paranoide Gefühl, dem nahen Umfeld entsprungen, geht eine unglückliche, sich gegenseitig verstärkende Verbindung ein mit den Unsicherheits- und Einsamkeits-Erfahrungen der letzten Jahre, die auf anderen Ebenen erlebt wurden. Nicht nur von mir, sondern von der Menschheit. Dazu gehört die Pandemie mit ihrem Kern einer apokalyptischen Erfahrung, der Trumpismus als Chiffre für einen bis ins Innere von Demokratien reichenden Politikwandel, der ebendiese als Vorschlag behandelt, der erlebbar werdende Klimawandel, der die Liste möglicher Todesursachen um Sturm, Hitze, Wasser erweitert und konkrete Vorstellungen über ein Leben in der Zukunft aufruft sowie der Ukraine-Krieg mit seinen Auswirkungen auf die seit Generationen gewohnte geopolitische Weltaufteilung und die in ihm enthaltene Möglichkeit eines Dritten WK oder eines atomaren Supergaus, welcher Art auch immer.
Juli 2023 – writers block – 3
C. fragt mich, ob ich wieder schreibe.
Nein, sage ich.
Words can bring me down.
Mai 2023 – Marseille en Mai – Möwe
Eine Möwe hackt mit ihrem riesigen Schnabel auf eine tote Taube ein. Da wo früher der Kopf der Taube war, ist nur noch ein blutender, offener Strunk. Der Kopf ist weg, keine Ahnung, wo. Liegt nicht rum, oder so. Immer wieder hackt die Möwe in den blutigen Strunk, holt Fetzen heraus, ungeduldig schleudert sie den toten Körper herum, zerfetzt und reißt ihn.
Lovely.
Mai 2023 – Marseille en Mai – Elle
1
Im Airbnb Apartment fische ich eine französische Elle vom Zeitschriftenstapel. Gleich vorne auf der ersten Seite bleibe ich hängen. Das Editorial der Chefredakteurin beginnt mit einem Zitat aus Ray Bradburys Buch Fahrenheit 451, einem Science-Fiction-Roman, in dem es um Bücherverbrennung geht. Von dort zieht sie den Bogen weiter zur der Verbannung von Büchern in Bibliotheken und Schulen in einigen Bundesstaaten der USA (darunter Toni Robinson, Mark Twain und Art Spiegelman), und endet bei den Änderungen, die in Großbritannien von Verlagen an Büchern von Roald Dahl über Agatha Christie bis Ian Flaming vorgenommen werden, um beispielsweise antisemitische oder dickenfeindliche Sätze zu entfernen oder zu ersetzen.
Die Autorin bezieht dazu eine klare Haltung: Sie ist entsetzt. Sie sieht die Freiheit des Lesens in Gefahr. Sie zitiert Bret Easton Ellis, und findet wie er, dass es bei Literatur nicht darum geht, sich der eigenen Komfortzone etablierter Moral zu vergewissern, sondern um die Beunruhigung, die sie heraufbeschwören kann. Darin, so die Redakteurin, liegt die subversive Kraft der Literatur und sie spricht sich dafür aus, Leserinnen und Lesern nicht um das Vertrauen und die Möglichkeiten ihres kritischen Geistes zu bringen. Sie plädiert für Kontextualisierung. Also für Fußnoten, Vorbemerkungen und andere Formen der historisch-kulturellen Einordnung.
Ich bin verblüfft. Ich kann mich nicht erinnern, je in einer deutschen Frauenzeitschrift im Editorial einen Text mit politischem Inhalt gelesen zu haben. Schon gar nicht einen, der sich mitten rein traut, ins Wespennest. Beindruckend, die Franzosen, oder besser: die Französinnen.
Der argumentative Bogen, den sie spannt, legt ihre Sorge um den umgekehrten Verlauf frei: Mit den Veränderungen in den Büchern fängt es an, mit Bücherverbrennungen hört es auf. Sie sieht also von woke links bis scharf rechts die gleichen Mechanismen am Werk, trotz der unterschiedlichen Motivationen, die beiden zugrunde liegen. Während die linken oder sagen wir besser, identitäts- und repräsentationspolitischen Strömungen mit dem Schutz von fragilen und fortlaufend Diskriminierung ausgesetzten Personen argumentiert, und die permanente Wiederholung von abwertenden Festschreibungen durchbrechen will, argumentiert die autokratische Rechte – ja, womit eigentlich?, mit dem Schutz von Eltern und Kindern vor Büchern, die schlicht als „gefährlich“ eingestuft werden. Was an Autorinnen wie Morrison, Spiegelman und Twain gefährlich ist, bzw. was an ihrer Verbannung für eine rechte politische Klasse so attraktiv ist, kann sich jeder zusammenreimen.
2
Wie immer ist natürlich alles kompliziert. Die Lindgren-Bücher sind viel diskutiert worden und auch mir, die ich die oben wiedergegebene Position bei Erwachsenen-Literatur zu praktisch hundert Prozent teile, leuchtet es nicht ein, warum irgendjemand heute noch in einem Pipi Langstrumpf-Roman das N-Wort lesen sollte. Wobei man sich klarmachen muss, dass Lektorinnen, Übersetzerinnen und Erben ständig Worte, Sätze, Ausdrücke in Büchern verändern, gerade bei Übersetzungen und Neuausgaben ist das ein zentrales Thema. Dennoch finde ich es eine geradezu vertane Chance, wenn man der jungen Leserin, dem Leser eines Pipi-Romans nicht mit ein paar kindgerechten Worten die vorgenommene Änderung und den Prozess dorthin transparent machen würde: An dieser Stelle stand früher mal ein anderes Wort. Um zu begreifen, dass wir alle historisch zu verstehen sind und im Horizont unserer Zeit denken, dass gute und interessante Bücher nicht automatisch von nur netten oder in allen Lebensbereichen klugen Leuten geschrieben werden, dass wir in einer diskriminierenden Gesellschaft leben, dass Worte Macht haben, und Literatur über all das reflektiert, wäre diese Kontextualisierung hilfreich.
Erwachsene jedoch, die sollte man nicht für dumm verkaufen. Man darf nicht aufhören, von ihnen (und den Schulen, die sie besucht haben), zu erwarten, dass sie wissen, wie man Literatur liest und dass Texte in einem historischen, kulturellen, biografischen Kontext entstehen und in einem anderen gelesen werden. Wirklich hilflos und gefährlich unterkomplex wird es, wenn Texte schlicht abgescannt werden, auf Z-Wörter, N-Wörter, ohne dass noch jemand versteht, dass sie beispielsweise in einem Figurendialog der erzählten Zeit verwendet werden oder dass die Autorin genau damit Rassismus thematisieren möchte oder dass Antisemitismus sich gerne mal zwischen den Zeilen befindet oder Sexismus in den Inhalten, ohne dass auch nur ein einziges offen diskriminierendes Wort gefallen wäre, das man löschen kann. Und auch die ausgegrenzten Gruppen selbst benutzen ja häufig den ursprünglich abwertenden Begriff, um ihn sich in einer Geste der Selbstermächtigung anzuheften, was in der Sprache einer Figur eine entsprechende Bedeutung haben kann. Die Idee der Empfindlichkeit, der Fragilität der Lesenden, auf die Literatur Rücksicht nehmen muss, ist mir als Motivation für Streichung und Änderung nicht geheuer. Wer schwingt sich auf, zu wissen, was für wen verletzend oder beleidigend (offensive) sein könnte, wer errichtet auf welcher Grundlage den Katalog dafür, der dann abgearbeitet wird? Und wenn wir alle Wörter mit den besten Absichten ausmerzen, bedeutet das nicht, dass es Rassismus, Homophobie, Sexismus usw. usf. nicht gibt. Möglicherweise verstellen wir nur den Blick darauf, tun so, als wär da nichts weiter Schlimmes, wo vorher was verdammt Schlimmes war. Was für eine Rolle schreibt man der Literatur zu, welche Idee von Autorschaft pflegt man?
Dass es in Frankreich möglich ist, den aktuellen Umgang mit Literatur zu kritisieren und in Beziehung zu setzen mit den Bücherverboten in Bildungseinrichtungen der USA, scheint mir aus der deutschen Perspektive erstaunlich. Hier haben die Rechten den Hass aus den USA auf alles, was „woke“ ist, importiert und unter dem Stichwort Cancel Culture den Diskurs gekapert. Die Antwort von links bis zur bürgerlichen Mitte muss dementsprechend die Verteidigung von beidem sein. Eine andere Antwort kann es nicht geben, eine andere Ecke, eine eigene Haltung wird nicht entwickelt.
Für Olivia de Lamberterie bedeutet Lesen, sich zu konfrontieren. Mit sich, mit der Welt, mit anderen. Mit dem Anderen. Ihren Artikel hat sie mit dem Titel À lire vrai überschrieben. Wenn mein Französisch und DeepL mich nicht täuschen, bedeutet das so viel wie Aufs wahre Lesen oder wahr lesen. In diesem Sinne. Öfter mal zu französischen Frauenzeitschriften greifen.
Mai 2023 – Marseille en Mai – L’eau est bonne!
Wir gehen ein kleines, verstecktes Hafenbecken unter einer hohen Bogenbrücke entlang. Einfache, kantige Arbeiterhäuschen, die hellen Boote im Wasser wie überall hier dicht an dicht, ihre dünnen Masten gegen den blauen Himmel wie Spießchen an einer üppigen Tapas-Bar: para picar. Das Becken führt unter der Brücke weiter, öffnet sich nach links, ein großer Felsen auf der anderen Seite wird sichtbar. Darauf, schon von weitem hörbar, sitzen Jugendliche. Wie Vögel sitzen sie, dunkle Flecken in den Kuhlen und auf den Spitzen des Felsens, und schauen aufs Wasser, in die Weite, bewegen sich, zueinander, auseinander, richten sich auf und kauern sich nieder, gruppieren sich und vereinzeln sich wieder.
Das Becken grenzt das Meerwasser hier zu einem Pool ab, der Felsen als Längsseite eines Spaßbads. Das Wasser türkis und durchsichtig, Adria-Style, die Sonne brennt, die Jugendlichen lachen, flachsen, ich betrachte sie, im Gehen. Ein Junge, vielleicht 14, 15, klettert ins Becken, seine dicken Sneakers an, der Seeigel wegen, ein Mädchen kommt ihm nach, sie tauchen unter, tauchen auf, die Haare dunkel und glatt, schwimmen ein paar Züge, ihr Lachen ist zu hören, ihre Rufe, ihr Atem. Als sie aus dem Wasser kommen, gehen sie mit ihren Sachen auf der uns gegenüberliegenden Seite das Beckens entlang, der Junge vorne weg. „Madame!“, ruft er strahlend herüber und meint mich:
„L’eau est bonne!“
Eine Verkündigung ist das,
und ein Versprechen,
ein Bedürfnis,
das Glück zu teilen, es mitzuteilen, es mit mir zu teilen,
eine Versicherung,
ein Versuch, Zuversicht zu verbreiten, Trost,
eine Antwort
auf eine sich grundsätzlich stellende Frage,
eine Aussage, über das Wasser,
das Leben.
Ich versuche, mir den Satz zu merken als wär’s ein Tattoo in meinem Hirn.
Mai 2023 – Marseille en Mai – So geht das
Ich lese Schlachthof 5. Auf meiner Liste seit ich im zweiten Airbnb-Apartment in Wien (Mai 2022) mehrere englische Vonnegut-Bücher im Regal gesehen habe, ein in den USA offenbar sehr, in Deutschland mehr oder weniger und mir gar nicht bekannter Autor. Obwohl er doch so unbekümmert Ausflüge ins Sci-Fi-Genre gemacht hat. Die junge Besitzerin der Wohnung jedenfalls, eine Amerikanerin in Wien, hatte offensichtlich ein Faible für ihn.
Schlachthof 5 also. ’69 geschrieben, als WK II, von dem Kurt Vonneguts alter ego Billy Pilgrim uns erzählt, schon länger vorbei ist, das Buch den Nerv des Diskurses über den Vietnamkrieg trifft und als Antikriegsbuch in die Literaturgeschichte eingeht. Billy Pilgrim berichtet, wie der Krieg, den er als amerikanischer Soldat und Gefangener in Deutschland erlebt hat, so war und was er aus ihm gemacht hat. Einen kaputten, unter den Eindrücken und Erlebnissen leidenden, belasteten und davon auf alle Zeit geprägten Billy Pilgrim nämlich. Kein Wunder also, dass Billy ein Zeitreisender ist, der uns mitnimmt in seine Vergangenheit, seine Zukunft und immer wieder zurück in seine Gegenwart. Denn überall dort hat der Krieg und alles, was Billy darin gesehen hat und erlitten hat, seine Spuren hinterlassen. Die Bilder, Gedanken und Erinnerungen aus der nicht enden wollenden Hölle, in der es, gerade wenn man denkt, dass es nicht mehr schlimmer kommen kann, immer noch schlimmer kommt, tragen ihn von einer Zeitebene in die andere. In lakonischem Ton beschreibt er, was passiert, sich selbst und seine Zustände. Er ist so geworfen in die Grausamkeiten und Absurditäten des Krieges, dass er darin nicht mehr als Handelnder erscheint, sondern manchmal beinahe drollig und tölpelhaft erscheint. Auch auf den Planeten Tralfamadore nimmt Billy uns mit, wohin er entführt wird, weil die Tralfamadorianer sich für die Spezies Mensch respektive ihren Vertreter Billy interessieren, ihn und die krieführende Menschheit aber mit technokratisch achselzuckendem Fatalismus betrachten, sodass auch diese an ein Delirium oder einen Morphiumtrip erinnernde Parallelwelt ebenfalls nicht wirklich als Entlastungsfantasie für Billy funktioniert.
Hinter der sich selbst nicht besonders ernst nehmenden Figur und dem Irrsinn der Ereignisse sind Billys Schmerz und Verzweiflung die ganze Zeit spürbar, genau wie der Wahnsinn, der Billy angesichts der Erlebnisse zu befallen droht, in den er sich flüchtet oder in den die Morphiumspritze ihn entlässt.
Ein einzelner kurzer Satz zieht sich wie ein Refrain, eine Interpunktion, ein grausames Mantra oder eine Lebensweisheit durch das Buch: So geht das. So it goes im Original. Jedesmal, wenn Billy, so zumindest mein Eindruck, schildert, wie und dass jemand gestorben ist, setzt er am Ende diesen Satz: So geht das.
Nachdem ich das Buch einmal komplett durchgelesen habe, merke ich erst, dass es mich erschüttert hat, vielleicht weil es auf diese seltsam leichte lakonisch-warme Weise die Verzweiflung eines Menschen beschreibt. Ich beginne noch einmal von vorn, um alle So geht das zu zählen. Ungewohnt nerdig für mich, aber es ist mir ein Bedürfnis, das zu tun, keine Ahnung warum. Vielleicht nur, um zu sehen, ob ich recht habe, mit meiner Vermutung, dass jedesmal jemand stirbt und die literarische Technik genauer zu untersuchen, vielleicht, weil ich es als Respekt vor den Toten empfinde, als Respekt auch vor Billy Pilgrim und seinem Autor Kurt Vonnegut, der all diese Totengeschichten gehört und erlebt hat. Ich komme auf 87 So geht das.
87mal kommt in diesem Buch jemand zu Tode. In 10 Kapiteln, auf 200 Seiten. Meistens ist es eine konkrete Person, einige Male sind es abstrakte Mengen wie Bevölkerungen von Städten, zweimal sind es Tiere, einmal ist es Billy selbst, der den „Zustand des Totseins“ dann aber wieder verlässt und überlebt. Einmal ist es Champagner, der nicht mehr blubbert und einmal Wasser, dessen Blasen es nicht mehr an die Oberfläche schaffen. Als an einer Stelle Läuse, Bakterien und Viren sterben, bekommen die kein So geht das. Sein, ja, wie soll man ihn nennen, Kamerad ist so ein fürchterliches Wort, sein Kriegsgefährte auf Zeit, Edward Derby, bekommt gleich 4 So geht das, sein Tod wird im Buch also mehrfach erwähnt. Zu Beginn spricht Billy davon, dass Derbys Tod der Höhepunkt des Buches sein wird, was dann aber nicht der Fall ist, Derby stirbt literarisch genauso brutal lapidar wie tatsächlich, doch die mehrfachen, mit So geht das geadelten Erwähnungen an unterschiedlichen Stellen des Buches verstärken den Eindruck, dass sein Tod für Billy ein ganz besonders schmerzvolles weil so widersinniges Ereignis kurz vor Kriegsende war, in dem der ganze absurde verschwenderische Wahnsinn des massenweisen Sterbens kulminiert.
In der neuen Übersetzung lautet der Satz übrigens: Wie das so geht.
Beim zweiten Lesen begreife ich noch mehr, wie Vonnegut seine Motive benutzt, um Billys unruhige Reise durch seine inneren Zeiten zu erzählen.
Interessant ist, dass ich noch nie davon gehört habe, dass die Deutschen amerikanische und englische Kriegsgefangene hatten. Bin ich die einzige? Ich frage ein bisschen herum, niemand hat davon gehört. Bemerkenswert.
Außerdem interessiert mich die Rezeption des Buches in Deutschland, immerhin geht es um den Bombenangriff auf Dresden, ein hier immer wieder und vor ein paar Jahren nochmal heftig hochgekochtes Thema, ein umstrittener Punkt von links bis extrem rechts, deutscher Opferdiskurs, Wiederaufbau der Frauenkirche, Diskussionen wie das Endes des Krieges zu interpretieren ist, bis heute veranstalten nationalsozialistische Gruppen sogenannten Trauermärsche, in der DDR gab es am Jahrestag kirchlich orientierte Friedensdemonstrationen. In der amerikanischen Lesart ist das Buch 1969 vor dem Hintergrund des Vietnamkriegs ja eher als Frage an die USA gerichtet, die ihre jungen Männer in einen Krieg geschickt, und ein Massaker angerichtet hat. Auch interessant ist, dass Vonnegut und die Welt damals davon ausgingen, dazu gibt es eine verlegerische Vorbemerkung im Buch, dass in Dresden 135.000 Menschen starben. Heute weiß man, es waren zwischen 22.700 und 25.000. Die hohe sechsstellige Zahl kam nach der Bombardierung durch nationalsozialistische Propaganda in Umlauf.
Mai 2023 – Marseille en Mai – Redlich
Ich versuche wirklich, glücklich zu sein. Aber es fällt mir so schwer.
Mai 2023 – Marseille en Mai – Ringeltaube
Wir setzen uns mit was zu essen auf ein niedriges, schmales Mäuerchen auf einem Platz. Das Mäuerchen bildet ein rechteckiges Becken, groß genug für den Baum, der darin wachsen darf. Eine Ringeltaube, schlank, in hellem Grau, mit schwarzem Kragen, durchforstet den Boden, Blätter, Sand, Staub, Kippen, Müll, sie zerrt mit ihrem Schnabel an einem Zweiglein, holt es heraus. Nimmt es vorne, pickt es hinten, ziept und kämpft ein bisschen mit seiner Länge und Sperrigkeit – lässt es fallen. Ruckelt weiter, nimmt ein weiteres Zweiglein auf, diesmal kleiner, nicht so struppig an den Seiten – lässt es fallen. Onkelt weiter, scharrt sich zum nächsten Ästchen durch, dunkler, biegsamer dieses – nein, auch das ist es nicht. Weg damit.
Was will sie? Ein Nest bauen, wie wärs mit einem Blatt, nein, die interessieren sie nicht, nur die Zweiglein, Ästlein, Stöcklein sind es, die es ihr angetan haben. Ruckedigu, sie sucht, pickt, hebt auf, lässt fallen. Was ist es, was sie sieht, besser: erfasst, mit Schnabel, Augen, Fuß, sind es Länge, Gewicht, Farbe, Beschaffenheit, Konsistenz, was sind die Kriterien der Auswahl?
Sie durchwalkt den ganzen Baumarkt, nichts findet ihren Gefallen, all die unterschiedlichen Ästchen, die sie nun schon mit dem Schnabel aufgehoben und untersucht hat, keins davon ist das Richtige, was braucht sie?, muss sie ein Loch stopfen in ihrem Nest, muss sie ihr Nest verstärken, sichern, vervollständigen? Ein sehr spezifisches Teil jedenfalls muss es sein, was da gebraucht wird und das sie offenbar vor ihrem inneren Auge hat. Wir wissen es nicht, wir werden es nie begreifen. Die Taube zieht weiter, schmal und hübsch, zum nächsten Baum-Becken, gleich nebenan. Nein, hier ist nur Schrott, das sieht sie schon im Anflug. Nur kurz setzt sie ab, auf dem kröseligen Boden, guckt, dann fliegt sie fort. Weg hier. Vielleicht doch mal zu dem größeren Obi, raus ins Gewerbegebiet.
Marseille en Mai – Redlich
Ich versuche wirklich, glücklich zu sein. Aber es fällt mir so schwer.
Paranoid
Kürzlich fragt mich eine Freundin, ob ich eigentlich manchmal paranoid sei. Sie fragt nicht, weil sie annimmt oder findet, dass ich paranoid sei, sondern aus ehrlichem Interesse und weil sie selbst manchmal solche Tendenzen an sich erlebt. Zu meinem eigenen Erstaunen antworte ich mit Ja. Ja, ich bin es geworden. In den letzten Jahren. Nicht auf diese Art paranoid, wie man das landläufig versteht, also eine Verschwörung vermutend, davon ausgehend, dass im Geheimen systemisch-personelle Vorgänge im Hintergrund der Gesellschaft vor sich gehen, die man auch noch als einer der wenigen Wissenden zu durchschauen glaubt und womöglich vorausschauend darauf reagiert, Alu-Hut. Nein, so nicht. Einfach nur paranoid meinen Mitmenschen gegenüber.
Früher war ich nicht paranoid. Natürlich habe ich mich manchmal gefragt, was hinter meinem Rücken vor sich geht, ich habe geahnt oder gewusst, dass die Menschen in meiner Umgebung manchmal schlecht über mich reden, dass sie nicht immer ehrlich zu mir sind, dass sie Dinge tun, die sie mir lieber verschweigen. Aber ich habe darin nie so etwas wie eine böse Absicht oder ein strategisches Vorgehen gewittert, das dazu da ist, mir zu schaden. Ich habe das eher als Teil von sozialer Interaktion begriffen, als Aspekt von Beziehung, als Versuch, Komplexität zu reduzieren, wenn Kommunikation, Gefühlslagen, Bedürfnisse zu fordernd sind, um sie transparent zu machen. Doch in den letzten Jahren habe ich Situationen erlebt, in denen die Menschen in meiner Umgebung Dinge getan haben, die sich mit den Umständen in denen sie stecken, nicht entschuldigen oder erklären lassen. Handlungen, die nichts anderes sein konnten als strategisch angelegte Aktionen zur Erreichung eines persönlichen Ziels oder Vorteils durch die absichtsvoll herbeigeführte Verschlechterung der Situation einer anderen Person. Meiner Person.
Auch wenn ein Kern von Verständnis immer bleibt, hat das eine andere Qualität. Es ist das Erlebnis eines Betrugs. Es führt dazu, dass etwas entsteht, was man den Verlust von Vertrauen nennen kann. Der andere ist potentiell ein Feind, er ist gefährlich. Er ist in der Lage, Dinge zu tun, die man sich SO nicht hätte vorstellen können, Dinge, von denen man nicht gedacht hätte, dass DIESE Person sie JEMALS tun würde. Väter, Lebensgefährten, Freundinnen, Kolleginnen zum Beispiel. Menschen aus dem nahen Umfeld also, dem Umfeld, in dem man gar nicht existieren und agieren kann, ohne zu vertrauen.
Man könnte jetzt sagen, muss man das gleich Paranoia nennen, ist das nicht eher sowas wie gesundes Misstrauen. Das paranoide Gefühl kommt aber anders als das Misstrauen als Überfall daher, es ist ein Schock, ein Erlebnis, eine plötzliche Erkenntnis, dass alles ganz anders ist, als man immer angenommen hat, es erfasst einen als Angst. Davor, dass es tatsächlich so ist, wie man gerade begreift oder noch schlimmer: dass die ganze Angelegenheit eine Dimension haben könnte, die man auch jetzt, in diesem Moment, nicht mal ansatzweise erfasst hat. Ein Wissen, das sich in aller Plötzlichkeit einstellt, eine bittere Wahrheit. Der Eindruck der Bodenlosigkeit ist die Folge. Einmal erlebt, kann sich das paranoide Gefühl in anderen Zusammenhängen genauso überfallsartig wie von selbst wieder einstellen und dadurch Angst machen. Es hat das Potential schwelend zu werden, wenn du nicht das Glück hast, es zu vergessen, oder die Stärke, es aktiv beiseite zu schieben, dich dagegen zu entscheiden. Hier ist sie, die Schnittstelle zum Wahnsinn oder korrekter zum Pathologischen.
Die Schwester der Paranoia ist also die Einsamkeit. Das paranoide Gefühl trennt einen ab von allen anderen. Es zieht einem den Boden unter den Füßen weg. Auf dem stehen die anderen, alle anderen, aber nicht mehr man selbst. Vertrauen kann ab hier nur noch temporär vergeben und mit längerem Anlauf eingegangen werden. Sie macht einen selbst zu einem absichtsvoll agierenden Wesen. Das Vertrauen, das man hat, das man großzügig und ohne Hintergedanken zu geben bereit ist, weil man es für richtig, ja, für einen Wert hält, diesen Vorsprung zu geben, fällt plötzlich auf die Seite der Naivität, der Dummheit. Was hast duu denn gedacht? Sieht man doch in jeder Serie.
Das paranoide Gefühl, dem nahen Umfeld entsprungen, geht eine unglückliche, sich gegenseitig verstärkende Verbindung ein mit den Unsicherheits- und Einsamkeits-Erfahrungen der letzten Jahre, die auf anderen Ebenen erlebt wurden. Nicht nur von mir, sondern von der Menschheit. Dazu gehört die Pandemie mit ihrem Kern einer apokalyptischen Erfahrung, der Trumpismus als Chiffre für einen bis ins Innere von Demokratien reichenden Politikwandel, der ebendiese als Vorschlag behandelt, der erlebbar werdende Klimawandel, der die Liste möglicher Todesursachen um Sturm, Hitze, Wasser erweitert und konkrete Vorstellungen über ein Leben in der Zukunft aufruft sowie der Ukraine-Krieg mit seinen Auswirkungen auf die seit Generationen gewohnte geopolitische Weltaufteilung und die in ihm enthaltene Möglichkeit eines Dritten WK oder eines atomaren Supergaus, welcher Art auch immer.
Marseille en Mai – L’eau est bonne!
Wir gehen ein kleines, verstecktes Hafenbecken unter einer hohen Bogenbrücke entlang. Einfache, kantige Arbeiterhäuschen, die hellen Boote im Wasser wie überall hier dicht an dicht, ihre dünnen Masten gegen den blauen Himmel wie Spießchen an einer üppigen Tapas-Bar: para picar. Das Becken führt unter der Brücke weiter, öffnet sich nach links, ein großer Felsen auf der anderen Seite wird sichtbar. Darauf, schon von weitem hörbar, sitzen Jugendliche. Wie Vögel sitzen sie, dunkle Flecken in den Kuhlen und auf den Spitzen des Felsens, und schauen aufs Wasser, in die Weite, bewegen sich, zueinander, auseinander, richten sich auf und kauern sich nieder, gruppieren sich und vereinzeln sich wieder.
Das Becken grenzt das Meerwasser hier zu einem Pool ab, der Felsen als Längsseite eines Spaßbads. Das Wasser türkis und durchsichtig, Adria-Style, die Sonne brennt, die Jugendlichen lachen, flachsen, ich betrachte sie, im Gehen. Ein Junge, vielleicht 14, 15, klettert ins Becken, seine dicken Sneakers an, der Seeigel wegen, ein Mädchen kommt ihm nach, sie tauchen unter, tauchen auf, die Haare dunkel und glatt, schwimmen ein paar Züge, ihr Lachen ist zu hören, ihre Rufe, ihr Atem. Als sie aus dem Wasser kommen, gehen sie mit ihren Sachen auf der uns gegenüberliegenden Seite das Beckens entlang, der Junge vorne weg. „Madame!“, ruft er strahlend herüber und meint mich:
„L’eau est bonne!“
Eine Verkündung, ein Versprechen, ein Bedürfnis, das Glück zu teilen, es mit zu teilen, eine Versprechen, eine Versicherung, eine Antwort auf eine sich grundsätzlich stellende Frage, ein Versuch, Zuversicht zu verbreiten, eine Aussage, über das Wasser, das Leben.
Ich versuche, mir den Satz zu merken als wäre er ein Tattoo in meinem Hirn.
Marseille en Mai – How to be old?
Die Frage ist falsch. How to be ugly, how to be fat, how to be in constant pain, how to be sick, how to be immobile, how to be without body functions concerning sex, digesting, thinking, seeing, hearing, walking? How to be tired, how to be slow, how to be dumb? So muss die Frage lauten. Wie, wie, wie soll man das aushalten? Und warum? Wo sich doch hinter jeder Frage eine weitere Einschränkung des Lebens verbirgt. Als wär das nicht schon eingeschränkt genug.
How also: not to be depressed?
Marseille en Mai – So geht das
Ich lese Schlachthof 5. Auf meiner Liste seit ich im zweiten Airbnb-Apartment in Wien (Mai 2022) mehrere englische Vonnegut-Bücher im Regal gesehen habe, ein in den USA offenbar sehr, in Deutschland mehr oder weniger und mir gar nicht bekannter Autor. Obwohl er doch so unbekümmert Ausflüge ins Sci-Fi-Genre gemacht hat. Die junge Besitzerin der Wohnung jedenfalls, eine Amerikanerin in Wien, hatte offensichtlich ein Faible für ihn.
Schlachthof 5 also. ’69 geschrieben, als WK II, von dem Kurt Vonneguts alter ego Billy Pilgrim uns erzählt, schon länger vorbei ist, das Buch den Nerv des Diskurses über den Vietnamkrieg trifft und als Antikriegsbuch in die Literaturgeschichte eingeht. Billy Pilgrim berichtet, wie der Krieg, den er als amerikanischer Soldat und Gefangener in Deutschland erlebt hat, so war und was er aus ihm gemacht hat. Einen kaputten, unter den Eindrücken und Erlebnissen leidenden, belasteten und davon auf alle Zeit geprägten Billy Pilgrim nämlich. Kein Wunder also, dass Billy ein Zeitreisender ist, der uns mitnimmt in seine Vergangenheit, seine Zukunft und immer wieder zurück in seine Gegenwart. Denn überall dort hat der Krieg und alles, was Billy darin gesehen hat und erlitten hat, seine Spuren hinterlassen. Die Bilder, Gedanken und Erinnerungen aus der nicht enden wollenden Hölle, in der es, gerade wenn man denkt, dass es nicht mehr schlimmer kommen kann, immer noch schlimmer kommt, tragen ihn von einer Zeitebene in die andere. In lakonischem Ton beschreibt er, was passiert, sich selbst und seine Zustände. Er ist so geworfen in die Grausamkeiten und Absurditäten des Krieges, dass er darin nicht mehr als Handelnder erscheint, sondern manchmal beinahe drollig und tölpelhaft erscheint. Auch auf den Planeten Tralfamadore nimmt Billy uns mit, wohin er entführt wird, weil die Tralfamadorianer sich für die Spezies Mensch respektive ihren Vertreter Billy interessieren, ihn und die krieführende Menschheit aber mit technokratisch achselzuckendem Fatalismus betrachten, sodass auch diese an ein Delirium oder einen Morphiumtrip erinnernde Parallelwelt ebenfalls nicht wirklich als Entlastungsfantasie für Billy funktioniert.
Hinter der sich selbst nicht besonders ernst nehmenden Figur und dem Irrsinn der Ereignisse sind Billys Schmerz und Verzweiflung die ganze Zeit spürbar, genau wie der Wahnsinn, der Billy angesichts der Erlebnisse zu befallen droht, in den er sich flüchtet oder in den die Morphiumspritze ihn entlässt.
Ein einzelner kurzer Satz zieht sich wie ein Refrain, eine Interpunktion, ein grausames Mantra oder eine Lebensweisheit durch das Buch: So geht das. So it goes im Original. Jedesmal, wenn Billy, so zumindest mein Eindruck, schildert, wie und dass jemand gestorben ist, setzt er am Ende diesen Satz: So geht das.
Nachdem ich das Buch einmal komplett durchgelesen habe, merke ich erst, dass es mich erschüttert hat, vielleicht weil es auf diese seltsam leichte lakonisch-warme Weise die Verzweiflung eines Menschen beschreibt. Ich beginne noch einmal von vorn, um alle So geht das zu zählen. Ungewohnt nerdig für mich, aber es ist mir ein Bedürfnis, das zu tun, keine Ahnung warum. Vielleicht nur, um zu sehen, ob ich recht habe, mit meiner Vermutung, dass jedesmal jemand stirbt und die literarische Technik genauer zu untersuchen, vielleicht, weil ich es als Respekt vor den Toten empfinde, als Respekt auch vor Billy Pilgrim und seinem Autor Kurt Vonnegut, der all diese Totengeschichten gehört und erlebt hat. Ich komme auf 87 So geht das.
87mal kommt in diesem Buch jemand zu Tode. In 10 Kapiteln, auf 200 Seiten. Meistens ist es eine konkrete Person, einige Male sind es abstrakte Mengen wie Bevölkerungen von Städten, zweimal sind es Tiere, einmal ist es Billy selbst, der den „Zustand des Totseins“ dann aber wieder verlässt und überlebt. Einmal ist es Champagner, der nicht mehr blubbert und einmal Wasser, dessen Blasen es nicht mehr an die Oberfläche schaffen. Als an einer Stelle Läuse, Bakterien und Viren sterben, bekommen die kein So geht das. Sein, ja, wie soll man ihn nennen, Kamerad ist so ein fürchterliches Wort, sein Kriegsgefährte auf Zeit, Edward Derby, bekommt gleich 4 So geht das, sein Tod wird im Buch also mehrfach erwähnt. Zu Beginn spricht Billy davon, dass Derbys Tod der Höhepunkt des Buches sein wird, was dann aber nicht der Fall ist, Derby stirbt literarisch genauso brutal lapidar wie tatsächlich, doch die mehrfachen, mit So geht das geadelten Erwähnungen an unterschiedlichen Stellen des Buches verstärken den Eindruck, dass sein Tod für Billy ein ganz besonders schmerzvolles weil so widersinniges Ereignis kurz vor Kriegsende war, in dem der ganze absurde verschwenderische Wahnsinn des massenweisen Sterbens kulminiert.
In der neuen Übersetzung lautet der Satz übrigens: Wie das so geht.
Beim zweiten Lesen begreife ich noch mehr, wie Vonnegut seine Motive benutzt, um Billys unruhige Reise durch seine inneren Zeiten zu erzählen.
Interessant ist, dass ich noch nie davon gehört habe, dass die Deutschen amerikanische und englische Kriegsgefangene hatten. Bin ich die einzige? Ich frage ein bisschen herum, niemand hat davon gehört. Bemerkenswert.
Außerdem interessiert mich die Rezeption des Buches in Deutschland, immerhin geht es um den Bombenangriff auf Dresden, ein hier immer wieder und vor ein paar Jahren nochmal heftig hochgekochtes Thema, ein umstrittener Punkt von links bis extrem rechts, deutscher Opferdiskurs, Wiederaufbau der Frauenkirche, Diskussionen wie das Endes des Krieges zu interpretieren ist, bis heute veranstalten nationalsozialistische Gruppen sogenannten Trauermärsche, in der DDR gab es am Jahrestag kirchlich orientierte Friedensdemonstrationen. In der amerikanischen Lesart ist das Buch 1969 vor dem Hintergrund des Vietnamkriegs ja eher als Frage an die USA gerichtet, die ihre jungen Männer in einen Krieg geschickt, und ein Massaker angerichtet hat. Auch interessant ist, dass Vonnegut und die Welt damals davon ausgingen, dazu gibt es eine verlegerische Vorbemerkung im Buch, dass in Dresden 135.000 Menschen starben. Heute weiß man, es waren zwischen 22.700 und 25.000. Die hohe sechsstellige Zahl kam nach der Bombardierung durch nationalsozialistische Propaganda in Umlauf.
vor allem rechts. und so weiterdarum, dass die Deutschen amerikanische Kriegsgefangene genommen haben, der durch die Zeit reist, in seine Vergangenheit, seine Zukunft und immer wieder zurück in die Gegenwart, und
und welche Spuren er in ihm für seinen GEgenwart hinterlassen haben und in seiner Zukunft hinterlassen haben werden. er immer wieder weiltm er sich vielleicht im Delirium des Krankseins, durch Morphiumgabe ein Bis ins Delirium folgen wir ihm, entstanden durch schwere Krankheit, Morphiumgabe,
den Rand des Wahnsinns an den er sich getrieben sieht,
bis auf den die ihm widerfahren, dass er darin nicht als Handelnder die , lakonisch, im Modus der manchmal gerade zu drollig wirkenden Feststellung die Grausamkeit, im Modus der Feststellung des Absurden, , der Lakonie geschrieben, teilweise als Delirium oder Trip erzählt (eine Reise auf den Planeten Tralfamadore
Marseille en Mai 2023 – Stucki
Niemand wird diesem Buch gerecht, ist mein Eindruck. Hauptvorwurf: Es ist von einem Mann geschrieben, nicht von einer Frau. Es geht um eine bromance. Well … Es verfügt och wach Es geht um einen freund, der sich von einem Freund verabschiedet, mit dem ihn lange viel verbunden hat, bei allen unterschieden, bei aller Netzwerkartigkeitsaspekten, die die Beziehung hatte, jemand der dsagt, auch wenn ich dankbar dafür sein kann, dass du mich gemocht, eingeführt, ausgeführt und mir einen lukrativen Job mit allen kreativen Freieheiten gegeben. hast, bin ich jetzt, an dieser Stelle nicht mehr bereit, mich dir geenbüer loayl zu verhalten und kündige dir die bromance auf.
Die Großbuchstaben Headlines wie bei der Bildzeitung. Die zentrale frauenfigur mit einer rotzigen ansageartigen Sprache ausgestattet, dass es eine Freude ist und die Person weder schwach, noch sympathsich, noch außerhalb des Spiels zeichnet und trotzdem sagt, Recht hat sie. Sich zu wehren. Recht hben sie allesamt.
Der Boebachter ein bisschen zu gut weg, aber leicht macht er sichs auch nicht, außen vor ist er und doch mittendrin in der Spracheund dem sein , bemührt sich mit seinem 90er Zynismus im Status des Boebachters im sAttel zu halten.
Mai 2023 – Marseille en Mai – How to be old?
Die Frage ist falsch. How to be ugly, how to be fat, how to be in pain, how to be sick, how to be immobile, how to be without body functions concerning sex, digesting, thinking, seeing, hearing, walking? How to be tired, how to be slow, how to be dumb? So muss die Frage lauten. Wie, wie, wie soll man das aushalten? Und warum? Wo sich doch hinter jeder Frage eine weitere Einschränkung des Lebens verbirgt. Als wär das nicht schon eingeschränkt genug.
How also: not to be depressed?
Mai 2023 – Marseille en Mai – Gefährdet
Das Belohnungsprinzip trifft ins Mark, fällt wie kühler Regen auf ein erhitztes, durstiges Feld, endlich mal Anerkennung, endlich mal jemand, der STERNCHEN, HERZCHEN, SCHMETTERLINGE abfeuert im Überfluss, einfach nur weil du DA bist, der Punkte an dich verschleudert, noch einen Bonus obendrauf legt, weil du was NEXT-LEVEL! gut gemacht hast. Wann hat es das jemals gegeben? Mama, Papa, Arbeitgeber?
How not to get addicted.
Mai 2023 – M.
Ich hab meine Mutter nicht gekannt. Sie hatte einen Körper. In dem ich lag, in dem ich mich bewegt habe, der roch und feucht war. Dessen Enge mir nicht wie ein Gefängnis vorkam, erst am Schluss.
Ich erinnere mich an einen Rock, in dem ich sie mochte.
Es muss Liebe gegeben haben, bei aller Fremdheit, bei aller Enttäuschung, bei aller Irritation.
Das Wesen: Meine Mutter. Molluskenartig. Ihre Blässe, ihre Schüchternheit, ihre Scheu.
Mai 2023 – Wackelka
W. wackelt wieder. Ich rutsche in eine Depression und weiß nicht, was ich dagegen tun soll.
Wieso hat keiner Medis dagegen? Die man einfach mal einnimmt, ein paar Tage, Wochen, ein paar Better-Feeler, Light-Upper, gleich bei den ersten Anzeichen. Einwerfen, und wenns wieder geruckelt ist, Schluss damit. Die Reste aufgehoben im Schränkchen, fürs nächste Mal. Vielleicht bin ich deshalb heute hier, bin ich immer nur dann hier und deshalb? Gehts nicht mal ohne, Wackelka ohne Wackeln, nicht möglich? Anscheinend nicht.
April 2023 – writers block – 2
Ich bin so voll, so voller
ich bin so geladen
aufgeladen
Man müsste nur eine App an mich dranhängen,
die mit Bluetooth übertragen bekommt, was in mir drin ist und alles verschriftlicht.
Feine Drähte gingen auch, aber die tun vielleicht weh. Bluetooth ist moderner.
Doch solange es das nicht gibt,
bleibt alles in mir drin,
und ich platze,
weil ich nicht weiß, wie es heißt, wo es hingehört, wohin es getragen werden muss,
weil ich es weder sehen, noch hören, noch sprechen kann,
weil ich es verdammt nochmal
nicht schreiben kann!
Februar 2023 – so eine Frau
Ich gehe zur Wahl (Wiederholung!). Diesmal muss ich in die Kita, die in der Parallelstraße zu meiner liegt. Als ich durch den Hof gehe, in den ich von meiner Wohnung aus schaue, sehe ich das Haus, in dem ich wohne zum ersten Mal von dieser Seite. Ich bleibe stehen, suche für einen Moment die Stockwerke ab, bis ich sie habe, meine Wohnung. Den Balkon. Das Schlafzimmerfenster.
Da wohnt so eine Frau, denke ich. In diesem Kästchen. Neben anderen Kästchen. Manchmal sieht man sie im Sommer auf dem Balkon, die spärlichen Pflanzen gießen. Manchmal im Schlafzimmer, weil sie die Vorhänge zuzieht. Oder auf.
x-beliebig. Eine soziologische Einheit.
Heute mal angeschrieben vom Amt.
Februar 2023 – Wackelbeine
Männer, die mit Beinen wackeln. Sitzen in der U-Bahn, im Café, im Wartezimmer und
wackeln, wackeln, wackeln
mit dem Bein.
Rechts oder links, immer nur eins. Vornehmlich jung, die Männer. Schauen beim Wackeln gern aufs Handy. Handy auf der Nicht-Wackel-Seite. Logisch, sonst Wackel-Handy.
Wackel-Technik: Den Fußballen aufstellen, so dass die Ferse frei hängt, das Bein über die Knieachse rauf und runter bewegen, hohe Geschwindigkeit, kurzer Weg. Stundenlang.
Alter, was ist das?
Zu viel Energie, die raus muss? Stürme im Körper, im Geist, die übertragen werden ins Bein, um Ruhe herzustellen, im schwer umtobten Innern?
Unsicherheit? Der junge Männerkörper immer so da, so groß, so ungelenk, so wichtig. Wohin mit ihm?, ins Bein. Wohin mit seiner äußeren Betrachtung, wegwackeln ins Verschwommene, ins nicht genau Sichtbare, abgelenkt den Blick, fokussiert aufs Wackel-Bein? Wackeln aus Nervosität, Wackeln gegen das Unbehagen, den ständigen inneren Konflikt, externalisiert in eine nicht enden wollende Übersprungshandlung? Warum genau dorthin? Warum bei so vielen? Auf genau diese Art und Weise? Ist das Wackeln angenehm in der Bewegungs-Übertragung Richtung Leiste, Penis, schaukeln diese Männer sich also eigentlich die Eier, wenn sie mir gegenüber, neben mir sitzen, frage ich mich. Was geht da vor sich? Ist das ein kultureller Code, heißt wackeln, ich bin ein lockerer Typ, voll locker in der Hüfte?
Wenn du neben ihnen sitzt, Sitze, Stühle, Bänke mit ihnen teilst, wackelst du mit. Sie nehmen dich mit, auf ihre Wackelreise, mit rein, in ihre Wackeldynamik. Wenn sie merken, dass sie dich mitwackeln, hören sie auf. Kurz. Dann machen sie weiter, sie können nicht anders. Sie müssen wackeln, sie werden gewackelt. Sie wackeln sich. Sie wackeln.
Die Wackelkandidatin versteht das.
Februar 2023 – writers block – 1
Ich kann den Arm nicht heben, ich kann den Gedanken nicht fassen, ich habe Angst vor dem was passiert, wenn ich schreibe, vor dem Gefühl allumfassender, existentieller Sinnlosigeit meines Tuns, aus dem sich nichts ergibt, aus dem nichts folgt, bei allem Erfolg nichts folgt, das mich nirgendwo hinbringt, an keinen Ort, in kein Zuhause, das mich fallen lässt, am Ende, enttäuscht zurück lässt, enttäuscht von mir selbst, von anderen, verraten von Vertrauten, nicht verstanden, unverstanden, verstanden, aber was solls.
Januar 2023 – Ratzinger
Ratzinger wird in allen Ehren gewürdigt, von Spiegel über Zeit bis SZ sind sich alle einig, diese hochgewachste Leiche, die wir uns da gerade ansehen müssen, war ein großer Mann. Dass er ein Rechtsradikaler und Verbrecher war, der seiner Kirche treue und aktive Dienste dabei geleistet hat, Verbrecherisches zu begehen und Rechtsradikales zu verkünden und zu beschließen (vor der Staatsanwaltschaft geschützt durch die Staatsbürgerschaft einer Nation namens Vatikanstadt, wer hat das eigentlich beschlossen?) – darüber schreibt niemand.
Januar 2023 – was / nicht
Ich weiß nicht wovor ich mehr Angst habe
vor dem, was kommt
oder vor dem,
was nicht kommt
Dezember 2022 – Probealarm
Ich sitze bei Ikea über einem Kaffee für family member, da klingeln alle Handys auf einmal. Probealarm der Bundesregierung. Tränen steigen mir in die Augen. Der Warnton rührt
an eine Seite in mir.
Ich denke an meine Mutter, der die Tränen kamen, wenn die Düsenflieger in den 80ern über unser Haus schossen
und sie sich im Krieg befand, als Kind, auf dem Weg in den Bunker.
Da ist jemand, der sich Sorgen macht. Auch deshalb steigen die Tränen hoch, jemand, der es wissen muss, der das Szenario kennt. Das in der Luft liegt. Das aufgerufen wird vom Ton, ähnlich schrill wie damals, als ich das Kind eines ganz anderen Krieges war. Das Amt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.
Warnstufe: Extreme Gefahr. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Es besteht kein Handlungsbedarf. Dies ist ein Probealarm.
Kurzes Aufschauen, Schreck, Irritation, Lächeln, kurzes Gespräch dazu bei den Sitznachbarn hinter mir. Das wars. Alle essen weiter, Köttbullar jetzt auch vegan.
Ich ärgere mich, dass ich die Meldung nicht abfotografiert habe. Als ich vom Link zurückscrolle ist sie weg.
Dezember 2022 – Die Schale
Die Schale ist das Beste, was die Küche zu bieten hat. Sie ist das wichtigste Geschirr, das schönste Objekt. Sie ist es, die wir gereicht bekommen, in die man uns etwas schöpft oder eingießt, in die wir etwas tunken und tauchen. Die wir auslöffeln. Bis auf den Rest. Die wir halten, mit beiden Händen. In die wir schauen. Auf etwas Warmes, Dampfendes. Tröstendes. Die Schale ist die Wärmflasche unterm Essgeschirr. Sie ist es, die wir formen, mit den Händen. Die Schale ist die erste, die kleinstmögliche Einheit. Suppe. Tee. Reis, ein Gericht, ein Gedicht. Wir schieben und halten unser Gesicht über sie, kippen uns hinein in sie, damit sie uns umgibt, für einen Moment, mit dem,
was sie für uns bereithält.
Dezember 2022 – Dumme Gedanken
Endlich Zeit
um auf dumme Gedanken zu kommen
und nun kommen sie nicht.
Dezember 2022 – Jahresende
Ich hab Schiss. Keine Pflöcke eingeschlagen, keine Aufenthalte, keine Arbeiten, keine Früchte.
Immer dieses Jahresende, über das man drüber muss. Und dann geht alles wieder seinen Gang.
Das ist auch nicht gut.
Dezember 2022 – Age and Irritation
Jobgespräch. Wie alt bist du eigentlich? Als ich ihm sage wie alt, ist die Reaktion verheerend: Er kann es nicht glauben. Daraus folgt: a. Ich werde den Job nicht bekommen. b. Die Kollision zwischen dem, was ich bisher für ihn war (aufgrund meiner Arbeit, aufgrund meines angenommenen Alters), und dem, was das Faktum meines Alters aus mir macht, ist zu groß. Ich fühle mich, als hätte ich einen Betrug begangen.
Warum also lüge ich nicht einfach weiter wie bisher.
Dezember 2022 – Schlaf!
Der Schlaf ist zurück.
Ich: Murmeltier
die Augen seufzend klein, das Fell gezogen
über mich,
die Ohren
eingedreht
in die Wärme meines speckig gewordenen Backofenbauchs
so schlafe schlafe
und schlafe ich.
Es gibt keine Not
aufzuwachen des Nachts
Gedanken zu zerteilen, zu verschrauben, zu fräsen, zu hämmern,
keinen Grund des Morgens.
Draußen kann warten, drinnen ists ruhig. Ruhig, ruhiger. Sagen wir,
lange nicht so ruhig gewesen.
Oktober 2022 – Im Bus
Ein Koffer haut ab durch die Mitte
bis vorne zur Tür
Keine Chance.
Ein gelbes Blatt fällt auf den Sitz
Es hat sich gelöst
vom Parka eines Mannes
Auf seinem Telefon
ein Foto von ihm
und seinem Sohn
Nun sitzt er da.
Neben der Frau mit dem Stadtplan in der Hand.
Juli 2022 – Laube hüten – Notizen
Vasektomie
Die Vasektomie plötzlich Mode- und Partythema.
Wieso das jetzt? Klimawandel? Alter des Umfelds? Verhütung jetzt auch Männersache, weil Feminismus grade auch voll hip Männersache? Zu viele männerbiografische Erfahrungen mit Kind als Unfall bzw. Kind als Mogelpackung durch Frau?
double-bind
Diese ewige Doppel-Existenz zwischen „Jaja, wichtig, wichtig: der Körper“ einerseits und „Alles ist konstruiert“ andererseits. (im Selbst und im Diskurs)
Lider
Meine Augenlider werden immer schwerer.
Eines Tages werden sie so schwer sein, dass ich sie nicht mehr öffnen kann.
Bis dahin: wie knarzende Türen.
Yoga
Ich mache 20 Tage von 30 Yoga with Adrienne am Stück jeden Morgen, dann habe ich einen Hexenschuss, weil ich mich nach links wende, um das Licht anzuschalten.
Pillen
Leute nehmen Pillen, um out of control zu sein, ich nehme Pillen, um in control zu sein.
broken windows theory
Alle beklagen sich und leiden an der Lieblosigkeit der Welt, und alle schlussfolgern daraus, dass sie dann ja auch lieblos sein können, nun ists eh schon egal.
Die broken-windows-Theorie der Gefühle
ego alter
Der Egoismus der alten Leute, nicht mehr bereit, irgendwas aufzunehmen, höflich zu sein,
er bringt seine Fotos vorbei, fragt nicht, ob er sich setzen darf, tut es einfach, im Vertrauen darauf, dass alle anderen zu höflich sind, ihn in seinem unendlichen Redefluss zu stören, weil er ja alt ist, zurecht, ich kann mich nicht wehren, die Hinweise verhallen ungehört, das Reden muss raus, das Leben, die Leistungen, die Eckdaten, die Witze, ich fühle mich ausgebeutet, alter Trigger, M., L.,
Reden als Missbrauch
umgestülpt
Ich stelle mir vor, dass das Ende sich anfühlt als stülpe man sich um, als trete das Innere nach außen, wie bei einem Tier, das man aufschlitzt und alles was darin ist, nach außen drückt, als kotze man, aber langsam, nicht schwallartig, und an der Kotze hängt alles andere mit dran, und geht auch mit nach draußen, inklusive deinem Gehirn.
Drosophila
Ich scheuche eine Fruchtfliege auf, die empört, panisch, einen Moment orientierungslos, weil ich ihr die Lebensgrundlage geraubt habe, die Leinwand vor mir durchmisst wie ein Fleck im Auge.
Juli 2022 – Coronana
Das T. ist verblasst. Zumindest das T auf dem Corona-Test. Spät hats mich erwischt,
aber nun, im Sommer 2022, als Corona endemisch wurde, doch noch.
Viel ist passiert, über das ich mich ausgeschwiegen habe. Eine Pandemie, einen Trump und einen Krieg später melde ich mich zurück. Oder auch nicht. Wir werden sehen.
Auf T. folgt U. Wer hätte das gedacht. Ich nicht.
Abschied von Herrn Meutzner. Der mir am Ende die Hand gegeben hat. Stellvertretend für alle Berührungen, die nicht stattgefunden haben. Ein Narr, wer an sie denkt.
In Marokko gewesen. In Kroatien gewesen. Zwei Wochen in Wien verbracht.
Einen neuen Namen bekommen. Oder mir selbst gegeben.
Eine Serie abgeschlossen. Eine Staffel 2 abgelehnt. (schwierigste Entscheidung ever)
eine Klimakatastrophe am eigenen Leib gespürt.
eine re:publica mitgemacht.
Eine Systemumstellung erlitten, Samsung auf iphone, PC auf Apple.
Einen Alterungsschub später (Venen, Meno, Bauch, Hüftgold, Haut, Rücken).
Es tut mir leid, dass ich nicht geschrieben habe. Aber es ging nicht,
es wird mir leid tun.
Ich werde vermissen, was passiert ist,
Nur was dokumentiert ist, ist passiert. Nur was teilbar ist.
Ich habe nichts über meine Irritation angesichts der Kriegsbegeisterung geschrieben, die auch im 6. Monat nach Beginn bei Shitstorm-Strafe verboten ist.
ich habe nichs über Wien geschrieben, nichts über wokeness, nichts über den Sex, den ich gehabt habe, nichts über den Mann, den ich gefunden habe. Nichts über die Kinder, die in mein Leben getreten sind, ohne dass mich das begeistert. Mädchen noch dazu.
So weit. So kurz.
Details möglicherweise später.
Juni 2022 – Im Havelka
Im Havelka
Ich lese die FAZ, die war noch frei.
Ein alter Mann kommt rein, verdächtig dunkle Haare, heller Leinenanzug, dunkles Hemd, Hut, den er abnimmt, er hats schwer mit dem Laufen, wackelt zu seinem Tisch – offenbar ein guter Bekannter hier, der Oberkellner grüßt und organisiert kaum merklich, aber auf besondere Weise (für großes Aufheben ist er zu cool).
Der Mann wackelt an meinem Tisch vorbei, Is a guade, sagt er, und meint die FAZ. Die Zürcher find i noch besser.
Alles klar.
Er setzt sich an einen Tisch hinter mich, bestellt zu essen und einen Braunen.
Maria, hör ich ihn weinerlich betteln, a Busserl! Er meint die Köchin, a Busserl, Maria, komm, nur a kloans, immer wieder sagt er das, in diesem jammerigen Ton. Oder willst eins aufn Mund haben, Maria?
Ich kann nicht glauben, dass es so ein Exemplar wirklich gibt.
Vor mir liest einer die Süddeutsche, hinter sich ein Oscar-Werner-Plakat (gibt grade ne Ausstellung über ihn), ein anderer hat das Laptop offen, scrollt auf der Berghain-Seite herum.
Das sind hier so die Gleichzeitigkeiten.
Der Alte bettelt noch immer, langsam wird mir schlecht davon. Es nützt nichts, Maria kommt nicht raus aus ihrer Küche. Der Chef persönlich mischt sich schließlich ein, fragt die Küchenhilfe aus Budapest, die Allerschönste, wie der Jammerer sie nennt, der sich nun auf sie verlagert, sicher auch, um Maria eins auszuwischen, ob sie dem Herrn nicht ein Busserl geben will.
Wie im Bordell hier.
Hervorragend wars heute, höre ich den Alten irgendwann sagen.
Er steht auf, um zu Gehen. Kommt wieder an meinem Tisch vorbei.
Wir haben uns nicht weiter kennen gelernt. sagt er.
Nein, sage ich. Das haben wir nicht.
Es war mir eine Freude, er nimmt meine Hand. Seine Nägel rillig, die Haut trocken: Auf Wiedersehn.
Auf Wiedersehen, sage ich.
Er schwankt davon.
Lang wirds ihn nicht mehr geben.
Mai 2022 – Charlottenburg, KadeWe
Am Nachbartisch eine Mutter, blond, Zehlendorf-Typ in ihren Mid-50s, und ihre drei flüggen Kinder, 2 Mädchen, ein Junge, alle zwischen 19 und 25, gut gekleidet, aufgeräumt.
Eine Diskussion entbrennt, um „die Wohnung“ – Mama hat in den Raum geworfen, sie vermieten oder verkaufen zu wollen. Die Geschwister zanken, das Muttertier genießt, umrundet von ihren Küken, die wie früher im Spielzimmer, ihre Argumente ins Feld führen, ihre Strategien abfeuern, jedes auf seine in der Geschwisterkonstellation und in der Mutterbeziehung logische Art und Weise, warum sie die Wohnung unbedingt brauchen, haben müssen, ja, warum sie ihnen rein logisch aufgrund anderer biografischer Verteilungskämpfe und Zuteilungsentscheidungen zusteht. Der Junge, der Jüngste, laut und kindisch, die älteste Schwester ruhig und vernünftig, das Mittelkind gequält und in der Schweigeposition, so haben sie alle ihre Masche für sich, für Mama, ihren nicht weg zu denkenden Groll auf „die anderen“, die wie immer dies und schon wieder das machen, um zu bekommen, was sie wollen. Sie werden unterdrückt laut und leise heftig, sie sind unglücklich, beleidigt, gekränkt, und es wird klar, das ist nur eine Wohnung neben anderen, weil diese Familie eben Wohnungen hat, und es sich hier, bei diesem Zwist, nur um die in Berlin handelt, die der Junge jetzt sofort dringend möchte, weil er dort mit seinem buddy eine WG aufmachen will und weil die anderen die doch nur haben wollen, weil er sie haben will, und weil es fies ist, zu sagen, er könne sich gar nicht selbständig um eine Wohnung kümmern, er würde sie nur herunter wohnen,
niemand ist hier unsympathisch oder sympathisch, es ist nur mal wieder die alte Erkenntnis, dass auch die Kardashians Probleme haben, dass sie Mütter, Schwestern, Brüder sind, und den Papa,
nein, den lass mal raus,
der ist bei der Arbeit.
Mai 2022 – Das Neuste vom Body
Eine Unförmigkeit stellt sich ein, die ich zu bekämpfen versuche, so erfolglos wie irritierend. Eine Fremdheit im Körper, eine Langsamkeit, ja, Behäbigkeit,
im Schmerz
verharrend,
in der Anspannung.
So wird es sein. So ist es nun. Erahnt und gefürchtet, und dennoch nicht vorstellbar.
Mai 2022 – Malaga im Mai
Keine risikofreier Besuch. Trotzdem will ich ihn machen, kurz.
Im Flieger sitzt eine junge Frau neben mir, sie schreibt ununterbrochen. Sie ist nicht nett und killen könnte ich sie sowieso. So lange lost jetzt schon, was das Schreiben angeht. Worauf warte ich, Staffel 2, ha, wie sich alles entwickeln wird, ab März, April?
Ich finde die alten Gebäude neben den modernen. La Malagueta, ich sitze lange im Sand, dann in der Strandbar. Das kleine Café auf der Plaza hat bis März geschlossen. Den Zeitungsverkäufer finde ich nicht mehr, traurig-smiley, er war alt. Hat mir die SZ verkauft, ungerührt, und meine beiden geliebten Armreifen. Ich erinnere mich an Fotos, die ich gemacht habe, an Situationen, natürlich.
Andere T.s: Teurer, touristischer, trockener.
Enorme Hotelbauten, der ausgetrocknete Fluss noch immer Ort für Graffiti, Hunde, Skater,
ich geh gleich mal shoppen, die Weihnachtsbeleuchtung absurd bei warmen Sommerabend-Temperaturen.
Ich arbeite meine Liste ab, Castello de Gibralfaro, da bin ich das letzte Mal aber weniger aus der Puste gewesen, der Strand, der Hafen, die Innenstadt. Stundenlang.
Auch die Kakerlaken sind noch da, gestern Nacht, monstergroß von links nach rechts, fit und eklig.
Eine Ausstellung interessiert mich, aber ich muss noch das Ticket besorgen. Torrox Costa bei P., na was das wohl wird.
Mai 2022 – Tx, das Ende
Herr M.
Herr M. tickt, wie eine kleine App in mir, so heißt sie auch: Herr M. Die ich aufrufen kann. Jederzeit.
Die Tür
Die Tür, sagt er. Sie ist offen, aufgegangen. Sie stehen nicht mehr ohnmächtig davor und schreien. Die Welt hat sich als flexibler erwiesen. Die Tür ist auf. Sie müssen nicht durchgehen. Sie entscheiden.
9. Mai
Er gibt mir zum Abschied die Hand. Die fühlt sich gut an, fest, sehr gleich mit meiner. Wir haben uns nie berührt. Am Anfang?
Später, als ich weine, auf irgendeiner Toilette, wird mir klar, dass ich verliebt in ihn war.
April 2022 – Essaouira
Geräusche:
Möwen!
Muezzin – als gäben sie sich die Türen in die Hand. Dann verstummen sie plötzlich. Nach welchem Prinzip, undurchschaubar
Baustellen (Schlagbohrmaschine)
schlagende, klappende Türen
Palmenblätter, die vom Wind aneinander streifen
wie hilflose Grillen
April 2022 – Notiz
Ich habe mich immer in die väterliche Dynastie eingeschrieben.
Was war das?
Verrat?
Rettung?
Fluch?
Wäre man womöglich „männlicher“ (autarker, selbstbewusster, mehr bei sich) gewesen, hätte man sich auf die Frauen verlassen?
(Mama? – nein.)
März 2022 – Doku
Was nicht dokumentiert ist
ist nicht passiert.
Es hat nicht
stattgefunden.
ist nicht gewesen
existiert nicht.
Was aber ist eine Dokumentation?
das Foto? der Text? die Anwesenheit eines anderen?
check check und check
Der Mitschnitt von Auge, Herz, Hirn
Ihre Spuren im Inneren?
Wie vergeudet, leer
es sich anfühlt,
wenn niemand etwas weiß
wie sinnlos alles ist
ohne die Gerichtetheit
die Veräußerung.
In der Dokumentation:
die zumindest imaginierte
Nachwelt
März 2022 – Pandemie und Arbeit – 2
Zwei Jahre und zwei Monate später. Älter, müder, die Haut schlecht, Rosacea, die Poren größer, die Augenringe tiefer, die Lider geschlupfter, einen Armbruch, eine Hexenschuss-Episode, und eine 8-teilige Serie später, fahre ich zur Verwandtschaft.
Ich fühle mich wie eine Überlebende.
Februar 2022 – Schreibmodi
Ich bin in ständigem Kontakt, im ständigen Austausch
Ich schreibe gerichtet, an jemand,
über Dinge
zwischen A und B.
Ich ordne hübsch an, ich lege es hin und vor,
vor die Füße der anderen.
Das nimmt mich vollkommen ein.
Deshalb schreibe ich nicht mehr hier.
Januar 2022 – Felsbrocken
Das Jahr rollt auf mich zu wie ein Felsbrocken. Die Angst ist zurück.
Und was machst du jetzt?, fragt U.
Und was machst du heute?, fragt U.
Und erzählt mir, was er jetzt macht. Und heute.
Notiz
Der Wunsch nach Verständigung und gemocht werden ist riesig.
Was soll das? Warum ist das nicht einfach egal?
Notiz
Alles DRECK. keine Schreibkraft.
November 2021 – Pandemie
Momente unfassbarer Einsamkeit
November 2021 – Notiz
The wine
makes me drown
I’m crying.
Finally.
Water everywhere.
Mai 2021 – Familie
Ich bin ein Eindringling. In eine Welt, die anderen gehört. Allein durch meine Anwesenheit füge ich jemandem Schmerzen zu. An den Wänden Bilder voller Bindung, Liebe, Glück.
Mai 2021 – Haut und Haar
Da ist ein Mensch in meinem Bett. Er ist nackt, er riecht, er hat Haut und Haar. Das ist unfassbar. Meine Hände wissen nicht, was sie tun sollen. Meine Haut versteht nicht, was passiert. Über zwei Jahre hat mich niemand berührt, geschweige denn geküsst, niemand hat seinen Körper mit meinem in Verbindung bringen wollen. Obendrauf: Über ein Jahr habe ich nicht mal meine Freunde umarmt, mich hinter Masken und Abständen von den anderen abgesondert. Nicht ein einziges Mal bin ich krank gewesen, so abgeschottet und allein im All, weit weg von den Bakto-Viralen-Planeten der anderen. Jetzt die totale Kollision. Die Erfahrung ist nicht wie erwartet sensationell, sondern vor allem irritierend, überfordernd. In der folgenden Woche bekomme ich alles auf einmal: Herpes, Pilze, Erkältungen.
Ich reagiere nicht so wie ich gedacht hätte. Ich weine nicht. Ich hab nicht das Gefühl des letzten Abschieds, der nun von meiner Seite vollzogenen Trennung, des Betrugs oder Verrats an der Sache, meiner Sache, der Liebe, der Trauer. Es scheint ein Leichtes, es zu überschreiben, nicht mal als ich den Morgenmantel anhabe, den T. mir geschenkt hat, zucke ich mit der Wimper. Dennoch. In den Räumen hängt es schwer.
April 2021 – Abnahme
Ich bekomme den Anruf an meinem Geburtstag. Ich gehe nicht dran. Ich weiß, was man mir sagen wird. Ich bin glücklich. Am nächsten Tag erst rufe ich zurück. Da ist es noch überwältigend genug.
April 2021 – Macht und Herrschaft
Machtapparat.
Herrschaftswissen.
Warum hast du mir nicht gesagt, dass T was mit S hatte.
Warum hast du mir nicht gesagt, wie es dir geht. Was du verdammt nochmal denkst und empfindest.
Und warum, warum hast du mir so gerne so viel vorenthalten.
Herrschaftswissen.
Machtapparat. Sich entziehen. Sich fremd machen. Geheim sein.
April 2021 – die 20er
Ich hab doch gesagt, die 20er werden wild. Alles war durcheinander damals, Klimakatastrophe, Flüchtlingsthema, Trumpismus, alles war am Kochen und Protestieren, man hatte das Gefühl, labil zu sein, zu langsam zu sein für die schnelle Zeit, es gab Wut und Ideen, Vorschläge und Forderungen, die Welt tanzte.
Wir sind in Gefahr.
April 2021 – Pandemie und Arbeit – 1
Die Arbeit rettet mich. Arbeit als Sucht, zum ersten Mal in meinem Leben. Ich bin high, ich finds geil. Mein Körper leidet, kratzt seine Warnsignale in die Innenwände meiner Schädeldecke. Der Kater wird fürchterlich sein. Aber bis dahin dauert es noch lange.
November 2020 – verkehrte Welt
Ein junges Mädchen fühlt sich wegen der Corona-Maßnahmen wie Anne Frank. Eingesperrt, als Opfer der Umstände. Eine junge Frau wie Sophie Scholl. Weil sie Widerstand leistet, gegen die Bedrohung durchs Unrechts-Regime. Mir bleibt echt die Spucke weg.
Vielleicht sollten wir uns mal über unser Bildungssystem Sorgen machen.
Februar 2021 – T72
Beim Therapeuten gewesen,
die letzte Stunde nochmal aufgegriffen und lange über T. gesprochen, die ewigen Träume und die Fragen, die alle ins Leere gestellt sind.
Februar 2021 – an der Haltestelle
Ich stehe an der Tramhaltestelle. Es ist kalt, ich trage eine Mütze, die Kapuze vom Pulli obendrüber, eine Stoffmaske im Gesicht, einen langen Mantel an und rede ehrlich gesagt vor mich hin. Muss ja keiner wissen, was ich so unter meiner Maske mache. Plötzlich spricht mich jemand von hinten an. Hi, entschuldige, – ich drehe mich um. Da steht ein Typ, vielleicht Anfang dreißig, im aktuell gebührenden Abstand, einen Mund-Nase-Schutz auf. Ich finde du siehst gut aus, sagt er. Ich muss beinahe lachen. Ich meine, woher will er das wissen, er hat mich von hinten gesehen (oder hat er mich von der anderen Straßenseite ausgecheckt?), ich bin von oben bis unten zugedeckt, so kurz vor Vollverschleierung. Du hast so schöne blonde Haare, sagt er. Er meint die splissigen, nach einem Lockdown-Lockerungs-Friseurbesuch schreienden Zipfel, die unter meiner Mütze hervorgucken. Oh, sage ich, und lächle verlegen ob der schief liegenden Gesamtsituation. Ich wollte dich nicht erschrecken, sagt er. Okay, sage ich, und nicke. Aber ich weiß jetzt auch nicht, was zu tun ist, er steht da, seine Augen über der Maske, ein heller Parka, auch von ihm ist nicht viel zu sehen, will ich mit ihm einen Kaffee trinken, nein, will ich mit ihm ein paar Meter Richtung nach Hause laufen, nein, er ist viel zu weit weg, viel zu jung, er macht mir Komplimente für was Äußerliches. Wirst du oft angesprochen, fragt er. Nein, sage ich wahrheitsgemäß, eigentlich nicht. Wie machen das denn die anderen Männer, fragt er. Und dabei klingt er für einen Moment so traurig und hilflos und einsam und irritiert, von all dem zwar jeweils nur ein bisschen, aber es reicht doch, um mich innerlich in die Knie gehen zu lassen, so sehr rührt mich das. Ich weiß so sehr, was er durchmacht, und ich kann ihm nicht helfen, ich kann nichts für ihn tun, ich weiß es doch auch nicht, denke ich, ich hab doch auch keine Ahnung wie es geht, wie es gehen soll. Kann das nicht einfach alles mal aufhören. Kann das nicht einfach alles mal anders sein. Ich ziehe den Stecker. Jetzt ist es mir doch ein bisschen unangenehm, sage ich zu ihm, denn das ist es,
aber ich danke dir für dein Kompliment.
Er trollt sich.
Februar 2021 – T71
Beim Therapeuten gewesen,
über das irritierende Gespräch mit einer Regisseurin gesprochen und die Frage, ob ich Attacken gegen mich schlicht nicht wahrnehme oder einfach nur so tue, als existierten sie nicht.
Februar 2021 – T70
Beim Therapeuten gewesen,
übers Einsamsein gesprochen, von der „medical emergency“-Situation erzählt, der nicht angesprochenen Traurigkeit bei C. am Telefon, eine Kurve über M. gemacht, die mich heute so wenig erkennt wie früher, zur Frage des Sichzeigens gekommen und again, über trial and error als Methode.
Januar 2021 – T69
Beim Therapeuten gewesen,
über das neue Büro gesprochen, das sich anfühlt wie eine WG und eine Perspektive. Ein Lob bekommen.
Januar 2021 – Wotan 2
Überrascht muss ja keiner mehr sein, von gar nix. Doch als ich einen Artikel lese, in dem darauf hingewiesen wird, dass Trump bei einem blutigen Aufstand den NOTSTAND hätte ausrufen können, und was ihm das ermöglicht hätte, nämlich unter anderem einfach im Amt zu verbleiben, erschrecke ich doch.
Januar 2021 – Schöne Söhne
Mein Therapeut gibt mir einen Satz von seiner Oma mit auf den Weg. „Andere Mütter haben auch – in Ihrem Fall muss es heißen – schöne Söhne.“ Er sagt ihn mir, als würde er mir was schenken und ich fühl mich auch beschenkt. Weil es mir etwas über ihn erzählt. Und weil er mir diesen Satz, einen Satz, den alle Omas sagen, ein Spruch ja eher, übergibt wie einen Schatz, den er einmal bekommen hat und der ihm einmal geholfen hat, und auch wenn es mir schwer fällt, beziehungsweise ich mich aus persönlichen Gründen dagegen wehre, diese etwas abgestandene Kalenderweisheit zu glauben, ist sie mir plötzlich etwas wert und erscheint mir wahr und eine Möglichkeit, sie zu denken.
Januar 2021 – T68
Beim Therapeuten gewesen,
nochmal über letzte Stunde nachgedacht und die Frage, was T und J miteinander zu tun haben.
Januar 2021 – T67
Beim Therapeuten gewesen,
nochmal an letzte Stunde angeknüpft, einen Turning Point festgehalten, über J.s Erkrankung gesprochen, die Angst, die das auslöst, das schlechte Gewissen und die Frage, wie ich eigentlich Beziehungen beende.
Januar 2021 – Wotan 1
Nachts wache ich auf, huch, hab ich was übersehen, eine Eilmeldung sagt an, dass Demonstranten das Kapitol gestürmt haben, ich klicke herum, bin genervt vom Öffentlich Rechtlichen, das nicht in der Lage ist eine Livesendung zu installieren, die letzte tagesschau ist Stunden her, heute, ZDF info, nicht mal Phoenix ist wach, irgendwo läuft Hans Albers, macht ja nix, überfallen ja nur ein paar von Trump angefeuerte AltRights mit Südstaatenflagge, Wotanknoten-Tattoo, Camp Auschwitz-T-Shirt das Kapitol. Aber so hab ich wenigstens was, worauf ich meine Aufregung verschieben kann.
Januar 2021 – T66
Beim Therapeuten gewesen,
über Weihnachten als persönliche Alleinsein-Challenge gesprochen und den wie geplant erarbeiteten und abgeschickten Brief an T.
Dezember 2020 – Corona – TestTest
Mein erster Corona-Test. Ich hab Symptome, in jedem anderen Jahr hätte ich gesagt Magen-Darm-Grippe, aber bevor ich zum Superspreader werde, will ichs lieber wissen. Überall sprießen die privaten Teststationen aus dem Boden, Auguststraße, Moritzplatz. 49,90 für einen Antikörpertest, 99,90 für einen PCR-Test, die Leute stehen Schlange wie vorm Berghain, wo das nicht mehr geht. Übers Gesundheitsamt oder den Hausarzt dauerts einfach zu lang, man muss ewig aufs Ergebnis warten (Labore am Anschlag) und bis dahin in Quarantäne. Das will ja keiner.
Ein junger Mann schiebt mir ein langes Wattestäbchen in die Nase bis nach hinten in den Rachen und dreht dort fünfmal um. Im anderen Nasenloch das gleiche. Es gibt Angenehmeres, aber nach zwanzig Minuten ist das Brennen weg und das Ergebnis da: Negativ ist das neue positiv! Dazu hab ich auch noch meinen riesen Batzen Text zufrieden abgegeben, jetzt bin ich frei!
Dezember 2020 – Merry Lonemas
Weihnachten nehm ich dieses Jahr als personal Challenge. Wenn ich in den letzten beiden Jahren etwas verstanden habe, dann, dass ich allein bin. Dann bin ich jetzt eben auch allein. Ich muss mir nur überlegen wie. Wie ich es einrichten, wie ich es überstehen, überleben kann. Niemand ist hier oder hat Zeit, alle sind bei ihren Faa-mii-lien, das (früher mit T. zusammen veranstaltetes, insofern auch nicht unbelastetes) „Dinner für die Daheimgebliebenen“ ist praktisch unmöglich. Es bleibt keiner daheim – Corona hat Weihnachten und Familie nochmal so richtig hochgefahren, da bleibt kein Auge trocken, Merkel: lieber jetzt Zähne zusammen beißen, damit die Menschen Weihnachten mit der Familie feiern können, die Familie, die Familie, das wird hier so langsam zum politischen Fetisch. Gleichzeitig wird kräftig über Einsamkeit feuilletoniert.
Am Ende gibt es dann tatsächlich haarkleine, von der Politik ausgearbeitete Regelungen zur Verwandtschaft ersten Grades, nicht, dass sich da Patchwork oder Wahlverwandtschaft oder irgendsowas reinmogelt, ins Blut- und Bodengefüge. Mutti kocht, Vati fährt, Opi sitzt im Sessel und die Kinder haben Glanz in den Augen.
Aus Lockdown light wird Lockdown hart, keiner hat es anders erwartet. Die Zahlen sind schlecht und bleiben es hartnäckig. Der Winter wird schrecklich.
Dezember 2020 – T65
Beim Therapeuten gewesen,
über meine Überlegung gesprochen, am Ende von zwei Jahren Trennung eine Markierung zu setzen und T. zu schreiben, um etwas loszuwerden,
über die Frage nachgedacht, ob das das alte Muster heraufbeschwört oder etwas neues.
Dezember 2020 – T64
Beim Therapeuten gewesen,
über den Job geredet und wie happy ich darüber bin, dass das Schreiben wieder funktioniert.
Dezember 2020 – umworben
Auf der Straße laufe ich an einem Typ vorbei, vielleicht Mitte Ende zwanzig, er telefoniert. Laut spricht er ins Telefon, gereizt, Heute ist Donnerstag, sagt er, da kann man ja wohl langsam mal fragen, ob man was macht am Wochenende, und du meldest dich ja nicht – auf der anderen Seite spricht sie zurück, Ja, is schon klar, schon klar, spricht er jetzt noch lauter über sie drüber, ich versteh schon, ich habs kapiert, genau genommen ist schon am Schreien, du willst umworben werden, du willst eine Prinzessin sein, ist okay, hab ich kein Problem mit, aber vielleicht kannst du ja auch mal….
Überall das gleiche Elend.
November 2020 – entspannte Frau
Scrolle mit G. durch den Männerkatalog bei ok cupid.
Ein Typ schreibt: Entspannte Frau gesucht.
Wir fangen beide gleichzeitig an zu lachen.
Na, dann such mal schön.
November 2020 – Corona 39 – Lockdown light
Light ist eigentlich gar nichts mehr.
Jedes WE werden die Demos größer, die Leute aggressiver, Querdenker, die was von Sophie Scholl faseln und Anne Frank, alles wird immer noch bodenloser, im telegram-Kanal treffen sich die Wahnsinnigen.
Museum Kino Theater Club Café Bar Restaurant, alles zu. Die Mall hat offen. Außerdem Schule und Arbeit. Eigentlich müsste ein harter Lockdown her, aber angesichts der protestierenden Massen und des bevorstehenden heiligen Festes traut sich das auch keiner mehr. Außer Merkel, von der sich die Ministerpräsidenten gerne gar nix mehr sagen lassen.
Kurz vor dem Lockdown überfällt mich die Platzangst. Ich komm hier nicht mehr raus. Die Türen gehen zu und angesichts der Zahlen und des bevorstehenden Winters werden sie es lange, lange bleiben. Ich brauche einen Moment, um zu adaptieren, es von mir weg zu halten, das mulmige Gefühl, mich zu fokussieren, auf das, was möglich ist. Ich überlege eine Bar zu eröffnen, drei Haushalte darf man in Berlin zusammen führen, ließen sich also zwei Leute mit Abstand und German Stoßlüften bespaßen. Aber ich muss eh die ganze Zeit arbeiten.
November 2020 – T63
Beim Therapeuten gewesen,
darüber gesprochen, dass ich T. nicht gratuliert habe, geweint.
November 2020 – Der Rückzug ins Private
1
Am frühen Morgen, die Nacht ist nicht zu Ende, bekomme ich Regelschmerzen, sie werden heftiger, weiten sich zu üblen Krämpfen aus, ich versuche noch, mit Buscopan und Schmerztabletten dagegen zu halten, aber es ist zu spät, im Bad kippe ich beinahe um, lege mich schnell noch auf den kalten Boden, stöhne laut. So ungefähr müssen sich Wehen anfühlen, in meinem Rücken kratzt eine Hexe mit langen Fingernägeln von innen gegen die Wand, der rechte Eierstock brennt, meine Gebärmutter bäumt sich auf, richtet sich auf, bereit, irgendetwas hervorzubringen, abzustoßen, auszustoßen, der hochgepresste Bauch drückt auf den Darm, der sich entleert. Ich bekomme Angst. Was, wenn es was anderes ist, was wenn ich in Ohnmacht falle, meine Zunge verschlucke, ersticke, was, wenn ich es nicht mehr schaffe, den Notarzt zu rufen, soll ich den Notarzt rufen, normal ist das nicht, vielleicht eine Eierstockentzündung, ich hab das nicht zum ersten Mal, eine Zyste, hat meine Frauenärztin später vermutet, ich ziehe die Beine an, ich wiege mich hin und her, ich stöhne und stöhne und versuche zwischendurch ruhig zu atmen, ein paar Mal schreie ich auf. Ich denke an T., an seine Hand auf meinem Bauch, daran, dass ich C. anrufen könnte, was nicht geht, daran, dass ich N. anrufen könnte was nicht geht, daran, dass ich J. anrufen könnte, was nicht geht, weil all das nichts ist, womit man irgendjemand um diese Uhrzeit belästigt, denn was, was, was sollen sie tun, niemand, niemand, niemand, kann jemand für mich sein, der seine Hand auf meinen Bauch legt. Ich wiege mich hin und her, warum wirkt das Busco nicht, ich bin ohne Kontrolle, inzwischen ist es halb 8. Ich rufe J. an, im selben Moment weiß ich, dass das falsch ist, ich schäme mich, lege rasch auf. Langsam werde ich ruhiger, noch eine Stunde dann ist alles ruhig, nur ich fix und fertig wie nach einer Teufelsaustreibung.
Später, am frühen Abend ruft J. mich an. Ich hätte heute morgen um acht mal angerufen, da schläft er ja noch und hat das Handy aus, war was? Ich: Nein, sorry, butt call, das Handy liegt ja oft neben mir im Bett, muss ich irgendwie draufgekommen sein.
2
Ts. Geburtstag. Kein guter Tag. Ich werde ihm nicht gratulieren. Ich weiß nicht mehr warum, es scheint mir schal und verboten und sinnvoll etwas anderes zu probieren als sonst. Ich bin traurig traurig traurig. Ich kämpfe mit mir, denn das geht gegen meine Natur, ich rufe C. an, spreche mit ihr, über dies und das, wir lachen, es ist nett, es tut gut. T. hat heute Geburtstag, denke ich, ganz laut, während wir reden, und ich werde ihm nicht gratulieren und ich bin so unfassbar, unfassbar traurig. Dann legen wir auf.
3
Ich streite mit Ct herum, zum ersten Mal nach langer Zeit spreche ich die Trennung von T. an, fange an zu heulen, doof und betrunken mitten in der Kneipe, weil sich auch die Brücke zwischen uns seitdem einfach nicht mehr schlagen lässt, nicht von ihm zu mir, nicht von mir zu ihm. Du bist nicht allein, sagt er, als wir uns verabschieden. Ich weiß wirklich nicht, was er meint.
November 2020 – Das schönste Geschenk
Ich mache T. das schönste Geschenk zu seinem Geburtstag. Ich gratuliere ihm nicht. Ich erfülle ihm seinen Wunsch. Ich bin still, weg, verschwunden.
November 2020 – Trump
Am Ende verliert Trump die Wahl, aber dem Braten ist nicht zu trauen.
Seltsam wie die Lücken plötzlich sichtbar werden, im System. Wie kann das sein, dass eine Verfassung auf so vielen ungeschriebenen Gesetzen beruht, wie kann es sein, dass ein demokratisches System sich darauf verlässt, dass der Präsident schon den Anstand haben wird, dem Gewinner der Wahl zu gratulieren, bis zum 20.Januar (!) das Weiße Haus zu räumen, in der langen, langen Zeit bis dahin keine Falschbehauptungen über Wahlbetrug so oft in die Welt zu setzen, dass man ihm glaubt, alle notwendigen Geheimdienstinformationen zu übergeben, sich nicht seiner geradezu königlichen Befugnisse zu bedienen, dass er schon nicht vorhaben wird, einen Schurkenstaat zu errichten, seine Feinde zu feuern, seine Anhänger auf den richtigen Posten zu installieren oder sie zu begnadigen, womöglich sich selbst zu begnadigen, einen Putsch vorzubereiten, einen Krieg anzuzetteln, eine Atombombe abzuwerfen, oder wenigstens auf die letzten Meter bis die Stimmen endlich endlich ausgezählt und alle juristischen Möglichkeiten gegen das Wahlergebnis ausgeschöpft sind, noch ein paar Leute mit der Giftspritze zu erledigen? Ernsthaft, was, wenn der da nicht rausgeht?
November 2020 – T62
Beim Therapeuten gewesen,
über das schwarze Loch gesprochen, in das alles fällt, statt dass sich was aufbaut, die Triade aus Denken, Fühlen und Handeln kennen gelernt.
November 2020 – Corona 38 – Ans Tageslicht
Was Corona so alles hervorbringt.
In der Fleischfabrik herrschen nicht nur für Tiere unwürdige Zustände, auch Menschen werden hier eingepfercht, nicht artgerecht gehalten und gehen zugrunde.
Auf einer Nerzfarm in Dänemark bricht das Coronavirus aus, alle Nerze werden getötet und in ein Massengrab geschaufelt – aus dem sie ein paar Tage später wieder hervor quellen, weil niemand das Ausmaß ihres Fäulnisprozesses bedacht hat, der sie wieder nach oben treibt. Es ist erlaubt, mitten in Europa Nerze zu züchten, Tiere, die nicht mal gegessen werden, sondern lediglich zur Herstellung von Pelzen produziert werden.
November 2020 – T61
Beim Therapeuten gewesen,
über die Frustration beim Job gesprochen und einen hilfreichen Satz entwickelt: Ich kann das mitbestimmen.
Oktober 2020 – T60
Beim Therapeuten gewesen,
über den Job gesprochen und über die Angst und Belastung und das Nummer-zu-groß-Gefühl, das er jetzt mit sich bringt und auf lange Perspektive mit sich bringen wird, und den heimlichen Wunsch, es möge einfach vorbei sein.
Oktober 2020 – T59
Beim Therapeuten gwesen,
über den Job gesprochen, die Schwierigkeit meine Rolle dabei zu finden, und den Umgang mit der autobiografischen Nähe zur Hauptfigur.
Oktober 2020 – T58
Beim Therapeuten gewesen,
über Ts. Ausübung von „Herrschaftswissen“ gesprochen, und über den Versuch, mit Ct in der Kneipe eine Annäherung zu T. als Tabuthema zu wagen, mit ähnlich mäßigem Erfolg wie bei C.
Oktober 2020 – prokrastinieren
Ich laufe im Modus der Prokrastination durch die Fressabteilung des Kadewe – Komme gerade von der Therapie, da bin ich hungrig und durchgekocht.
Ein älterer Mann in Hemd und Jogginghose geht vor mir zur Toilette, leicht unsicher im Tritt, zwei verschiedene Schuhe an den Füßen, ein Bremsstreifen ziert die Hose an der entsprechenden Stelle, er muss sie also auch schon mal anders herum getragen haben. Als ich dann noch seine Augen sehe, ist das hier meine Diagnose: Demenz. Wahrscheinlich abgehauen aus dem Pflegeheim oder von daheim wo seine Frau ihn pflegt. Angesichts der Symbole auf den Türen zögert er kurz, öffnet dann die Tür zum Herren-WC, schließt sie aber wieder, als er einen Herrn darin entdeckt, wendet sich der Tür mit dem anderen Icon zu, der Damentoilette. Da waren Sie richtig, sage ich, nicke ihm bestätigend zu und öffne ihm die Tür zur Herrentoilette. Er stiert mich an, auf der Suche nach allem, was ihm das sagen soll, mein Gesicht, meine Worte, und verschwindet dann artig hinter der Tür.
Später sehe ich ihn wieder. Er tapert an den Regalen mit Dosen aus aller Welt entlang, an den Vitrinen mit Fisch, Brot, und Kuchen, an den Stehtischen mit Austern, Champagner und Kaviar, wegen seines Hemdes und seiner gekämmten Haaren nicht auf den ersten Blick als Störfaktor erkennbar, der Nachrichtensprecher-Effekt, erst aber der Hüfte geht’s bergab. Soll ich ein Fass aufmachen, ihn ansprechen, ihn fragen, ob man ihm helfen kann, ihm vorschlagen, dass man ihn nach Hause bringt, jemanden aufmerksam machen auf ihn, jemanden rufen, der ihm hilft? Nein, warum. Er ist erfolgreich ausgebüchst, hat allen ein Schnippchen geschlagen und macht sich einen schönen Tag. Genau wie ich. Er und ich, wir prokrastinieren hier gemeinsam und auf Luxusniveau, er seine Krankheit, seinen Pflegeknast, ich meine Arbeit. Und im Kadewe kann man stundenlang im Kreis laufen, ohne sich weh zu tun.
Das einzige, was mir später Sorgen bereitet, ist, dass er keine Maske trägt.
Oktober 2020 – Bademantel-Scam
Als ich am frühen Abend nach Hause komme, steht der Mann meiner älteren Nachbarin in Bademantel vor seinem SUV in der Feuerwehreinfahrt. Der SUV ist der größte, den ich je gesehen habe, alle Türen sind sperrangelweit geöffnet. Im Auto stehen haufenweise Kisten und Gegenstände, die er nach irgendeiner Logik vom Kofferraum auf die Rückbank und wieder zurück räumt. Als er mich sieht, kommt er auf mich zu und ergreift die Gelegenheit, mich von der Seite anzuquatschen. Ob ich einen Schlüssel für die Feuerwehreinfahrt habe? Die Feuerwehreinfahrt ist ein breites Tor, das in unseren Hof führt, in dem Parken nicht erlaubt ist, in dem aber trotzdem immer irgendwelche Pappenheimer parken und morgens um 7 alle aufwecken, weil sie den Zündschlüssel umdrehen und das Motorengeräusch die Wände hochwummern lassen. Er ist also einer dieser Pappenheimer!
Ich: Nö.
Er hatte einen Schlüssel, aber der ist abgebrochen. Er hält den abgebrochenen Schlüssel hoch. Der Anblick des abgebrochenen Schlüssels löst in mir nicht die gewünschte Reaktion aus. Er setzt noch einen drauf, deutet die Straße rauf und runter, kein Parkplatz, seine Frau krank. Warum er nicht einfach zur Wohnungsbaugesellschaft geht und fragt, ob er einen nachmachen kann, will ich wissen. Er murmelt irgendwas Unverständliches, gestikuliert ein bisschen, so dass ich mir schon Sorgen mache, ob der Bademantel auch hält, und hat dann einen besseren Vorschlag. Ich könnte zur Nachbarin im Nebenhaus gehen und ihr sagen, dass ich den Schlüssel für den Hof brauche. Die hat nämlich einen. Und wenn sie ihn mir dann gegeben hat, so erläutert er mir weiter unseren Plan, dann gebe ich ihn ihm und dann macht er den Schlüssel für sich nach. Ich frage, warum er denn nicht zur Nachbarin geht. Er hat aktuell nicht das beste Verhältnis zu ihr, warum ist ja jetzt egal. (Wahrscheinlich weil er einer der Pappenheimer ist, die immer im Hof parken und damit wiederum ihr ihren Pappenheimer-Parkplatz wegnimmt.).
Irgendwie tut er mir leid. Für mich wirkt er so unfassbar aus der Zeit gefallen mit seinem riesigen Auto mit dem er alle paar Wochen in einer halben Stunde von München hier hochbraust (mein Verdacht ist ja, dass er dort eine nicht-kranke Zweitfrau hat), dabei: was soll er sonst machen, wie soll er einkaufen und der Frau alles vorbeibringen, was sie braucht. Ich wiederum muss ihm sowas von dumm und schwer von capé vorkommen, weil ich nicht begreife, dass sein Bedürfnis das logischste und normalste von der Welt ist, weil in dieser Welt alle ein Auto haben und Parkplatzprobleme und man sich da doch unterstützen muss.
So stehen wir
und so gehen wir
auseinander.
Trotzdem, ich mag ihn. Wo sonst kriegt man hier in Mitte einen Nachbarn in Bademantel und Puschen zu sehen. Er ist mit Abstand der coolste SUV Fahrer hier.
Oktober 2020 – T57
Beim Therapeuten gewesen,
das Für und Wider der anstehenden Familienreise besprochen, ungeduldig geworden, weil mir das Thema nicht wichtig genug erscheint, mich am Ende deshalb noch schnell in einem riesigen Rundumschlag beklagt, dass sich das alles nicht wie leben anfühlt, sondern wie übers Leben drüber retten, gesagt bekommen, dass das jetzt eben mein Job sei, mich zu retten.
Oktober 2020 – Mitte
Zurück in Mitte. Die Wände kommen näher, die Kälte kriecht höher, die Männer sind unsympathisch, der Friseur schneidet die Haar falsch. Die Baustelle ist not over. Das Rollkommando aus Weihnachten und Silvester kommt auf mich zu. Auch Ts Geburtstag im November ist nicht zuträglich. Und Corona zieht wieder an. Was mach ich hier?
September 2020 – Bye-bye Kreuzberg,
tschüss und Tesekküler für einen schönen Sommer!
September 2020 – Pathologisierung
Man kann das alles pathologisieren wie man will, aber Fakt ist, T. wäre begeistert dabei gewesen, bei meinem Besuch am BER, bei meinem abseitigen Kinointeresse im Zeughaus, bei tausend anderen Dingen, die ich mache und liebe.
Es ist nicht verboten, traurig zu sein.
Es ist nicht verboten, jemanden zu vermissen.
Es ist nicht verboten, einem Leben hinterher zu trauern, das reich war.
Es ist nicht verboten, unter einem Verlust zu leiden.
Es ist nicht verboten, Angst zu haben.
Warum nur denke ich immerzu, es sei verboten und ich müsse es aus mir heraus prügeln? Heilt man denn durch Prügel? Heilen. Also doch krank? Prügeln tut man die, die nicht spuren. Die zu langsam sind, zu schlecht.
September 2020 – T56
Beim Therapeuten gewesen,
über das häufig auftretende Gefühl gesprochen, lediglich eine Lücke zu überbrücken, wenn ich allein bin.
September 2020 – T55
Beim Therapeuten gewesen,
über Kindheitskram gesprochen, versucht, die Verbindung zu den aktuellen Schwierigkeiten herzustellen, geweint.
September 2020 – T54
Beim Therapeuten gewesen,
von der Begegnung mit dem Typ im Café erzählt und über die Verunsicherung gesprochen, die seine Ablehnung und sein Desinteresse ausgelöst haben.
September 2020 – BER
Ich heiße Anunciata Franco, trage eine grüne Warnweste mit der Aufschrift Probetesterin, ziehe einen schwer gefüllten rosa Rollkoffer hinter mir her, der mit einem riesigen gelben Kreuz bemalt ist, um Missverständnisse zu vermeiden, und versuche mich zu orientieren: Wo ist der Check in? Ist das hier die Sicherheitskontrolle? Wo ist mein Gate? Weiter zum Boarding!
Ich fliege heute nach Kutaissi (drittgrößte Stadt Georgiens, aber das weiß ich erst, nachdem ich gegooglet hab), komme zurück aus Bournemouth, reise als Ida Franz nach Dubrovnik und lande mit dem Flieger aus Salzburg. Alles in knapp vier Stunden, ein wilder Ritt.
Die Wege sind lang, zwischendurch bekomme ich Kaffee und Wasser und kümmere mich um die Erfüllung meiner Sonderaufgabe: MwSt zurück holen, ich bin nämlich EU-Ausländerin und war in Europa shoppen. Die Jungs vom Zoll sind nett.
Als ich auf den Flieger warte, esse ich die beiden Brötchen, die man mir belegt hat und schaue auf das riesige, hauptsächlich leere Flugfeld, auf dem ein paar Easy Jet Maschinen mit abgedeckten Turbinen stehen, damit kein Vogel darin nistet. Mein Flug wird storniert, wir bitten die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
Mich begeistert die Arbeit der Firma, die das hier logistisch ausgefuchst hat, 500 Komparsen und echte Mitarbeiter, schwer befüllte Fake-Koffer, Sondergepäck und Storylines für alle Normali- und Eventualitäten, sowas zu organisieren muss Spaß machen. Meinen BER Kaffeebecher jedenfalls werde ich in Ehren halten.
Architektonisch ist dieser Flughafen alles andere als ein großer Wurf, immerhin, die Abflughalle ist hell und aus viel Glas, die Wartebereiche vorm Boarding aber eher so Anleihen an den alten Schönefelder Heizungskeller, zu eng, keine Sitzgelegenheiten, der Fluggast als Schlachtvieh, die Beschilderung irritierend unlogisch (mein Hauptkritikpunkt beim Auswertungsfragebogen), wer hat sich da verkünstelt, das Weinrot und die Holzpaneele naja, eher so deutsches Wohnzimmer, hat ja auch was,
alles in allem,
kann man mal aufmachen, jetzt, den Flughafen!
August September 2020 – Begegnung
1
Morgens bei bestem Wetter auf dem Bänkchen vorm Cafe. Die Straße vor mir ist gesperrt, Filmdreh, wie so oft hier. Ein Typ setzt sich neben mich, hat sich ebenfalls Kaffee geholt, wir lächeln uns zu – und gucken beide schnell wieder weg. Oha. Der ist aber nett.
Vor uns plustern sich die Produktionswagen der Filmproduktion zu einer Wand auf. Durch eine Lücke zwischen zwei Wohnmobilen sehen wir wie auf einer Guckkastenbühne zwei Polizisten, die auf der Straße hin und herlaufen. Der eine hats mit einem LKW-Fahrer, ruft ihm irgendwas Ironisches zu, weil der meint, er kann hier einfach so reinfahren. Von links kommt der andere ins Bild, mischt sich ein, beide wieder ab. Dann wieder der erste von links, ein riesiges Sandwich in der Hand, in das er kraftvoll reinbeißt. Der Typ und ich müssen beide gleichzeitig anfangen zu lachen, Gehören die dazu? fragt er. Wir beobachten gemeinsam den weiteren Verlauf der Show: ein bekannter Schauspieler setzt sich mit seinem Cappuccino uns gegenüber, ein Abschleppwagen kommt, lädt einen kleinen PKW auf, der wie eingeklemmt zwischen den Produktionswagen übrig geblieben ist, der Besitzer des PKW kommt angelaufen, Dont mess with Filmdreh, sage ich. Während der ganzen Zeit unterhalten wir uns immer wieder kurz, zwischendurch daddelt jeder auf seinem Handy rum oder nur ich. Ich bin nervös. Das ist nett hier, mit uns. Aber vielleicht bilde ich mir alles nur ein. Was mach ich, mach ich was, mach ichs wie neulich, mach ich nix oder was ganz anderes? Ich bringe meinen Kaffeebecher rein, gehe raus, an ihm vorbei und wünsche ihm einen schönen Tag. Mehr nicht. Ich hab hohe Schuhe an, yeah, Rarität, ich hoffe, er guckt mir wenigstens ein bisschen hinterher.
Ein paar Tage später seh ich ihn in einem anderen Cafe um die Ecke, ist er das? Er hängt auf dem Sofa rum, guckt auf sein Tablet, ich glaube, er hat mich gesehen, ich trau mich nicht, so genau hinzuschauen, ignoriere ihn, eh not in the mood heute, ich will draußen sitzen außerdem, die Sonne scheint und ich muss schreiben. Und: Er kann ja auch was machen, wenn er will.
Wieder gehen ein, zwei Tage ins Land, da sehe ich ihn von weitem, plötzlich mit einer anderen Frisur, die Haare im Knoten auf dem Kopf. Eindeutig ein Nachbar, wenn der immer hier rumhängt.
Sehe ihn in Café Nummer 2 wieder, offensichtlich sein Stammladen. Er sitzt drin, ich setze mich raus. Klappe den Rechner auf, arbeite. Er hat mich gesehen, ich bin sicher. Als er den Laden verlässt, an mir vorbeikommt, guckt er mich an, ich ihn, jetzt oder nie, Hey, sage ich, haben wir uns nicht neulich im Dings-Cafe unterhalten. Ja, sagt er, ich dacht auch schon. Da sind wir wohl Nachbarn, sage ich. Ja, sagt er. Wir lächeln uns an. Dann sehen wir uns, sagt er. Ja, sage ich. Er schließt die Haustür auf, aha, wohnt direkt nebenan.
Ich bin happy. Nichts davon tut weh. Alles ist einfach. Ein bisschen aufregend, anregend. Nichts weiter.
Wieder im ersten Café. Ich blicke von meiner Lektüre hoch, sehe ihn aus den Augenwinkeln. Er ist stehen geblieben, er muss an mir vorbei gelaufen sein, er muss mich gesehen haben, er steht da, tut, als überlege er, ob er jetzt vielleicht auch einen Kaffee braucht. Ich gucke absichtlich nicht hin – gleich kommt G. und wir wollen weiter, da hab ich jetzt keine Lust zu, wenn er sich jetzt setzt und das der Moment ist, in dem wir uns unterhalten und kennen lernen könnten und dann kommt da jemand anderes dazu, ein Mann, und ich muss aufstehen und gehen und er denkt noch, hat sie was mit dem. Außerdem ist es mir peinlich vor G. Ich trinke hastig aus, lasse den Becher stehen und gehe schnell weg. Blödsinn, denke ich zuhause.
Einmal laufe ich abends die Straße hoch, vielleicht seh ich ihn ja. Später wieder runter. Ich treffe ihn nicht.
Trotzdem. In der ganzen Zeit bin ich ganz ruhig. Ich weiß, dass ich den Typ wiedersehen werde. Ich weiß, dass ich mit ihm reden werde. Ich weiß es einfach. Ich weiß es. Ab und zu fällt er mir ein, aber nicht allzu oft. Dann denke ich ein bisschen über ihn nach, sammele meine Eindrücke, was er so anhatte, nach was er so aussieht, darüber, was funktioniert hat, an unserer Kommunikation, was nicht, dass ich fahrig war, ein bisschen lahm im Kopf, seine Witze zu spät verstanden habe, dass er nervös war, genau wie ich, dass ich jetzt schon weiß, was ich doof an ihm finden könnte, aber das ist mir egal, im Gegenteil, ich muss lächeln über unsere flaws, die da so offen liegen, auf den Cafétischen, ohne dass es was ausmacht, alles ist ruhig, alles ist angenehm, alles fühlt sich vollkommen logisch und organisch an, es macht keinen Druck, ich hab mein Leben, ich hab zu tun, und er ist jemand, der nett sein könnte.
2
Ein paar Tage gehen ins Land. Ich bringe eine große Abgabe hinter mich und der Moment ist gekommen. Ich stehe morgens auf und beschließe: Heute ist es so weit. Ich wasche mir die Haare, ziehe einen Rock an, schminke mich ein kleines bisschen, die Sonne scheint, ich gehe los, nehme meinen Rechner mit, damit ich arbeiten kann, falls alles anders ist. Ich bestelle einen Cappuccino, setze mich raus in die Sonne. Ich sitze keine fünf Minuten, da geht die Haustür auf, der Typ kommt raus, wir schauen uns an, lächeln, ich sage: Hey, hallo, er sagt, Ah, hallo, die Nachbarin, als wären wir verabredet, und das sind wir ja auch. Das wird ein schöner Tag, sage ich, und er sagt, Ja, und ein Motzverkäufer bleibt vor ihm stehen und sagt auch Hallo und er sagt, Nein danke und Mensch, da kommt man morgens raus und wird von allen Seiten angesprochen, und ich lache und sage, ich hab heute frei und er sagt, ich hol mir mal einen Kaffee und das macht er und dann kommt er raus und fragt, ob er sich neben mich setzen darf, was ich wahnsinnig nett finde und dann setzt er sich und wir reden 2 und Dreiviertel Stunden.
Es ist nicht irre toll. Er gefällt mir nicht wahnsinnig gut. Aber er ist nett und und im großen und ganzen witzig und es läuft irgendwie gut durch und immer weiter und wir lachen und es ist überraschend vertraut und einmal sagt er, also dass wir darüber schon reden!, und zwischendurch ist es auch mal still und geht nicht weiter und dann aber doch, und er fragt mich, wie ich heiße und er heißt N.
Irgendwann ist dann auch mal gut. Bevor ich gehe, beschließe ich, ihm meine Mailadresse zu geben, die er sich ins Handy notiert.
Später, zuhause, denke ich: Naja.
Ich fahre ein paar Tage weg und denke überhaupt nicht an ihn.
Dann komme ich zurück. Ich freue mich, weil ich denke, dass er sich melden wird. Ich hab ihm ja erzählt, dass ich Montag zurück bin. Das Wetter ist fantastisch, ich will an den Schlachtensee, eine Kinokarte habe ich auch noch übrig, vielleicht passt ja was. Er meldet sich nicht. Am Mittwoch scheint die Sonne, es ist nochmal richtig heiß, ich hab solche Lust, jemand zu küssen, mit jemand zu schlafen. Ich fahre allein an den Schlachtensee. Ich gehe allein ins Kino. Das ist alles okay, ich komme gut klar, kann das sogar genießen. Am Donnerstag begreife ich: Er hat sich nicht gemeldet. Er wird sich auch nicht mehr melden, dafür ist es jetzt zu spät. Das kann tausend Gründe haben, aber vor allem einen: Er will nicht. Er will mich nicht treffen, er will sich nicht melden, er will mich nicht, er will nichts. Irgendwann bin ich mir nicht mal mehr sicher, ob er sich meine Adresse wirklich aufgeschrieben oder nur so getan hat, als würde er sie in sein Handy tippen. Die ganze Zeit war alles gut, ich war offen, frei, entspannt, ich war bei mir, aber jetzt, jetzt, wo er sich nicht meldet, will ich unbedingt, dass er sich meldet. Plötzlich will ich ihn haben. Und er mich nicht.
Und alles. Gerät. Aus dem Ruder.
3
Die Woche vergeht. Die nächste Woche auch. Ich würde gerne ins Café 2 gehen und merke, dass ich es meide, weil ich ihn treffen könnte. Das, denke ich, mach ich jetzt nicht, das sind auch meine Räume.
Ich gehe hin, zusammen mit meinem Laptop, und da sitzt er. Vor dem Café. In der Sonne. Shit. Hallo, sage ich beim Reingehen. Er grüßt zurück. Ich kaufe einen Cappuccino. Ich will nicht drin sitzen, ich will raus. Er ist noch da. Seine Tasse ist leer. Er ist sitzen geblieben. Von innen kann ich sehen: fast alle Plätze draußen sind belegt, einer direkt neben den parkenden Autos ist frei. Und einer neben ihm. An einem großen Tisch.
Später frage ich an dieser Stelle meinen Therapeuten. Was, glauben Sie, hab ich gemacht? – Er kennt mich gut.
Darf ich mich hier hinsetzen, frage ich den Typ. Ja, klar. Wieder reden wir zwei angenehme, kreisende Stunden. Es geht viel um unsere Berufe. Er ist heute anders als sonst very leisure gekleidet, das Café sein zweites Zuhause. Ein bisschen habe ich den Eindruck, es geht ihm heute nicht so gut. Ich mag ihn auch diesmal wieder. Am Ende gehen wir auseinander. Bis bald, sagt er. Ja, sage ich, bis bald.
Ich gehe davon und kann nicht umhin, enttäuscht zu sein. Da ist jemand, der nichts möchte. Außer reden. Mit der Nachbarin. Jemand, der mich nicht anziehend findet, sondern einfach nur ganz nett. Nicht wie ich, die sich gefragt hat, ob er nicht der sein könnte, den ich küssen, mit dem ich schlafen könnte.
Aber das ist doch was, sagt G. Es ist was anderes, aber es ist was.
Warum, frag ich mich, aufgewühlt, unruhig, verzweifelt und ohne Boden, gehe ich immer dahin, wo man mich ablehnt. Warum, frage ich meinen Therapeuten, habe ich mich da hingesetzt, neben ihn, warum gehe ich immer wieder dahin, um mir das abzuholen: Ablehnung, Kränkung, Demütigung. Warum kapier ichs nicht, warum kann ich das nicht begreifen, wahrnehmen, annehmen, dass da jemand ist, der einfach nicht auf mich steht, nichts von mir will, nicht mal so viel, dass er Lust gehabt hätte, unsere Treffen mithilfe meiner Mailadresse dem Zufall zu entreißen. Warum, frag ich ihn, suche ich mir so jemanden raus, jemand, der mit sich beschäftigt ist und sein möchte und mit sonst niemand bzw. jemand anderem als mir. Warum verstehe ich die Welt nicht, warum gehen Dinge vor sich, die ich nicht verstehe, falsch interpretiere, warum kann ich die Codes nicht lesen, nicht mal sehen? Ich löse mich auf, ich werde paranoid, die Angst überfällt mich. Der Therapeut beruhigt mich. Nichts an meinem Verhalten hält er für inadäquat. Im Gegenteil.
4
Wieder gehen ein paar Tage ins Land. Der Donnerstag entwickelt sich zum Emotional Roller Coaster Day. Es ist der Tag vor einem Meeting, Feedback auf meine Abgabe, in großer, offizieller Runde, Home Office mit vier Leuten. Ich bin aufgeregt. Am späten Nachmittag meldet sich der Anwalt spricht mir auf die Box: Der Vertrag ist durch! Als ich seine Nachricht höre, balle ich triumphierend die Faust: Yes! denke ich, Yes, Yes, fucking Yes, ich bin drin, suckers! Ich staune. Erstens war mir gar nicht klar, dass mich das mit dem ungeklärten Vertrag offensichtlich doch irgendwie die ganze Zeit beunruhigt hat. Und zweitens staune ich, dass ich so ein Hoch davon habe, es geschafft zu haben. Ich mach euch alle platt, denke ich.
Ich bereite den Arbeitsplatz vor, da ruft C. an. Wir reden ein bisschen, es geht um eine Sache mit B. und ich ärgere mich, dass sie meinen Punkt nicht versteht. Wir fangen an zu streiten, es ist nicht einfach ein Streit, es geht ans Alte und Eingemachte, es geht um den anderen Punkt, den sie nicht verstanden hat, etwas, das seit nun fast zwei Jahren zwischen uns steht und von mir zum Tabuthema erklärt wurde, damit wir überhaupt weitermachen konnten, um den tiefen Bruch, den die Sache mit T. und ihre Folgen auch für uns beide ausgelöst hat. Es geht um meine Wut, meine Enttäuschung, darüber, dass sie (genau wie damals bei D.) nicht verstanden hat, was mein Schmerz war, darüber dass es in ihr diese Verachtung gibt, für etwas, das sie für Schwäche hält, um ihre Enttäuschung darüber, dass ich nicht anders damit umgehen kann, um die nervöse Ungeduld, die sie mir entgegen bringt, weil ich so hartnäckig feststecke, um meine Auflehnung gegen all das, meine Weigerung, diesen abwertenden Impulsen zu folgen, die ich von mir selbst kenne, mich zu wehren dagegen, mich zu retten davor, mich zu schützen vor ihr, der ich ein tiefes Misstrauen entgegen bringe seitdem, ausgerechnet ihr, die alles getan hat und jederzeit wieder tun würde, um mir zu helfen, mich zu unterstützen und mich bei ihr aufzunehmen. Am Ende sage ich ihr, dass ich sie lieb habe. Woran sie das merken soll, weiß ich auch nicht. Ich bin ja nur noch bei mir.
Danach muss ich raus und laufen. Ich bin durchgekocht. Traurig und unglücklich wegen T., und allem, was das angerichtet hat, ausgerechnet heute Abend, vor dem großen Tag, wo ich doch gerade noch so voller Energie war, ich laufe und laufe und laufe, laufe alles raus, den Kottbusser Damm in mich rein. Was will ich hier, ich weiß es nicht, ich will laufen.
Unschlüssig, ob und wo ich was essen soll, lande ich schließlich bei einem winzig kleinen Italiener bei dem ich noch nie war. Ist der neu oder ist er mir noch nie aufgefallen? Ich bestelle Pasta mit Tomatensauce und als ich anfange zu essen, ist diese Pasta so gut, dass sie sich mit ihrer Tomatensauce um meine arme abgekämpfte Seele legt, und mich tröstet. Wirklich, wirklich tröstet. Ich glaube, das hatte ich noch nie. Dass Essen als Trost funktioniert.
Während des Essens schaue ich raus auf die Straße. Der Sommer neigt sich dem Ende zu. Draußen ist es kühler, nicht mehr lange, dann ziehe ich zurück in meine Wohnung. In meine vier Wände, die die Tendenz haben, auf mich zuzukommen. Da bekomme eine Nachricht auf mein Handy. Es ist N. Ob ich morgen Vormittag Lust und Zeit habe, einen Kaffee zu trinken?
Ich bin glücklich.
5
Ich antworte ihm am nächsten Morgen. Lust schon, aber leider keine Zeit wegen Besprechung. Ich bleibe so knapp wie er, kündige nichts an, nicht mal, dass ich mich danach melde. Er wünscht mir noch schnell Glück, dann ist die Besprechung.
Nach der Besprechung bin ich erschöpft bis ins Mark. Alles entgleitet mir, stellt sich in Frage. Es wird schwer werden, hier meine Rolle zu finden. Das Wetter hat nochmal angezogen. Es ist kalt, es regnet in Strömen, ich bin zu nichts in der Lage.
Am späten Nachmittag gehe ich ins Berghain. Ha!, von wegen – Kunst gucken, so weit ist es gekommen mit Corona. Ich habe ein Online-Ticket ergattert, wandle allein, aber zufrieden durch die heiligen Hallen. Ob das nochmal so wird wie es mal war, und wenn, wird es sich nicht anfühlen wie ein Abziehbild dessen, was es mal war? Alles hier wirkt irgendwie retrospektiv. Wie eine Reminiszenz an sich selbst. Was, wenn die Ära mit Corona zu Ende ist?
Später gehe ich in die Badewanne. Zum ersten Mal seit ich von T. getrennt bin. Das geht nur, weil ich nicht zuhause bin, sondern in der Untermietswohnung. Ich gebe mir Mühe, Tee, Kerze. Erst abends habe ich genug Abstand zwischen mich und die Besprechung gebracht, um mir einen nächsten Tag vorstellen zu können. Ich schreibe N. eine Nachricht. Wir wärs morgen Vormittag mit einem Kaffee? Er antwortet schnell. Dass wir über das Wo nicht reden müssen, bringt mich zum Lächeln.
6
Wir quatschen zwei Stunden, wir lachen viel. Erzählen uns unsere Biografien. Wir verlassen das Café, drehen eine Runde. Seltsam wie unterschiedlich die Menschen Räume erleben, beleben, ich würde nach rechts gehen, er geht nach links. Hier würde ich dorthin gehen, er steuert woanders hin. Glücklicherweise haben wir einen ähnlich schnellen Schritt. Wie diese Dinge eine Rolle spielen, zum Problem werden können, verhandelt werden müssen. Mein timing-Gefühl stimmt nicht, er will früher wieder zurück. Er sieht die Dinge an und sieht etwas anderes als ich. Trotzdem. Alles fühlt sich gut an, wie alle in so einem Stadium suchen und finden wir Ähnliches, Trennendes wird sichtbar, ohne dass es groß was macht, es gehört dazu, zu dieser Geschichte, und die Geschichte ist gut. Alles ist im Hier und Jetzt. Ich hab keine Angst. Ich bin stolz. Das hier geht weiter. Wohin auch immer, ich segle mit.
7
Zwei Tage später schreibe ich ihm eine Nachricht. Inzwischen hab ich viel an unser Treffen und an ihn und mich gedacht, habe hübsche Ideen entwickelt, in meinem Kopf, was wir so alles zusammen tun könnten, habe ihn in Anspielung auf einen Witz, den wir gemacht haben, zum Essen eingeladen, war was mit ihm trinken, habe ihn geküsst, bin mit ihm an die Nordsee gefahren, die er mag und ich nicht, habe mit ihm geschlafen, war mit ihm im Kino und bei dem kleinen Italiener. Ich fange bei Letzterem an und frage ihn, ob er Lust hat, am Abend dorthin mitzukommen.
Er antwortet, knapp vor der vorgeschlagenen Uhrzeit, und sagt ab, anstrengender Tag. Ich wünsche ihm einen schönen Abend. Er mir auch. Er ist nett, höflich. Korrekt.
Er meldet sich nie mehr.
August 2020 – Alte Gewächse in frischem Gelb
O. schickt mir ein Foto. Ein Demonstrant auf dem Alexanderplatz trägt einen Ganzkörperschutzanzug in Gelb. Über seiner rechten Schulter eine große Umhängetasche in Blau, darauf steht: schön lyrisch unter einander: Klimawahn, Schuldkult, Impfzwang, Multikulti, Gendergaga. In der linken Hand trägt er eine rotes Schild. „Hygiene“ steht in Runenschrift darauf. Sein Arm verdeckt kaum das, was darüber steht: Deutsche, Deutsche Hygiene.
Den Feind in der Tasche, das Ziel vor Augen.
Was wächst da heran.
August 2020 – T53
Beim Therapeuten gewesen,
über seine Frage an mich gesprochen, ob ein Kontakt zu T. nochmal sinnvoll wäre, überrascht, irritiert und aufgewühlt davon gewesen, wo kommt das denn jetzt her?
August 2020 – Lesson to love
Sitze mit einer Freundin auf einer Bank am Oranienplatz und quatsche. Ein Junge, vielleicht 12, kommt auf seinem Rad vorbei, stoppt direkt vor uns ab, dass der Boden staubt. Salaam Aleikum! sagt er. Ich so: Hey, hi. Er so: Das heißt Aleikum Salaam.
August 2020 – T52
Beim Therapeuten gewesen,
gefragt, ob er eigentlich den Eindruck hat, dass es besser wird, darüber gesprochen, auf welch fruchtbaren Boden die Sache mit T. gefallen ist. Also nein?
August 2020 – T51
Beim Therapeuten gewesen,
schlechte Laune gehabt oder bekommen, fahrig herum argumentiert, schon wieder von wegen in die Falle tappen: Beziehungen, Hoffnung, warum eigentlich nicht einfach und endgültig mal aufhören, loslassen, diesen beschissenen Motor zum Verstummen bringen, als ich draußen bin habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich so herumgewütet hab, der Arme.
August 2020 – T50
Beim Therapeuten gewesen,
auf Nachfrage erneut über das Gefühl „in die Falle zu tappen“ gesprochen und über den Streit mit J. am Telefon.
August 2020 – dümpeln
Seit Wochen stelle ich mir immer wieder die Frage, weshalb Enten beim Dümpeln eigentlich nicht nach vorne umkippen. Einen Loop machen. Wollen sie nicht oder können sie nicht?
Man merkt, dass Sommer ist…
August 2020 – Hetoo
Ich erzähle einem Freund von der jahrzehntelang geheim gehaltenen Parallelbeziehung meines Vaters zu einer 30 Jahre jüngeren Frau. Ein Verhältnis, das begonnen hat, als sie 15 war.
Ein ladies man, dein Vater, sagt er anerkennend.
Wie ich das hasse.
August 2020 – T49
Beim Therapeuten gewesen,
über das Zusammenwohnen in der WG gesprochen, darüber, wie gut mir das tut, und welche Erkenntnisse daraus folgen.
August 2020 – Meckerfixierung 6
Blinken is ja auch out, ne? ich steh da an der Straße und die Leute blinken nicht mehr, stehlen mir meine Zeit, denn wenn ich früher wüsste, wo sie hinwollen, könnte ich schon mal rüber über die Straße, aber nein, da sitzen sie in ihren Autos und machen’s spannend, denn egal wohin, ob links oder rechts, sie kommen zuerst, die wird schon sehen, wo ich hinfahre, wenn ich wo hinfahre, das ist noch früh genug, denn wo ich hinfahre, geht niemand was an, außer mich, und die anderen können so lange im Regen stehen und gucken, wo sie bleiben, bzw. gucken, wo ich bleibe, alle Augen gespannt auf mich, denn links oder rechts, das ist meine Entscheidung bis zur letzten Sekunde, das ist meine Bühne hier, und wenn ich fahr dann fahr ich und vorher nicht.
Ego-Schweine, allesamt. Blinkt, Leute, blinkt! Und für die Radis: Arm raus hält besser.
August 2020 – Partikelchen
Der Wind weht mir ein Partikelchen Stadt ins Auge, das den ganzen Tag nicht rausgeht.
August 2020 – Serienkiller
Ich finde eine Notiz von mir, irgendwohin gekritzelt, unter eine Einkaufsliste:
Bedürfnisse abtöten.
Menschen egal machen.
August 2020 – T48
Beim Therapeuten gewesen,
über die Frustration darüber gesprochen, dass er da drüben immer auf der „sicheren Seite“ ist, und das wiederkehrende Gefühl, angesichts von Missstimmungen, Konflikten, Zurückweisungen in Beziehungen, mal wieder „in die Falle getappt“ zu sein.
August 2020 – Sommer in Kreuzberg
Auf der Flucht vor der Baustelle zwei Monate Sommer in Kreuzberg. Nachts die Fenster offen, der Lärm von unten mediterran. Die Hitze stimmt bis spät in die Nacht. Ich laufe nackt durch die Wohnung, wische den Boden nass. Der Schlaf ist dünn, das Laken reicht dicke. Die Träume wären leicht, wenn sie nicht meine wären.
P. schreibt aus Italien. Kurz vor Modena im Stau um Mitternacht bei 34 Grad.
Modena…
Woanders wär auch schön. Aber hier ist jetzt.
August 2020 – lesen
Ich freue mich so sehr darüber, dass ich gerade lesen kann.
Ich lese: Allegro Pastell von Leif Randt, Das Adressbuch von Sophie Calle und Erinnerung eines Mädchens von Annie Ernaux, deren Die Jahre ich (logischerweise) großartig fand.
Allegro Pastell tuts mir nur langsam, aber dann doch an. Wegen Allegro Pastell fange ich noch Gespräche mit Freunden von Sally Rooney, weil es mir in Bezug auf Generation, Milieu, Stil ähnlich zu sein scheint, aber von einer Frau geschrieben ist.
In beiden Büchern tritt einem eine extrem entspannte und dennoch hoch reflektierte, emotional reif wirkende Generation entgegen, die klug und begabt ist, kein schlechtes Verhältnis zu ihren Eltern hat, einen guten Zugang zu ihren Gefühlen, ihrer Sexualität und ihren Drogenerfahrungen, und die Verhältnisse selbstverständlich kritikwürdig findet. Männer und Frauen tun sich nicht mehr viel.
Mit G. diskutiere ich über die verpasste Liebesgeschichte in Allegro Pastell, die mich irre macht, weil sie mir der ewigen Bezugnahme auf die eigene emotionale Lage geschuldet ist, und diese Ego-people nicht kapieren, dass da grade was Größeres als sie selbst passiert, dem man sich dedicatend muss. In ihrer Feinheit der Wahrnehmung und SChilderung kleiner, aber bedeutungsgebender Bewegungen in Situationen und Kommunikationen sind sich beide Bücher ähnlich. Trotzdem ist mir Fleabag, gleiche Generation wie Randt und Rooney, näher, hart, zynisch und menschenverachtend.
Folgendes behalte ich aus persönlichen Gründen:
„In der Kindheit folgte das Leben einem scheinbar mystischen Plan, der vor allem auf den Entscheidungen der Erziehungsberechtigten beruhte, und später basierte das eigene Handeln auf den Fehlentscheidungen jener Erziehungsberechtigten. Zudem konnte man nur im Rahmen seiner kognitiven, emotionalen und finanziellen Möglichkeiten agieren.“
Aus: Allegro Pastell von Leif Randt
„Er wusste jetzt, dass er mit Marlene in Zukunft okayen bis sehr guten Sex haben könnte. Dass sie älter war als Tanja, ließ sich höchstens an ihrem Hals erahnen und vielleicht auch, wenn sie lächelte.“
Aus: Allegro Pastell von Leif Randt
„Es war kein Scherz gewesen, als ich zu Philip gesagt hatte, ich würde keinen Job wollen. Ich wollte keinen. Ich hatte keinerlei Pläne, was meine finanzielle Zukunft anging: Ich hatte nie Geld mit irgendwas verdienen wollen. (..) Manchmal kam es mir so vor, als würde ich es nicht schaffen, mich für mein eigenes Leben zu interessieren, und das deprimierte mich. Andererseits fand ich, dass mein Desinteresse an Reichtum ideologisch gesund war. Ich hatte nachgesehen, wie hoch das durchschnittliche Jahreseinkommen wäre, wenn das Weltbruttosozialprodukt gerecht auf alle verteilt wäre, und laut Wikipedia läge es bei $ 16 100. Ich sah keinen Grund, weder politisch noch finanziell, warum ich mehr als diese Summe verdienen sollte.“
Aus: Gespräche mit Freunden von Sally Rooney
August 2020 – T47
Beim Therapeuten gewesen,
über die verpasste Stunde gesprochen, die sms, über die er nicht zu erreichen war, und darüber, was das entgegen aller Logik für eine Bandbreite an Gefühlen auslöst.
August 2020 – Kryonik
Einfach mal Stopp sagen,
sich einfach mal einfrieren lassen
In die Kühle hinabsinken, den Atem flach halten, das Glas beschlagen
Und dann
Irgendwann
Nachdem alles anders wurde
Auftauen und
Sich neu
Orientieren.
Ich kann das schon verstehen.
Juli 2020 – De De Depression
Manchmal verliere ich ganze Tage an die Depression.
Samstag, sowieso Droh-Tag, alles gut geplant, irgendwas zwischen Post-it: To Do und spontan Have Fun. Ich starte im Cafe, gehe weiter zum Markt. Dann zurück nach Hause. Wäsche, Steuer, abends N. treffen auf einen Drink.
Schon auf dem Markt merke ich, es wird schwierig werden heute. Was hab ich auch Allegro Pastell gelesen, Liebesgeschichte in denen ein zeitgenössisches Paar eines dem meinen ähnlichen Milieus selbstverständlich mit anderen Sex hat, weil das eben nun mal so ist, obwohl sie sich im Grunde lieben, sind nicht zuträglich. Beinahe fahre ich nicht ins geplante Online-Ticket-Prinzenbad, der Kampf endet damit, dass ich doch hinfahre.
Vor Ort alles schwierig, ich beginne im Schwimmer, kann aber kaum atmen, die Superhechte pflügen selbstgerecht, den Dümplern ist schlecht auszuweichen, die Bahnen sind zu voll, ich muss immer weiter weg vom Rand, kriege einfach die Angst nicht weg. Ich steige nach kurzer Zeit aus dem Becken, wechsle ins Nichtschwimmer, wegen Nachmittag leider quer abgetrennt statt längs, versuche es hier nochmal, in meiner heimischen Pfütze mit stets erreichbarem Boden, Bälle fliegen, Kinder kapieren nichts, ich kriege einfach keine Ruhe rein.
Neben mir im Wasser ein Mann und seine kleine Tochter, ca. drei. Er trägt sie eng bei sich auf dem Arm, übt mit ihr: Nase zu, unten ausatmen, die Augen kannst du unter Wasser auflassen. Er springt hoch, gemeinsam tauchen sie unter, lachen laut als sie wieder hochkommen. Ich hab dich gesehen!, ruft das Mädchen. Papa, ich hab dich gesehen!
Das wars. Ich weine. Ich gehe raus. Ich zittere am ganzen Körper, ich kann mich kaum beruhigen. 100 Punkte für die Depression, High Score, du hast gewonnen.
Der Gedanke, alles sei von Anfang an schief gelaufen und trotz aller Anstrengung nicht mehr gerade zu biegen, ist zu stark.
Juli 2020 – Schonprogramm
Schonprogramm, das:
Verordnung, die dazu dient,
vom anderen geschont zu werden,
vom anderen verschont zu bleiben (Gefühle, Anblick).
Juli 2020 – Men-Sprech
_Ein ca. 14jähriger entdeckt auf der anderen Straßenseite seinen älteren Cousin. Gehste Puff? ruft er grüßend rüber.
_Ein Mann tritt an an den Tisch, an dem ein Freund und ich gerade angefangen haben zu essen. Er setzt an: Er sei gerade ein bisschen knapp, ob – der Freund unterbricht ihn, macht klar, dass er sich gestört fühlt, der Typ knickt ein, entschuldigt sich verständig, sagt Nee is klar, wer reinfickt wird abgefickt, ich hab reingefickt, ich werd abgefickt, is okay, ich wünsche schönen Abend, genießen Sie Ihre Frau.
Juli 2020 – Was der Sommer mit sich bringt
Rot lackierte Zehennägel vom Profi. Love that. Nach einer Weile wird’s noch besser, der Lack blättert, findet seine eigene Form: Einer sieht aus wie Hitlers Seitenscheitel, ein anderer wie Chaplins Diktator-Schnurrbart, der dritte macht einen auf Rothko und der vierte entscheidet sich für das allgemein unterschätzte Genre der Reißcollage. Das ist Nail Art, die kriegst du in keinem Studio, das machen Lack und Zeit von ganz alleine.
Juli 2020 – in den nächsten Tagen
B. will jetzt endlich mal lernen, wie ein Smartphone funktioniert. Damit er endlich die ganzen Fotos, die mit diesen Dingern zu Tausenden von seinen Enkelkindern gemacht werden, instantan geschickt bekommen und sie wie die anderen Männer auf dem Marktplatz herumzeigen kann. Er kauft sich ein iphone. Er macht zum ersten Mal in seinem Leben ein Selfie. Von sich und M. Cool, sage ich, schick mal. Er geht zu dm, druckt es aus, steckt es in einen Briefumschlag, klebt eine Briefmarke drauf und bringt es zur Post. Dann ruft er mich an, um mir zu sagen, dass was mit der Post kommt. In den nächsten Tagen.
Juli 2020 – mit Analyse
Zu: Ohne Analyse
Nr. 1: Ich staune selbst, aber ich laufe beschwingt die Rolltreppen hinunter, weg von dort, über den Platz und weiter ins Büro. Es ist doch so. Ich hab mich krass was getraut.
Nr. 2: Ich hab zum ersten Mal nicht nur im Kopf gedacht, sondern glasklar erlebt, wie‘s laufen wird, in nächster Zeit. Das war der Auftakt zu einer langen Reihe von Körben, die ich kassieren werde wie unkriegbare Bälle beim Squash, die einem die Zähne ausschlagen.
Nr. 3: Niemand, der gleichaltrig oder jünger ist, begehrt ernsthaft eine Frau in meinem Alter. Das hat nicht einfach was mit Sexismus zu tun, das ist der Lauf der darwinschen Welthormone, die brutalste Angelegenheit von allen, ich nenne das Bio-Sexismus. Jungs kriegen einfach keinen oder nur mit Überbrückungsmethoden mehr hoch, wenn Frauen die 36 überschritten haben und das ist schon richtig hoch gegriffen. Außer die Frauen sind Heidi Klum oder Demi Moore oder sowas. Ich war noch nie hübsch, jetzt bin ich auch noch alt, und das Scham-Level wird jeden Tag höher und belastender. Es wird viele Anläufe und Überredungskünste brauchen, jemanden, den ich mag, davon zu überzeugen, dass man mich mögen kann.
Nr. 4a: Ich weiß, ich sollte etwas anderes sagen. Ich sollte etwas anderes denken. Schon aus feministischen Gründen. Ich sollte denken, Frauen im mittleren Lebensalter sind toll und sexy und überhaupt nicht alt und können jederzeit einen Mann abkriegen, der sie nicht nur respektiert und wertschätzt, sondern auch vögeln will. Tu ich aber nicht.
Nr. 4b: Anscheinend finde ich mich trotz aller von mir selbst überlaut wahrgenommenen Neurosen und Hässlichkeiten im Großen und Ganzen nett und interessant. Wie sonst ist es zu erklären, dass ich so oft erstaunt oder irritiert davon bin, dass es vielen Leuten anders geht. Ich muss mal meine Selbst- und Fremdwahrnehmung auf einen gemeinsamen Nenner bringen.
Nr. 5: Die Welt des Kennenlernens findet nicht analog statt. Wer‘s analog probiert, kommt rüber wie jemand, der eine Motz verkaufen will oder einfach den Schuss nicht gehört hat. Wenn du jemanden abchecken willst, dann geh gefälligst dahin, wo es sich gehört: Ins Internet! Außer im Club, das ist ne Ausnahme, da ist es dann aber auch gleich voll Sex konnotiert, mit Kaffee trinken und irgendwann mal vorsichtig Händchen halten, hält sich da keiner auf.
Nr. 6: Als ich ihm da so frontal ins Gesicht schaue und er krass das Gesicht verzieht und sagt, was er sagt, denke ich: Was für ein Depp. Als mir das vor Monaten mal anders herum passiert ist und mich jemand angesprochen hat (ich hab‘s hier irgendwo notiert), war ich nett zu dem und habe versucht zu signalisieren, dass ich weiß, wie viel Überwindung das kostet und dass ich mich geschmeichelt fühle, auch wenn ich kein Interesse habe.
Nr. 7: Ich finde, es ist nicht leicht, heute ein netter Mann zu sein. Wie soll mans anstellen, mit dem Ansprechen, wenn man unter allen Umständen vermeiden will, den Eindruck eines weiteren predators zu machen, der jede Sekunde sein dick pic rausziehen, sie heimlich auf dem Klo ausspionieren oder ihr mal schnell unter den Rock fotografieren könnte. Deswegen finde ich es sehr nett und genderpolitisch korrekt von mir, dass ich diese Bürde des Ansprechens übernommen habe, und wenn er einigermaßen klug wäre, hätte er das kapieren und mir einen netten Korb geben müssen.
Nr. 8: Ich dachte, er hat mich angeguckt. Ich dachte, er mag mich. War aber alles ganz anders. Einmal mehr bleibt vor allem eins: Irritation darüber, dass ich nicht weiß, wie die Welt funktioniert. Dass ich Menschen und Situationen falsch einschätze.
Nr 9: Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Ich hab vergessen, wofür ich das machen soll. Ich kenne das Bedürfnis, jemanden bei mir und um mich haben zu wollen, jemanden, der ein Ort ist, ein Bezugspunkt, das kenne ich sehr. Aber den Weg dahin, das Spiel, das nötig ist, das macht mir keinen Spaß. Warum also soll ich es spielen. Es fühlt sich nicht an wie ein Spiel, es ist beschissener Ernst, es ist Arbeit, es ist noch was auf der Liste, noch ein Marathon, den man beharrlich und geduldig und mit viel Überwindung gegen Ängste und mit viel Kampfeswillen und Bereitschaft zum Einstecken laufen muss. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis des Spiels ist, dass jemand bleibt, tendiert gegen Null. Aber als ich mir ausgedacht habe, dass der Typ mich mag und ich ihn, und ich ganz aufgeregt wurde, da hab ich T. vergessen. So sehr wie lange nicht.
Juli 2020 – ohne Analyse
Ich sitze in einem Café-Restaurant, das ich wegen seines Trash-Faktors und seines Standorts hoch über der Stadt, gerne mag. Draußen regnet es. Ich tippe ziemlich vertieft irgendwelche Mails und als ich kurz aufsehe, schaut mir ein Typ, der sich an den Nebentisch gesetzt hat, direkt in die Augen. Ich kriege einen Riesenschreck und gucke schnell weg: Shit. Er gefällt mir.
Er wendet sich wieder seinem Kaffee, seinem Handy und seiner Zeitung zu, ich tippe harmlos vor mich hin, schreibe lubdibubarbrueid dihäät und mustere ihn heimlich. Ich bin total aufgeregt, alles pumpt. Kann aber auch sein, dass das vom Filterkaffee kommt, der durch meine Adern fließt.
Er sitzt so in meiner Blickachse, dass ich ihn von der Seite sehen kann. Ich überprüfe in den nächsten 3, 5, 10 Minuten immer wieder, ob er mir wirklich gefällt oder ob es ein Irrtum war. Er dürfte ungefähr mein Alter sein, bisschen jünger vielleicht, der blaue Pulli steht ihm gut, ich mag seine Haare, ich guck mir seine Schuhe an, die Jeans, die er trägt, er macht was, was ich auch gerne mache, hier, in diesem Café sitzen, Kaffee trinken, Zeitung lesen und warten, bis der Regen vorbei ist.
Ich kritzele meine für solche Zwecke von langer Hand vorbereitete und noch nie eingesetzte Mailadresse auf eine Serviette und spiele durch, was ich sagen könnte. Im Kopfkino erzähle ich mir die Geschichte schon mal aus der goldenen Hochzeits-Retrospektive: Und dann hab ich ihm meine Mailadresse auf die Serviette gekritzelt und ihn angequatscht und dann hat er mir geschrieben und wir haben uns für unseren ersten gemeinsamen Kaffee verabredet, natürlich da, wo alles begann, ist ja klar. Könnte funktionieren, das Storytelling ist ja immer wichtig.
Die von langer Hand vorbereitete Serviette finde ich plötzlich blöd. Er rührt sich irgendwie, packt die Zeitung weg, nicht, dass er mir jetzt einfach abhaut. Nein, er scrollt auf dem Handy herum. Der Regen regnet immer noch. Der wäre vielleicht noch ein Aufhänger. Oder die Zeitung, tschuldige, brauchst du die noch. Ich zerknülle die Serviette und werfe sie in meine Tasche, stecke stattdessen einen Stift griffbereit in die Jackentasche, falls ich meine Adresse aufschreiben darf, und die Kaffeequittung, falls er nichts zum Draufschreiben hat. Mit der kann er sich noch einen Refill holen, vielleicht könnte ich daraus einen Witz machen, haha, besser nicht, keine Witze. Ich stehe auf, räume laaangsam meine Sachen zusammen, kontradiktisch zum Pochen.
Plötzlich stehe ich vor seinem Tisch und sage: Hi, ähm, entschuldige, dass ich dich so anspreche, aber ich dachte, ich frag dich einfach mal, ob du vielleicht Lust hast, irgendwann mal einen Kaffee mit mir zu trinken.
Alles rauscht. Er guckt mich an, braucht einen kurzen Moment um die Gesamtsituation zu prozessieren. Dann verzieht er in einer Mischung aus Befremden und Abscheu das Gesicht und sagt:
Ich glaube nicht.
Juli 2020 – Teenage Happiness
In der Tram zwei vielleicht 11jährige Mädchen. Sie sitzen dicht nebeneinander, plappern aufgeregt, durchdrungen von ihrem Abenteuer, allein unterwegs zu sein und sich einen schönen Tag machen zu dürfen. Sie listen auf, was noch alles passieren soll heute. „Und dann“, sagt die eine, am krönenden Ende der Aufzählung angelangt, „gehen wir zu mir und machen dir einen Tik tok Account!“
Juli 2020 – Österreich
Die Kärntner Landschaft irgendwas zwischen Adria und verknöchertem Schwarzwald.
Das Haus funktioniert gut, es bietet Orte und Plätze zwischen denen ich wechseln kann, von hier nach dort und drüben und schon ist alles anders und das Schreiben schreibt sich. Auch weil ich barfuß bin, im hohen, hohen Gras, die Nägel rot lackiert zwischen den Schmetterlingen.
Warum ist nicht immer Sommer.
Juli 2020 – immer dabei
In der U9 sehe ich eine Frau, die ihren polnischen Reisepass rechts auf dem Ohr trägt. Sie hat sich dreimal Tesa um den Kopf gewickelt, damit er hält.
Man kann viel lernen, von den Verrückten.
Juli 2020 – T46
Beim Therapeuten gewesen,
den Therapeuten nicht vorgefunden.
Juni 2020 – negativ
Du bist immer so negativ.
Was soll ich denn sonst sein. Positiv?
Ich bin nicht bereit, mich diesem Sicherheitsrisiko auszusetzen.
Juni 2020 – Kurt und ich
Ich treffe S. auf einer Party. Er macht mir Komplimente für meine hell gefärbten Haare. Grade kürzlich hätte er auf Youtube mal wieder einen Dokfilm über Nirvana gesehen, der hätte die Haare ja auch gerne so getragen. Toll, ich sehe also aus wie Kurt Cobain. Wenn er wenigstens Courtney Love gemeint hätte.
Zuhause gucke ich im Internet. S . hat recht, frisurentechnisch gibt es Ähnlichkeiten zwischen Kurt und mir. Und ich finde, er sieht viel besser aus als Courtney Love. Also gut, ich füge mich in mein Schicksal. Ich hab Haare wie Kurt Cobain.
Juni 2020 – Das organisierte Pack
Auf dem Ubahn-Gleis lese ich auf meinem Handy herum. Eine Frau nimmt mich in den Blick. Sie sieht gepflegt aus, die Haare hochgesteckt, langes Kleid. Sie nähert sich mir, leicht von hinten, spricht hinter ihrer Sonnenbrille hervor. Ihr organisiertes Pack!, sagt sie. Ihr könnt froh sein, dass ich nicht geistesgestört bin. Denn wenn, ja wenn, dann, – sie lacht verächtlich, ja, was wäre dann … . Ich bringe ein paar Meter zwischen sie und mich, auch weil sie ein bisschen müffelt. Sie folgt mir. Jetzt bin ich mir sicher, dass ich gemeint bin. Irgendwann reicht es einem mal, sagt sie, mit dem organisierten Pack. Diesmal klingt das Wort Pack wie gespuckt. Ich mache noch mehr Meter, die Bahn kommt und ich sorge dafür, dass ich nicht in denselben Wagen einsteige wie sie.
Im Grunde hat sie ja Recht. Ich gehöre zum organisierten Pack. Aufstehen, zur Arbeit gehen, sich auf dem Handy über die Weltlage informieren, den Wochenendausflug organisieren, ein Geburtstagsgeschenk besorgen, in einer Wohnung wohnen, das Bett machen, einen Arzttermin wahrnehmen, ein Kinoticket kaufen, zum Sport gehen, Geld abheben. Ich kann es auch nicht wirklich leiden, das organisierte Pack zu dem ich gehöre, mir reicht‘s vielleicht auch bald mal mit dem. Irgendwie scheint es doch Schuld zu sein, das organisierte Pack, an der Weltlage, über die es sich auf seinem Handy so gerne informiert und sich seine organisierte Meinung bildet. Und weil es so organisiert ist, hält es ja tatsächlich alles am Laufen, das Pack. Es weiß, wie es bekommt, was es will, wie es sich vernetzen muss, was es sagen muss, was es anziehen, essen, trinken, was es wissen muss. Dass man sich immer einbildet, dass es das einzig Wahre, Richtige und Gesündeste ist, zum organisierten Pack zu gehören.
Juni 2020 – T45
Beim Therapeuten gewesen,
über die Beendigung einer Freundschaft gesprochen, die ambivalenten Gefühle, die das auslöst, und was das mit mir und T. zu tun hat.
Juni 2020 – Freiheit
Ich staune über den Begriff der Freiheit, der gerade überall auftaucht. Die erhobene Faust in der Hand wird er skandiert, bei der sogenannten Hygiene-Demo. J. erzählt von einer Frau, die weint, weil sie sich nicht hat vorstellen können, dass sie nochmal in ihrem Leben an einer solchen Demonstration würde teilnehmen müssen, wie damals in der DDR 1989. Die Impfgegner argumentieren mit Freiheit, die Staatsrechtler sprechen über Freiheit, Juli Zeh merkt an, dass sie den Eindruck hat, Sicherheit ist heute wichtiger als Freiheit.
Ich frage C., was sie über Freiheit denkt. Das is doch das Wichtigste von allem, sagt sie. Ach ja? Ich weiß nicht, was Freiheit sein soll, vielleicht weil ich so ein verklemmter Typ bin. Ich vermute hinter dem hierzulande gerade grassierenden Freiheitsbegriff vor allem eins: Ein big Ego-Play.
An Freiheit ist doch problematisch, dass sie schnell auf Kosten anderer geht. Dass sie nicht: Rücksichtnahme, Gemeinschaft, Solidarität ist. Nicht mal Respekt. Ich nehme mir die Freiheit, heißt, man nimmt sie aus dem was vorhanden ist, man nimmt sich sozusagen was raus, oder: man nimmt sie jemand anderem weg. Und frei ist man doch nur, wenn man in der Lage ist, über sich selbst zu entscheiden, und dazu braucht man so vieles, das man nicht einfach qua seines Menschseins hat, nämlich Kapital aller Art, ein Haufen Glück und andere unberechenbare, also nicht selbst bestimmbare Faktoren. Im Sozialen ist man nie wirklich frei. Und verlässt man das Soziale und zieht in den Wald, ist da immer noch die Natur. Aber so kann nur jemand über Freiheit sprechen, der nicht in einem korrupten, diktatorischen Staat lebt. Einem Staat, der keine Lust hat, und nicht das Verantwortungsgefühl aufbringt, seine Bevölkerung mit freiheitseinschränkenden Maßnahmen zu schützen.
Ich nehme mir vor, mal bei den Philosophen nach Freiheit zu suchen, aber wer hat denn die Zeit für sowas.
Juni 2020 – T44
Beim Therapeuten gewesen,
über den potentiellen neuen Job gesprochen, und die Frage, ob es wirklich richtig ist, ihn zu machen, angesichts seines Potentials zur Destabilisierung, wo doch gerade die Jobseite in letzter Zeit zum ersten Mal Stabilisierung bedeutet hat.
Juni 2020 – Corona 37 – Maskenball
Die Maske, die Maske, das Fashion-Accessoire der Stunde, in Nullkommanichts bilden sich neue habits heraus, love that, ich sehe:
Die Maske an den Gummizügen gehalten wie ein Handtäschchen,
übers Handgelenk gestreift wie ein Armreif,
über den Ellbogen geschürzt wie ein Ellbogenschoner,
über den Oberarm gezogen wie ein Tattoo,
auf den Hals runtergezogen wie ein Schal,
mit einem Band am Ohr baumelnd, unique!
Nur hoch auf die Stirn, das ist irgendwie nicht angesagt.
Juni 2020 – show to tell
Eine Freundin empfängt mich. Dass ich eingeladen wurde geschah aus Versehen. Weil ich mich gemeldet habe. Sie sagt mir – nachdem sie Drogen genommen hat – wie gern sie mich hat und dass es ihr furchtbar leid tut, dass sie sich nicht gemeldet hat. Ich winke ab, Corona usw., da waren ja einfach alle sehr zurück gezogen. (Sie hatte mir auf Anfrage mal geschrieben, dass sie gar niemanden mehr sieht, außer ihrer Familie). Sie: Naja, ich hab ja schon einzelne Leute noch gesehen.
Ich hasse es. Diese unter Droge hochgeschwemmten Liebesgeständnisse, diese hyperemotionalen Entschuldigungsschwünge, die am Ende nichts anderes produzieren und produzieren sollen als Beschwichtigungen der liebeserklärten und heimlich frustrierten Seite, neinnein, nicht schlimm, keine Schuld, dabei gehts unterm Strich doch eigentlich im Leben und in Beziehungen vor allem um eins: showing not telling.
Juni 2020 – Fundbüro
Post vom Fundbüro: Eine Geldbörse wurde gefunden und es gibt Grund zur Annahme, dass es ihre ist. Hell yeah ist das meine, vor über 6 Monaten geklaut worden ist mir meine „Geldbörse“, 70 Euro hab ich gelatzt, um Führerschein und Pass nachzumachen, ewig hats gedauert, bis alles fertig war, Fahrkarte!, 10er Karte fürs Schwimmmbad!, Krankenkassenkarte, Coffee-shop Rabattkärtchen, der ganze schöne Shit: weg! Geld war nicht viel drin, nur so 12 Euro. Niemals nicht wäre ich auf die Idee gekommen, beim Fundbüro nachzufragen. Voll 1950. Dass das nicht eingestellt wurde, zusammen mit dem Telegramm-Service Ich also: Anruf beim Fundbüro. Nie geht jemand dran. Ich also: Hingehe zum Fundbüro. Die Schlange ist so lang, dass der Typ am Eingang sagt: Da warten sie zwei Stunden. Ich also: Wieder nach Hause. Dann also: Hingehe nochmal zum Fundbüro an einem anderen Tag, die haben nur zweimal die Woche auf, jeweils drei Stunden. Ich diesmal schlau: eine halbe Stunde vor Öffnungszeit bin ich da und ich bin nicht die erste in der Schlange, schon drei Leute vor mir. Eine ältere Frau, dies am Knie hat, mischt die Schlange auf. Sie quatscht launig Vordermänner und Hinterfrau an, aus Brandenburg ist sie angereist, mit ihrem Knie. Am Hauptbahnhof wurde sie überfallen – jemand hat den Reißverschluss an ihrem Rucksack aufgezogen und den Geldbbeutel rausgeholt, was man halt so Überfall nennt.
Endlich geht die Tür auf. In der Schlange inzwischen 20 Leute. Wir werden eingeteilt: Die Geldbörsen und die Handys sind Schalter 1. Die Fahrräder sind hinterm Gebäude und Leute, die einfach fragen wollen, ob ihre geklauten/verlorenen Sachen abgegeben wurden sind Schalter 2. Die Frau bekommt keinen Stuhl, trotz des Knies, denn, so der Türsteher (Körperauftritt in Polizeimanier): Das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Wir sind im Flughafen Tempelhof. Dort ist die Polizeit, ich kapiere: Das Fundbüro gehört zur Polizei! Macht Sinn. Ich lerne: Wenn man was findet, und keiner holt‘s ab, dann kriegt mans nach einigen Jahren. So wie der Typ vor der älteren Frau. Als er rauskommt – alles geht hier im üblichen behördlichen Berliner Schnarchtempo, zieht er eine Rolex aus einem Etui. Vor zwei Jahren hat er sie gefunden, jetzt hat er sie abgeholt: Wert: 18.000 Euro! Er sieht aus, als hätte er es verdient und als wäre das der beste Tag seines Lebens.
Als ich dran komme, sehe ich, im Flur vor den Schaltern hätten sie Stühle gehabt für die Frau mit dem Knie. Man kanns auch übertreiben mit den Corona-Abständen. Ich warte vor Schalter 1. Keiner kommt. Irgendwann linst einer von hinten um die Ecke. Wieso ich nicht klingle? Ich so: äh, wie bitte?, kann einem das mal jemand sagen?! (Hinter mir in der Schlange sichtbar 20 Leute!) Ich dachte, der arme Typ ist da alleine, aber mein Eindruck ist: Die sind eigentlich ganz gut besetzt. Faule Behördenbande. Ich halte dem Typ hinter Glas meinen Zettel hin. Sie sind die Verliererin? fragt er mich. Was soll man da sagen: Ja, klar, ich bin die Verliererin, Verliererin ist mein zweiter Vorname.
Beim Lidl ist die Geldbörse gefunden worden, wo ich nie war. Das Geld ist sauber ausgeräumt, nicht ein Centchen mehr drin, alle Ausweise und Karten sind da. Fine with me, da hat sich jemand für 12 Euro schön bei Lidl was zu essen gekauft und die Geldbörse einfach fallen lassen. Und beis Lidls haben sie wahrscheinlich irgendwann endlich mal die Findekiste voller verlorener Handys und Geldbeutel und Schirme und Fahrräder zum Fundbüro gebracht. Ich freue mich, meine Bäderkarte wieder zu sehen, da sind nämlich noch ordentlich Schwimmbesuche drauf und vor allem über den Geldbeutel selbst. Den mochte ich nämlich gerne. I love Fundbüro! Bitte nicht einstellen.
Juni 2020 – Eis
Ich beobachte ein Kind. Einen Jungen, vielleicht drei, eher zart. Dunkle Locken, dunkle Augen kommt er aus einer Eisdiele, trägt einen kleinen Eisbecher in beiden Händen, die weißen Kugeln mit Zuckerperlen bestreut: Highscore! Er steht allein vor der Eisdiele, schaut das Eis an, wo sind seine folks, frage ich mich, er steht da und es ist klar, er muss warten, auf die anderen, die kommen gleich oder sind sie schon vor?, innerlich ist er gebunden an jemanden, aber da sind er und das Eis und irgendwie ist das Eis groß und er und das Eis sind die einzige Wahre und gerade wirklich wichtige Verbindung, und wenn die so lang brauchen, kann er ja jetzt eigentlich auch schon mal loslegen, denn es droht ja, dass das Eis schmilzt. Die kleine blaue Plastikschaufel also eingetaucht und das Eis in den Mund geschoben, er verzieht das Gesicht, seine Lippen, seine Stirn, alles ist am Arbeiten in seinem kleinen Körper, aufgrund der SENSATION: Kälte, Süße, Geschmack,
Glück.
Seltsam wie man Momente anderer Menschen lieben kann.
Juni 2020 – Corona 36 – Was wir aus Corona lernen können:
In der Krise zeigt sich das Arschloch.
Juni 2020 – satt und zufrieden
Niemand kommt zu mir.
Niemand sucht meine Nähe.
Nur andersherum wird ein Schuh daraus.
Sind die anderen denn alle satt und zufrieden?
Juni 2020 – T43
Beim Therapeuten gewesen,
über den Rückfall gesprochen, den Wahnsinn, der damit einhergeht und den in solchen Situationen kaum mehr beherrschbaren Gedanken, es möge einfach alles vorbei sein.
Juni 2020 – T42
Beim Therapeuten gewesen,
über die Option auf den Job im Haifisch-Becken gesprochen und welche innere und äußere Aufstellung dafür Sinn macht.
Juni 2020 – kompass
Morgens an der U8-Haltestelle ein kompass-Verkäufer, den ich vom Sehen kenne. Er weint, er weint laut und verzweifelt. Ich halte es kaum aus, ich hab heute morgen auch schon geweint, muss das denn alles sein, ich kämpfe mit mir, warum?, am Ende, in der U-Bahn spreche ich ihn an. (Ich: Maske auf, er: keine). Gehts dir nicht gut heute, was ist denn los? Er sagt, die haben ihn verprügelt und ihm alles geklaut, was er hatte. Was denn, frage ich, deine Sachen?, er guckt verständnislos, alles, was er gesammelt hatte, sagt er, und bisschen Hartz IV hat er auch noch gehabt, alles weg jetzt. Ich krame in meiner Tasche nach meinem Geldbeutel, soll ich ihm ein Tempo anbieten, damit er seine Tränen trocknen, ein Päckchen Desinfektionstücher, damit er sich auch mal die Hände desinfizieren kann, ist das alles falsch, richtig, Und die bei kompass, unterstützen die dich nicht? – Ach, macht er und eine wegwerfende Handbewegung dazu, die haben selber kein Geld. Das war gar nicht unbedingt das, was ich meinte, was dann? Was meinst du, Elli? Ich finde meinen Geldbeutel, gebe ihm vier Euro in seinen Pappbecher, kauf dir erstmal einen Kaffee. Danke, schlurft er davon.
Herrgott.
Mai 2020 – Corona 35 – Maulkorb
Die Maske ist jetzt ein Maulkorb.
Hygiene-Demos auf dem Rosa-Luxemburg-Platz. Jeden Samstag werden es mehr Leute, bundesweit. Impfgegner, Bill-Gates-Hasser, Fake-News-Trompeter, Wir sind das Volk-Rufer. Attila Hildmann will sich bewaffnen, Xavier Naidoo ist sich sicher, die Erde ist flach. Wer vom Platz verwiesen wird, weil er den Mindestabstand nicht einhält, hat seine Bestätigung. Der aufrechte Bürger trägt keine Maske, sondern Schaum vor dem Mund. Und den lässt er sich nicht verbieten.
Was links ist und was rechts, weiß keiner mehr, jetzt auch nicht mehr, wo oben und unten ist.
Ich bin irritiert über mich selbst. Warum empfinde ich die staatlichen Maßnahmen nicht als Übergriff, als massive, unerlaubte Einschränkung meiner Freiheit. Warum bin ich nicht empört, dass die Politik sich in mein Leben einmischt, beschließt, dass ich keine Menschen mehr sehen darf, mich nicht lümmelnd in Parks aufhalten, dass ich keine Landesgrenzen mehr übertreten darf, von zuhause arbeiten soll, dass sie dafür sorgt, dass ich nicht mehr in Cafes, in Shops, zum Sport gehe, dass sie es mir erschwert, mich zum Demonstrieren zu versammeln, mir das Feiern im Club verbietet, den Gang ins Theater, ins Kino, in die Ausstellung, dass sie mich anweist, ein bestimmtes Kleidungsstück zu tragen und einen Mindestabstand zu meinen Mitmenschen einzunehmen. Der Staat verhandelt, strukturiert, prägt, kontrolliert gerade meine Arbeit, mein Körper, mein Sozialleben, meine Bewegungsfreiheit, meine Zugriffe auf die Welt. (das macht der immer, was anderes muss man sich nicht einbilden, aber jetzt gerade besonders und anders). Die Antwort ist ganz einfach: Weil ich es sinnvoll finde. Und von dem Staat in dem ich lebe, bzw. der Politik schlicht erwarte, dass sie diese Maßnahmen trifft, um eine Pandemie in den Griff zu bekommen. Dass ich es sinnvoll finde, hat etwas mit Aufklärung, mit Transparenz in den Prozessen zu tun, die in der Politik vor sich gehen, damit, dass man mir mitteilt, auf welchen Erkenntnissen, Erfahrungen, auf welchem Wissensstand die Maßnahmen entwickelt werden, welche Institutionen einbezogen werden, welche Fragen an wen gestellt werden. Von Anfang an gab es viele Debatten. Als es um die Tracing-App ging, kamen die Datenschutz-Leute. Als nur noch Herr Drosten zu hören war, wollten alle die Leopoldina-Studie hören. Leute wie Prantl oder Zeh haben die Einschränkungen aus rechtlicher Sicht problematisiert. Niemand hat von einem Tag auf den anderen einen radikalen Lockdown beschlossen, der zu Chaos geführt hätte. Wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich keine Militärs mit MP im Anschlag patrouillieren, ich erlebe keine Polizei, die sich aufspielt, Schikane betreibt. Ich habe nicht den Eindruck, dass hier unter der Hand Notstandsgesetze erlassen wurden, mit denen eine Diktatur installiert oder ihre Basis weiter ausgebaut werden soll wie das allerdings in Ungarn und Polen, also mitten in Europa der Fall war. Von Anfang an war die Zivilgesellschaft da, mit Solidarität, mit Ideen, mit Kritik und Versuchen, auf Corona als Problemverstärker aufmerksam zu machen bei Wohnungslosigkeit, Verkehr, Risikogruppen, Psyche. Tut mir leid, aber ich finde: Im Großen und Ganzen ist das hier auch was die Dauer angeht nachvollziehbar und gut gelaufen. Doch jetzt, in der Phase der Öffnung, in der alles auseinander zu fliegen, nicht mehr anbindungsfähig scheint, in der die Felder komplex sind, weil es plötzlich auch um Entscheidungen geht, die zukünftig sind, so dass es schwer ist, den Überblick zu bewahren, und maßvoll zu agieren, jetzt bauen sich die Mauern auf, gegen die man wird anrennen müssen. Denn jetzt ist die Phase der Reviermarkierung, der Ressourcenverteilung gekommen, jetzt geht es darum, sich zu platzieren, sein Stück vom Kuchen abzukriegen, darum, ob man besser oder schlechter aus der Krise hervor geht, jetzt ist die Zeit des Lobbyismus. Jetzt ist die Frage des Zurück eine nach dem Zurück in was? Hier wirds politisch, hier wird’s interessant, hier kann und muss man sich zur Wehr setzen, denn der Backlash droht an allen Ecken und Enden. Von wegen was wir alles gelernt haben, was für positive Erfahrungen wir gemacht haben, dahinter kann man doch gar nicht mehr zurück fallen – also erstens: stimmt das? und zweitens: Und wie man das kann! Corona als Argumentationsgrundlage für schlechtere Löhne, höhere Preise, Einsparungen, Privatisierungen, Rettungsschirme für die Industrie ohne jedes klimapolitische Wenn oder frauenpolitische Aber wird uns um die Ohren gehauen werden, dass es saust. Von den Ego-Shootern auf dem Rosa-Luxemburg-Platz wird sich dann keiner mehr blicken lassen.
Mai 2020 – T41
Beim Therapeuten gewesen,
über Konflikte gesprochen und die alte Frage: Reingehen oder Draußenbleiben, und über die überbordende Angst und unbändige Kinderwut, die eine adäquate Antwort darauf so schwer machen.
Mai 2020 – Kinderinfiltration
Ich gehe die Ackerstraße entlang. Ein Mann geht hinter mir mit seiner kleinen Tochter, sie ist vielleicht acht. Was steht da, fragt sie. No border no nation, sagt Papa. Was heißt das, fragt sie. Das heißt, dass die keine Verantwortung übernehmen wollen. Er wird lauter, aggressiver im Ton, als er ihr weiter die Zusammenhänge erklärt. Die sind total realitätsfern. Die wollen keine Staaten. Wie Deutschland, fragt sie. Ja. Aber dann kommen alle Flüchtlinge rein, sagt sie. Er schnaubt, genau, ganz genau, und beide sind erfreut darüber, dass sie aufgepasst hat und sie sich so einig sind.
Morgens auf der Auguststraße. Eine Mutter und ihre Tochter, ca. 11. Aber braucht man die nicht beim Bäcker, fragt die Tochter, und meint offensichtlich die Maske, die sie nicht dabei haben. Ja, sagt Mama, aber die können uns ja nicht dazu zwingen eine zu tragen. Das ist eh alles totaler Blödsinn. Ja, sagt die Tochter. Und dann sieht man es eben nicht mehr ein, die Mutter.
Ich frage mich, wie meine Eltern das gemacht haben. Haben die mich auch so infiltriert? Mein Vater vielleicht, der hat mir auch immer erklärt, wie die Welt zu sehen ist. B. in gewisser Weise auch. Aber was B. gesagt hat, fand ich nie gut. Was mein Vater vorgetragen hat, mit ähnlicher Verve wie der Ackerstraßen-Papa, nur inhaltlich anders, schon. Aber warum? Nur weil ich meinen Vater toll fand und ihm gefallen wollte? Oder konnte ich das irgendwie doch schon beurteilen und hatte zumindest ein dumpfes Gefühl von richtig und falsch, gut und schlecht. Woher kommt, wie man denkt? Sollte man mit seinen Kindern nicht über Politik reden, sie nicht teilhaben lassen, an der eigenen Weltanschauung? Das wär ja irgendwie absurd.
Wie immer denke ich, Eltern sind eben einfach nicht gut für Kinder. Man muss die in die Kita und in die Schule schicken, so früh, so lange und so oft wies geht. Sie müssen Bücher lesen und viel fernsehen und Videospiele spielen und andere Erwachsene treffen. Damit sie verstehen: Es gibt eine Welt da draußen und meine Eltern sind nur zwei von vielen Pupsis da drin.
Mai 2020 – T40
Beim Therapeuten gewesen,
über T.s Betrug mit D. gesprochen und was er mit Verrat zu tun hat.
Mai 2020 – T39
Beim Therapeuten gewesen,
über Misstrauen gesprochen, und das beängstigende Pflänzchen Paranoia.
Mai 2020 – T38
Beim Therapeuten gewesen,
über die Sehnsucht nach Freundschaften gesprochen, die Schwierigkeit, sie zu finden, und die Limitierungen, die sie haben.
Mai 2020 – the f-word
Während eines Meetings mit wichtigen Männern droppe ich das f-word: feministisch. Nur mal so, um zu gucken, ob sie zusammen zucken. Sie zucken, aber sie lassen es sich nicht anmerken. Solche Männer sind gefährlich.
Mai 2020 – Mai 2020
Beispiel für einen normalen Vormittag eines Durchschnittsmenschen im Mai 2020:
Ich stehe auf, habe Kopfschmerzen, wie schon seit Tagen, die Bauarbeiter an der Fassade bohren sich bis in meine Zähne, ich weine im Bad, weil ich nicht weiß, was ich machen soll, damit es mir endlich besser geht und creme mir dabei das Gesicht ein. Dann gehe ich aus dem Haus. An der U-Bahn-Haltestelle steht ein Straßenmagazin-Verkäufer und weint verzweifelt, ich ziehe meine Maske auf, drücke mit dem Ellbogen den Türknopf und steige in die U-Bahn. In der U-Bahn und auf meinem Handy laufen die Nachrichten: George Floyd, ein Schwarzer, wurde von einem weißen Polizisten acht Minuten lang mit dem Knie auf seinem Hals auf den Boden gedrückt und ist daraufhin erstickt, überall in den USA gibt es Proteste, I cant breathe, steht auf den Plakaten, das waren seine letzten Worte. CNN-Journalisten wurden bei der Berichterstattung über die Proteste festgenommen, Trump hat die 100.000er Marke bei den Covid-19 -Toten geknackt, er steht vor einer Kirche und hält die Bibel hoch, auch, weil Twitter ihm zum ersten Mal ein Fakten-Check-Badge an eine seiner Nachrichten geklebt hat. SpaceX ist zur ISS gestartet und macht damit endlich den Weg frei zur Kapitalisierung eines anderen Planeten, die Bundesregierung bereitet die Verabschiedung eines Konjunkturpakets vor, es bleibt zu hoffen, dass sie nicht so dumm sind, der Autoindustrie die Abwrackprämie für Benziner und Diesel in den Abgas-Arsch zu blasen, wenn sie das machen, gehe ich drei Wochen lang auf die Straße, ischschwöre. Im Vorbeigehen trinke ich einen Kaffee in einem Café, das gerade wegen Covid nur To Go geht, der so lecker schmeckt, dass ich am liebsten gleich noch einen trinken würde, setze mich damit noch einen Moment auf den Stuhl davor, trage irgendwelche Termine in meinen Kalender ein und schaue auf das morgendliche Treiben der Sonnenallee, ein Typ stellt sich für Kaffee an, der das Glück hat, dass ihm die Maske sehr gut steht, weil sie seine hübschen Augen betont, dann komme ich in meinem neuen Büro-Domizil an, es ist herrlich hier, Licht, Luft, Geräuschkulisse, alles stimmt, ich kann sofort loslegen, ohne mich zu quälen.
April 2020 – Corona 33 – Codes
1
Ausweichen als wär der andere die Pest ist höflich.
Jemandem nicht die Hand geben signalisiert Herzlichkeit und Respekt.
Sich nicht in den Arm nehmen, sondern den anderen auf Abstand halten, ist das neue coole Ding. Nicht die Köpfe zusammen stecken, sondern weit auseinander sitzen ist Rücksichtnahme, nicht eng nebeneinander her, sondern auf Distanz gehen, zeugt von Verantwortung für den anderen.
Dont touch und stay away ist Liebe.
Wie soll das gehen, den Code umschreiben?
Wo der doch zweite Natur ist, die eigene Natur, gegen die man sich nun wenden soll, die man beherrschen, disziplinieren, repressiv behandeln soll, nicht mal sich selbst darf man anfassen, nicht mal mit sich selbst in Kontakt treten, ein rationales Verhältnis muss aufgebaut, ein Abstand eingezogen werden, zwischen sich und dem eigenen Körper, die Hände hochhalten, als wären sie verdächtige Subjekte, die man soeben aus der Gosse gefischt hat und die man erstmal und zuallererst und bevor man irgendwas anderes tut, mit spitzen Fingern zum Waschbecken trägt, wo man sie bearbeitet, wie man schmutzige Gegenstände eben so bearbeitet, um sie danach endlich wieder als HÄNDE in den Körper integrieren zu können.
2
Die Maske.
Ist ein Thema für sich. Sie ist die größte Irritation von allen. Die Maske ist kein Code (noch nicht). Die Maske ist ein Schock. Ihr Zeichen ist unklar. Sie ist ein Signal, aber was signalisiert sie? Worauf verweist sie?
Auf eine Bedrohung. Auf eine Bedrohung, die vom Träger ausgeht? Auf eine Bedrohung, die vom anderen ausgeht? Auf eine Bedrohung im Außerhalb, im Allgemeinen, in der Umgebung, also auf die Katastrophe? Was verbirgt der Träger der Maske hinter der Maske? Eine latente Bedrohung oder eine akute? Die Maske verweist auf ein hinter der Maske verborgenes Wissen. Auf Nichtwissen zugleich: Man weiß ja nie (aber besser ist es). Es gibt ein Innerhalb der Maske (Hinter-der-Maske), und ein Außerhalb der Maske (Vor-der-Maske). Die Maske als Barriere.
Schutz. Sicherheit. Erleichterung. Alles diffus, changierend.
Die Maske als Gegenstand im Gesicht, mach mal weg, bitte. Ich sehe dich nicht.
Die Maske ist das leere Regal im Supermarkt, das keinen temporären Mangel mehr bezeichnet, sondern einen tatsächlichen. (das Reale).
Die Maske ist das Kondom der Corona-Gesellschaft. Der Mensch ist ein Tröpfchen-Tier. Kränkung. Aufklärung. Scham und Lust (am Weglassen des Kondoms).
Die Maske als Geste der Höflichkeit. Das wäre Code.
Die De-Maskierung als Geste der Rebellion. Der Individualität. (Zuvor: Die Maske als Geste der Unterdrückung gelesen. Der Obrigkeiteshörigkeit, der Herden-Dummheit). Code.
April 2020 – Corona 32 – Isolation 2
In der Küche lege ich ein Gesicht aus Obst und Gemüse.
Eine Woche später ordne ich zwei Kartoffeln zu einer Löffelchen-Pose.
Ich mache Fotos von beidem.
Ohje.
April 2020 – Corona 31 – Normalzustand
Ich lese wie immer in aufregenden Zeiten möglichst schnell Zizek. Diesmal liegt es doch nun wirklich auf der Hand, dass man eine Pandemie als Weltgemeinschaft angehen muss! Eine Rückkehr in den Kapitalismus vor Corona ist nicht mehr möglich! Der alte Optimist. Mein Eindruck: Alle wünschen sich so schnell wie möglich das „Normale“ zurück. Dass der Normalzustand ein Ausnahmezustand war, wird keiner mehr glauben.
April 2020 – Corona 30 – Hallo Berlin
Ich videochatte mit N. und B., wir benutzen zum ersten Mal jitsi, die neue netzpolitisch super vollkorrekte, datensichere Video-Chat-Applikation nach Zoom. Wir quasseln fröhlich vor uns hin, jeder so in seinem Fenster, plötzlich poppt ein viertes auf: Oh-, Entschuldigung!, sagt ein Typ hastig, und verschwindet wieder.
Das Meeting hieß Hallo Berlin.
April 2020 – Corona 29 – V wie verrückt
Ich verabrede mich auf dem Markt mit einem Freund. Ich hab ihn länger nicht gesehen, vor Corona das letzte Mal. Als ich ankomme, sehe ich, dass man am Eingang zum Markt Schlange stehen muss. Als der Freund mich dort entdeckt, läuft er straight auf mich zu ohne stehen zu bleiben und umarmt mich mit den Worten: So, darf ich dich jetzt mal umarmen, das ist ja hier,- Ich, noch in der Umarmung: Äh, nein, eigentlich nicht; er redet weiter, steht dabei dicht neben mir, spricht wie schon zuvor laut, sodass die Umstehenden, sein eigentliches Publikum, ihn hören: Da wird man ja gleich schon wieder angeguckt wie ein Hygieneterrorist, wenn man die Leute umarmt.
Ich bin verblüfft. Niemand den ich kenne, hat sich bisher so benommen. Nein, sage ich, das ist kein Hygieneterrorismus, sondern der erforderliche Mindestabstand und schiebe wie zum Trotz die Maske hoch, die ich heute zum ersten Mal draußen dabei habe, so von wegen Einkaufen und mit Verkäufern reden, da dachte ich, vielleicht fühlt sich das angemessen an. Doch er ist im Schwung, zieht weiter vom Leder: Weißt du eigentlich wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich dich oder du mich jetzt hier ansteckst? Er rechnet es mir vor: Bei eins zu einer Million! Dann beklagt er sich über sein völlig unplanbares Jahr, in dem er nicht wie sonst zweimal Richtung Asien udn diverse Ziele in Europa ansteuern kann. Inzwischen haben wir den Markt geentert, bei einem Kaffee auf die Hand kratzbürsteln wir uns weiter über Sinn und Zweck der Maßnahmen an. Er: völlig übertrieben, niemand kann beweisen, dass die Maßnahmen was nützen, die Leute die grade sterben, wären sowieso gestorben, Ich: völlig angemessen, was ohne die Maßnahmen passiert, können wir doch überall da sehen, wo sie nicht ergriffen wurden, Er: Ich wette am Ende haben wir nicht mehr Tote als sonst, man kann gar nicht beweisen, dass die Leute an Corona gestorben sind, usw., usf.
Später erzähle ich ihm, dass das Autoprojekt abgesagt ist, und man von wegen alternativer Terminplanung grade ja eh nur auf Sicht fahren kann. Ich vergesse, ihm die Anführungszeichen in die Luft zu malen, denke, beim Autothema und wenn man mich ein bisschen kennt, könnte man sich die dazu denken. Er lacht unangenehm, du lässt heute ja auch wirklich kein Klischee aus, sagt er.
Jo, denke ich, nettes Treffen, als ich auf dem Nachhauseweg in der S-Bahn sitze. Ich wurde umarmt ohne gefragt zu werden, der von mir signalisierte Abstand wurde nicht respektiert, ich wurde mit Infos aus der Superchecker-Welt versorgt, von denen alle anderen keine Ahnung haben, bzw. mit der richtigen Interpretation der Infos, die die normale Welt bereit hält, die alle leider nicht richtig zu interpretieren verstehen, ich wurde, während wir auf dem Markt Trüffelöl und Garam Masala gekauft haben – er arbeitet wie immer im Homeoffice bei gutem Gehalt – mit den Belastungen durch die massiven politischen Einschränkungen von demokratischen Grund- und Freiheitsrechten konfrontiert, in diesem Fall seiner Freiheit, eine Reise zu buchen, und zum guten Schluss noch als klischeehaft, also der aktuell grassierenden Mainstream-Dummheit aufsitzend, beleidigt.
Ich finde ihn so unsympathisch wie noch nie.
Später zuhause schreibt er mir. Bedankt sich für das Treffen, das gut getan habe.
Alle haben ihren eigenen inneren und äußeren Prozess mit dem Virus, der nun schon so einige Wochen unter uns weilt und vorhat, noch eine ganze Weile zu bleiben, die einen haben Angst und ziehen sich zurück, die anderen fühlen sich eingesperrt und hauen gegen die Tür, manche tun als wär gar nix, andere bereiten sich auf die Apokalypse vor. Der Virus macht uns alle ein bisschen verrückt.
Da muss man großzügig sein.
April 2020 – Corona 28 – Wildwuchs 2
G. sagt, ich sehe aus wie Jonathan Meese.
Am 4.Mai machen die Friseure wieder auf.
April 2020 – Corona 27 – Auto
Eindrücklich, wie das Auto hier nochmal zu sich kommt. Plötzlich werden Autokinos reaktiviert, Drive-In-Stationen für Corona-Tests eingeführt; am Sichersten sind Sie auf dem Fahrrad oder im Auto, heißt es. Das Auto als privater, abgeschotteter Schutzraum ist zurück. Die Welt außen vor, die Masse der Infektionszombies, Fenster hoch und ab durch die Mitte. Außerdem kann man mal rausfahren, aus dem ganzen Wahnsinn (bitte nicht zu uns, sagt Brandenburg, aber wen schert das). Und auch Hamsterkäufe lassen sich deutlich leichter tätigen mit einem Kofferraum. Glücklich also, wer grade ein Auto hat. Einen Opel Corona, haha. „In Krisenzeiten ist das Auto alternativlos“ witzelt Th. in einer Nachricht. Geiler Slogan für eine Autofirma.
Andererseits. Poppen plötzlich überall Fahrradspuren auf, mal eben schnell in Gelb auf die Straße gezeichnet, wie schnell und unbürokratisch das alles geht, was sonst nie geht, niemals, nienieniemals über Jahre und Zehnte, Forderungen werden laut, man sollte, um den Mindestabstand halten zu können, als Radfahrer und Fußgänger die Straße mitbenutzen dürfen.
Auch hier wieder die Frage. Was für eine Erfahrung wird das gewesen sein. Und was macht sie mit der Welt?
Am 23.4., einen Tag nach den Senatsbeschlüssen, wie die langsame Öffnung vor sich gehen soll, sage ich das Autoprojekt ab.
Das schmerzt.
April 2020 – second thoughts
Ok, cupid – nächster Annäherungsversuch. Diesmal dringe ich bis zur Profileinrichtung vor und poste drei Fotos, zu denen mir geraten wurde. Allein bis ich kapiert habe, wie das geht, stell ich mich an wie Opa mit seinem ersten Smartphone. Mich macht das alles irre nervös hier, kaum bin ich online, bekomme ich Likes: ping, ping, ich habe doch noch gar nichts geschrieben, ping!, stopp! jetzt wartet doch mal!, ich bin doch noch gar nicht fertig.
Ich gehe auf die Likes, kann aber niemanden sehen, das geht nur, wenn ich Geld ausgebe, wie machen das die coolen Leute hier? Und was ist ein Intro, wieso kann ich das nicht sehen, was ist ein Double Take, Help! von wegen Help, nach der Lektüre der Help-Seiten bin ich noch verwirrter, die wirken, als beschreiben sie eine Vorläufer-Version, bzw. als wären sie absichtlich kryptisch.
Ich schaffe es, bei Search durch die Männer zu blättern. Einige wenige, sehr sehr wenige, sind nett, nett, im Sinne von sympathisch. Sie haben alle so ihre Ticks, der eine findet sich zu schön, der andere redet schon im Freitext zu viel, der dritte läuft gleich schon auf Bild 3 vor einem davon (voll mein Typ), alles in allem also nichts ernstlich Unangenehmes, die üblichen Macken halt, nichts, worüber man nicht hinwegsehen könnte.
Aber man muss aufpassen. Manchmal kommt man schon beim zweiten Foto auf den Trichter: Der hat einen riesigen, schnaufenden Hund. Der hat ein Faible für klassische Musik, das er sehnlichst teilen möchte. Der will eigentlich lieber seine Freunde treffen als ne Frau. Und der hat nur den Hauptschulabschluss. Oh, hello, inner snob, da bist du wieder.
Ich warte 24 Stunden, ob jemand hängen bleibt. Einer bleibt. Aber den schreib ich dann nicht an. Er sieht gut aus, der findet sofort ne Bessere.
April 2020 – Corona 22 – zusammengetrennt
Ich videochatte mit N. und B., verabrede mich zum Paralleltrinken mit Ch., L. und T., mit Th. und J. J. macht künstlerischen Quatsch, das gibt schöne Fotos. Später dann: ein Gefühl von. Wehmut? Was zusammenbringt, macht die Trennung sichtbar. Auch der Sommer ist bereits aus dem Rückblick zu betrachten.
März 2020 – Corona 19 – Angst
Ein paar Wochen lang treibt mich die Angst um. Besonders rational ist das nicht. Ich habe Angst, krank zu werden. Ich habe Angst, schwer krank zu werden. Ich habe Angst, alleine krank in meiner Wohnung zu liegen, mit hohem Fieber und Atemnot, und nicht zu wissen, wann ich reagieren muss. Oder nicht mehr rechtzeitig reagieren zu können. Ich habe Angst, eine Lungenentzündung zu bekommen, die man übersieht. Oder eine Sepsis. Ich habe Angst, dass sich in der Klinik niemand um mich kümmert, weil alle denken, die schafft das schon, und dann schaff ichs nicht und keiner kriegts mit.
Ich ziehe jetzt immer den Schlüssel aus der Wohnungstür, damit man im Notfall leichter herein kommt. Ich kaufe mir ein Fieberthermometer und frische die Grippehausmittelchen gegen Husten, Fieber, Kopfweh auf. Ich schaue nach, welche Blutgruppe ich eigentlich habe. Ich lege die Telefonnummern von Gesundheitsamt und Teststellen auf den Nachttisch, bei denen laut Zeitungsartikeln stundenlang niemand abnimmt. Drei Wochen lang treibt mich die Frage um, ob es nicht Sinn macht, sich gegen Pneumokokken impfen zu lassen. Aber ins Wartezimmer eines Arztes will ich gerade nicht. C. versorgt mich mit Statistiken aus einschlägigen Ärzte-Fachmagazinen. Das beruhigt mich am meisten. Die statistische Wahrscheinlichkeit ist unwahrscheinlich.
Als J. mehrmals erzählt, wie hart und anstrengend sie alles findet für eine Familie mit zwei Kindern, reichts mir irgendwann. Allein hat auch so seine Herausforderungen, schreibe ich ihr.
März 2020 – Corona 14 – Werbung
Auch die Werbung passt sich in erstaunlicher Geschwindigkeit an. Ich sehe:
Werbung für Waldfriedhöfe, Patientenverfügungen, einen Ausflug ins All (weil man ja sonst nirgendwo mehr hin reisen kann), einen Keuchen-Feststeller, ein Identifikationsarmband und Alles für die staycation auf deinem Balkon!
März 2020 – Corona 13 – BikeOffice
Morgens auf der Straße fährt eine Frau auf dem Rad an mir vorbei, redet lautstark business in ihre Kopfhörer. Jetzt arbeiten die Leute schon auf dem Fahrrad. Wahrscheinlich besser als zuhause, wo alles so eng ist und die Familie schreit.
März 2020 – Corona 11 – Internet
In der Bäckerei hält der Mann vor mir noch einen kurzen Schwatz mit dem Verkäufer. Er erzählt von seiner Teenager-Tochter, die draußen in Großgruppen mit ihren Freunden herum hängt als wenn nichts wäre. Er so zu ihr: Sag mal, habt ihr kein Internet oder was?
(Das Ding ist, die haben wahrscheinlich anderes Internet.)
Januar 2020 – Männer
Ein Freund aus früheren Zeiten fragt mich: Und, Elli, was machen die Männer? Als wär‘s ganz selbstverständlich, dass die in meinem Leben vorkommen. Even in Mehrzahl. Wie gesagt, er kennt mich von früher. Als Männer in meinem Leben vorkamen, diverse Männer, unter anderem er. Ich bin irritiert. Sieht er nichts oder sehe ich nichts?
Da ist kein Zurück in ein Damals, in dem ich nichts wusste und jemand anderes war, ein gerade mal in die Zeit gefallenes Wesen und kein aus der Zeit gefallenes. Es schien nicht schwer, Männer zu finden, sie waren einfach da. Um mich herum. In Schulen, Ausbildungsstätten, Universitäten, in ausreichender Anzahl, um, ja, um was? Um eine tolle Zeit, voller Aufregung, Liebe, Sex und Abenteuer zu haben? In meiner Erinnerung waren die Beziehungen in diesem Damals vor allem eins: Verkorkst, geprägt von mühsamen und quälenden Nähe-Distanz-Austarierungen, tief sitzenden Ängsten und Psycho-Diskussionen, schwieriger gar als heute, wo ich zumindest im Groben weiß, womit in mir zu rechnen ist und wie man das in Schach hält. Es war eine Zeit, in der ich eigentlich nie wirklich verliebt war und schon gar nicht geliebt habe, sondern höchstens neugierig war und jemanden wollte. Eine Zeit vor T.
Das frag ich mich auch, antworte ich ihm.
April 2020 – T37
Beim Therapeuten gewesen,
Geburtstag gehabt, über T.s Mail gesprochen.
April 2020 – Mann
Ich geh rüber ins Nebenhaus, zur Paketnachbarin, Frau L. Wie immer ärgere ich mich furchtbar über DHL, die es immer wieder schaffen, mir diese Begegnung aufzwingen. Ich! war! zuhause!!!. Lazy Abladepaketbote.
Frau L. macht die Tür auf, das erste was sie sagt:
Det is zu groß. Holn Se ma ihrn Mann.
Ich: Ich hab kein Mann.
(Was denken die Frauen eigentlich immer, was das ist, so ein Mann? Ein Schraubenzieher, ein Gabelstapler, ein zusammenfaltbarer Schleppesel?
Ich linse in den Wohnungsflur. Sie hat recht: Det ist zu groß. Ich ziehe das Paketmonster in den Hausflur, vor ihre Wohnungstür, und nehme es an Ort und Stelle auseinander, mit Hilfe eines völlig stumpfen Küchenmessers, das sie mir im von mir angemahnten Mindestabstand reicht: Ich will sie ja nich anstecken oder so. (Vielleicht sage ich auch erstechen, aber das geht mit dem Messer eh nicht.)
Sie guckt zu, wie ich auspacke und freut sich, dass sie endlich mal erfährt, was so drin ist, in meinen Paketen. Ach, aha, det sieht ja jut aus, sowas will sie sich auch kaufen (Tisch und zwei Stühle für den Balkon). Plötzlich finde ich sie irgendwie fast niedlich, oder uns beide so als ungleiches Paar. Sie, die von Krankheit, Sorge und Unterschichtsfernsehen gebeutelte Frau, die doch nur ein bisschen Gutwetter-Kontakt möchte, den ich, das überheblich-nette Arschloch von nebenan, ihr so ausgesprochen ungern gönne, dass ich jetzt schon beinahe wieder lachen muss. Warum ist das bloß so? Warum kann ich ihr das nicht geben?
Ich schleppe den Müll in die Tonne und die Einzelteile über den Hof nach Hause.
HolnSe ma ihrn Mann my ass.
April 2020 – Corona 24 – Welle und Flut
Ab und an wird das Außen zu machtvoll, bekommt eine Größe, lässt sich nicht mehr in Schach halten, mit der Strategie des Kleinportionierens und den bereit gestellten Rationalisierungsmechanismen wie Fallzahlen, Verdopplungsraten, Studienergebnissen. Dann z.B. wenn jemand von der Krankheit berichtet, ein Arzt oder Kranker, jemand, der sie erlebt und beschreibt, oder dann, wenn Krankenhausbetten in umfunktionierten Hallen mit der Drohne abgefahren und Massengräber ausgehoben werden, dann also, wenn es nicht der schwappende, sich langsam erhöhende Wasserspiegel einer Flut ist, sondern die heranrauschende Welle am Horizont.
April 2020 – T35
Beim Therapeuten gewesen,
über Bedrohung durch Riesenbaustelle gesprochen.
März 2020 – Corona 20 – Krisengewinnlerin
Die Krise, die Krise, ich fühl mich wohl in der Krise. Die Krise ist mein Ding. Allein und isoliert, den Unwägbarkeiten des Universums ausgesetzt, von Angst und Unruhe getrieben, von Tag zu Tag gelebt, überlebt, drüber weg gelebt, kenn ich, hab ich, bin ich. Für die Wackelkandidatin ist die Krise ein piece of cake.
Und dann krieg ich auch noch einen Rettungsschirm aufgespannt?! Werde gesehen, wahrgenommen, plötzlich und zum ersten Mal in meinem Leben, als Freiberufler in meiner strukturell prekären Situation, als Solo-Selbständiger, den nichts auffängt, kein Krankengeld, keine Arbeitslosenversicherung, keine Kurzarbeit, der direkt ins Hartz marschiert, zurück auf Los, um sich dort erstmal von der Bürokratie des Misstrauens wie ein potentieller Verbrecher beäugen zu lassen. Und jetzt? – Name und Steuernummer eingetragen, 24 Stunden später sind 5000 Euro auf meinem Konto. Alter, best time of my job life!
April 2020 – T36
Beim Therapeuten gewesen,
über Dating gesprochen.
April 2020 – T34
Beim Therapeuten gewesen,
ihm drei Geschenke gemacht: Wien-Buchung, Kontakt-Aufnahme zu R. und E. trotz T.-Tabu. sowie die Abgabe von 264 Seiten – keine Ahnung, ob er’s gemerkt hat.
April 2020 – Selfies
Man kann Tausende von Selfies machen, man sieht nie das,
was die anderen sehen.
April 2020 – Corona 23 – Corona Ferien
Ich gebe 264 Seiten ab.
Endlich Corona-Ferien.
März 2020 – Corona 15 – Bauarbeiter
Was ist eigentlich mit den Bauarbeitern? Sind das irgendwie die Siegfriede der Pandemie oder wieso stehen die unbehelligt von Kurzarbeit, Homeoffice, Homeschooling oder abgesagten Projekten in Dreier- oder Vierergrüppchen auf ihren Baugerüsten, in ihren Baulöchern und in ihren Baupausen herum und spucken sich gegenseitig ihre Tröpfchen ins Gesicht? Schon klar, solchen Jungs kann keiner was. Dazu haben ihre Hosen viel zu viele Taschen und ihre T-Shirts schon bei null Grad Hauptsaison. Ein Virus? Lächerlich. Wer so einen hat, soll zum Psychiater gehn. Auf dem Bau gibts sowas nicht, da wird gehämmert, geschuftet und geschleppt ab 7 Uhr morgens, das ist so einem Virus alles viel zu breitbeinig. Mindestabstand, ja glauben die Leut, wir sind schwul, den halten wir doch eh immer. Cheers, darauf einen geteilten Kaffee. Dass die Siegfriede vielleicht in ein paar Wochen alle in der Klinik liegen oder daheim in der Quarantäne festsitzen, daran denkt keiner. Dann würde ja die Baustelle brach liegen. Und gebaut werden muss.
März / April 2020 – Corona 21- Pandemie und Alltag
Die Nachbarin von gegenüber putzt die Fenster.
Im fancy Mitte-Haus auf der anderen Seite des Hofs hat Papa den Kindern ein Trampolin für die Terrasse gekauft, er haut auf einen nagelneuen Punching-Ball. (Wird er brauchen, die nächsten Wochen ohne Schule und Kita. Gut zur Vorbeugung häuslicher Gewalt). Nochmal schnell shoppen gewesen, bevor die Ausgangsbeschränkungen losgehen. Machen wirs uns halt zuhause schön.
Alles passiert so schnell. „Man kann gar nicht so schnell adaptieren, wie es geschieht“, sagt A. in einer Whatsapp-Nachricht. Gleichzeitig reden alle von Entschleunigung.
Die Zeitungen als stetig tickende Begleiter. Irgendwann stelle ich die Push-Nachrichten aus. Zweimal am Tag muss reichen. (Die pushen nämlich auch die Angst.)
Schräg unter der Fensterputz-Nachbarin, bei der anderen Nachbarin, ist schon Gesichtsbräunungsfolie angesagt. Er schmeißt parallel dazu den Grill an.
Jeden Morgen, ganz früh, gehe ich spazieren. Immer die gleichen zwei, drei Runden, eine Thermoskanne mit Tee oder Kaffee in der Hand. Die Straßen sind leer, alles ist wie ausgestorben, manchmal ist das unheimlich. Dann, wenn ich jemanden sehe. Einen anderen allein. Auf weiter Flur. Später wirds voll auf den Gehwegen, zu voll, man kann sich kaum noch ausweichen. Ich laufe Slalom, auf die Straße, wieder hoch auf den Gehweg, halte an, lasse vorbei. Den Abstand einhalten, den Mindestabstand. Das Wort des Jahres. Nein, des Jahrzehnts.
Überhaupt, das wording.
flatten the curve.
stayathome.
social distancing.
systemrelevant.
Die Leute joggen wie irre. Sie keuchen an einem vorbei, ich sehe die Tröpfchen in Zeitlupe auf mich zufliegen wie kleine Geschosse. Bei den Handy-Sprechern seh ich sie lupenfein auf den Aerosolen sitzen und nach sanftem, feuchtem Wolkenflug auf meinen Wangen landen, von wo aus ich sie dann auf eine Schleimhaut meiner Wahl schmieren kann. Nicht! ins Gesicht! fassen!
In der S-Bahn gehen die Türen jetzt automatisch auf.
Das Wetter wird von Tag zu Tag besser.
Die BVG reduziert den ÖPNV: Niedrigere Taktung, kleinere Busse. Ergebnis: Die Leute stehen dicht gedrängt und kommen zu spät. Beschwerden, es wird nachgebessert: Alte Taktung, große Busse. Immer noch überall ganz schön viel Leute.
Die Stadt stinkt wie eh und je. Ich dachte, es fahren jetzt weniger Autos.
Die Stunde der Virologen, Epidemologen. Robert Koch (Herr Wieler), Christian Drosten (Charite), Johns Hopkins University.
Mindestabstand Mindestabstand Mindestabstand. Handhygiene, Armbeuge. So der Reim, den man sich aufs Virus macht.
Im Internet seh ich einen Clip von einer Frau aus dem Iran. Sie trägt Einmalhandschuhe und reibt sich mit blauer Farbe die Hände ein, als wärs Seife. Das ist toll, man sieht, wo leere Flecken bleiben, Innenfläche, Außenkanten, Fingerspitzen. Zweimal alle meine Entchen oder Happy Birthday singen.
Die Stunde auch der Zwangsneurotiker und Verschwörungstheoretiker.
Überall stehen Kisten vor den Häusern, alle misten aus.
Schutzkleidung und FFPmasken verschwinden in hoher Stückzahl aus Kliniken. C. rechnet vor, klar, wenn du 50.000 klaust und sie bei ebay für 10 Euro das Stück verkaufst… Eine Woche später schon sind sie heiße Ware auf dem Weltmarkt. Bestellte Masken und Schutzkleidung in Millionenzahl gehen unter dubiosen Umständen auf Flughäfen verloren, verschwinden auf dem Transportweg oder haben gar materiell nie existiert. Die deutschen Behörden als Einkäufer auf einem „Wild West Markt“, auf dem immer von links einer kommen und die Lieferung für ein paar Millionen bar auf die Hand abzweigen kann.
In Ungarn wird unterm Corona-Radar mal eben weiter an der Diktatur gebastelt. Hier und überhaupt stellt sich die Frage: Wo ist Europa?
Auch eine UN soll es geben, von der hört man nichts.
Berührung
Auf einem Twitter-Clip sind ein paar junge, Masken tragende Chinesen zu sehen, die demonstrieren, wie sie sich in Zeiten des Virus begrüßen: nicht mit Handschlag, no no, sie stupsen die Innenseiten ihrer Füße aneinander, einmal links, einmal rechts. Ich führe das ein, bei C. und G., die ich noch sehe. Wen siehst du noch?, ist häufig die Frage. Rückzug allerorten. Es gibt Leute, die verkünden das richtig, es gibt Leute, die sind einfach nicht erreichbar, es gibt Leute, die sagen, jaja, lass mal treffen und melden sich nicht mehr.
G. .und ich treffen uns zu Distanziergängen.
C. kommt mich auf dem Balkon besuchen. Wir fädeln uns Tetrismäßig in meine Wohnung ein: rückwärts, vorwärts, jetzt du. Dann: Balkonsitzung im Mindestabstand. Als sie geht, und ich sie nicht in den Arm nehmen kann, werde ich traurig.
Es gibt keine Berührung seit Wochen, seit Monaten. Niemand berührt mich. Seit T. weg ist sowieso nicht, nun nicht mal mehr ein Handschlag, eine Umarmung zu Begrüßung oder Abschied. Das ist nicht gesund, sagt die Wissenschaft, da fehlt Oxytocin.
Digitalisierungsschub
Alles und alle gehen in erstaunlicher Geschwindigkeit online: Kinos, Clubs, Festivals, Konferenzen, Schulen, Arbeitsplätze, sogar die Verwaltung. Überall wird Software ausprobiert, fahrig, hektisch, aber eben doch. Ch. erzählt von einer Unterrichtssoftware in der man schnell alles einpflegen kann, Fotos, Videos, alle anderen Materialien, Miro Board.
zoom ist plötzlich das tool der Stunde. Videokonferenzen – machen wir alle mit zoom, die Aktie schießt in die Höhe. Zwei Wochen später haben die Netz-Tech-Überwachungs-consiousness people das Ding schon wieder als Datensicherheits-Supergau entlarvt. Wer cool ist, zieht um zu jitsi. Mal sehen, wie lange das hält.
Den Pornhub Premium Account gibts jetzt for free.
Ich videochatte mit Freunden, verabrede mich zum Paralleltrinken. Das funktioniert erstaunlich gut.
Die kleinen Läden beginnen zu adaptieren: Außerhausverkauf. Fahrradlieferung vom Buchladen. Alles wird bestellt. Amazon stellt Leute ein.
Meine Nachbarn von schräg gegenüber tanzen auf dem Balkon. Hit me baby one more time.
Jeden Abend schaue ich bei United We Stream vorbei. Wahnsinn, wie schnell die waren. Ich kaufe einen Beutel für 15 Euro, Soli-Beitrag.
Versäumnisse
Überall treten Versäumnisse zu Tage. Warum hat man keinen Vorrat an Schutzkleidung. Der bewacht ist, in einem Hochsicherheitstrakt. Wieso gibt es nicht genug Beatmungsgeräte bzw. Intensivplätze. Wieso ist keiner für die Bedienung der Geräte ausgebildet? Warum fängt man jetzt erst mit Homeoffice an und weiß auf die Schnelle nicht, wie? Wieso hat man die Digitalisierung in den Schulen und Universitäten nicht vorangetrieben. Oder zumindest mal die Schultoiletten renoviert und Seife bereit gestellt? Das rächt sich jetzt.
Es gibt Engpässe bei so grundlegenden Medikamenten wie Antibiotika. „Wir“ sind genau wie bei der Schutzkleidung, abhängig vom „Ausland“. Ausland ist grade China.
stayathome für Obdachlose, wie soll das gehen? Kaum kommt einer „von denen“ auf einen zu, wird abgewunken, ausgewichen, es ist ein schrecklicher Anblick. Als hätten genau die alle den Virus. Aber klar, schnorren im Mindestabstand geht irgendwie schlecht. Oder nur schwer. Nach kürzester Zeit sind sie weg, nicht mehr in der Bahn, nicht mehr auf der Straße. Wo sind sie?
Die Nachrichten aus Spanien sind grauenvoll. In Madrid ist die Lage außer Kontrolle. Leichenhallen, Behelfskliniken, Ausgangssperre. Niemand darf zu sterbenden Angehörigen. Schutzkleidung fehlt. Ich mache mir Sorgen um R. und E., traue mich aber wegen T. nicht, Kontakt aufzunehmen. Tue es dann doch. R. ist krank, aber auf dem Weg der Besserung. E. ist isoliert, sicher furchtbar für sie.
Politik
Zum ersten Mal seit ich denken kann, kommt die Politik zu sich selbst. Zu ihrer eigenen Bestimmung. Experten werden einbestellt, angehört. Zuständige Stellen einbezogen. Entscheidungen werden getroffen. Und umgesetzt. Zum Wohle der Bevölkerung. Besonnen, transparent, schnell.
Plötzlich ist Geld da. Geld von dem nie die Rede war, das es nicht gab. Für nichts und niemanden und unter gar keinen Umständen.
In den ersten Wochen jedenfalls blüht die Politik auf. Spahn (Gesundheit), Söder (Bayern), Laschet (NRW), Merkel natürlich. Michael Müller braucht lange, viel zu lange für meinen Geschmack, da sind Lederer (Kultur), und Kalayci (Gesundheit) viel schneller, kriegt dann aber doch noch einigermaßen die Kurve.
Merkel spricht, die Sache ist ernst. Rede an die Nation. Worte von Mutti. Und Vati in Personalunion. Sorge, Mahnung und Masterplan auf Basis von Vernunft und Augenmaß. Besser kann mans nicht machen. Das war schon immer ihre Stärke, im Reaktiven ist sie am besten, die Politik ja generell. Wenn die Kinder brav sind, jedenfalls, verhängen wir keine Ausgangssperre wie in Italien.
Kann man mit Föderalismus auf eine Pandemie reagieren? Bayern hat höhere Fallzahlen, Berlin mehr Solo-Selbständige, Sachsen bisher keine einzige bekannte Infektion.
Nach ein paar Wochen wird spürbar: Die Mini-präsidenten vergessen nicht, sich zu profilieren, die unruhigen Buben hüpfen auf und ab, vor Mutti und ihr auf der Nase herum.
Fallzahlen, Verdopplungsraten, Todesfälle. Seit neustem: Genesene.
Das Internet macht Stress. Sprache lernen, Yogi werden, witzige Clips drehen, Museen besuchen, rare Filme gucken, Masturbationstechniken verfeinern, Leute, was oll ich denn noch alles machen, ich muss ar-bei-ten!!
Fotos machen, Videos sammeln, Wackel schreiben, ich komme nicht hinterher. Hinter dem Versuch, die Dinge zu bewahren, die Momente festzuhalten. Irgendwann gebe ich auf. Machen sowieso alle, ist die bestdokumentierteste Pandemie der Geschichte.
Am Wochenende ist es kuschelig eng auf Gehwegen und in Parks.
Die Organisation in den Kliniken ist erstaunlich. Trotz aller Probleme. Die Situation stabilisiert sich.
P. schickt jetzt jeden Tag ein Video-Rezept per Statusmeldung.
Klimakatastrophe und Flüchtlingskrise kein Thema mehr. Ah, doch, auf der griechischen Insel Lesbos im Lager Moira befürchtet man eine humanitäre Katastophe wenn der Virus ausbricht.
Europa überholt China bei den Fallzahlen.
Auf dem S-Bahngleis eine Durchsage: Zur Eindämmung des Corona-Virus… Okay, das ist spooky jetzt, wirklich wie im Film. Oder in China.
Ein paar Tage später im Supermarkt das gleiche. Durchsage zwischen Werbebotschaft und Sprudelmusik. Wir von REWE versorgen Sie täglich…
Ich lese einen Artikel über einen Pandemieplan der Regierung, mit erstaunlichen Überschneidungen und komplettem Handlungsdrehbuch von 2006, an das sich jetzt keiner so recht hält. Die andere durchgespielte Katastrophe ist übrigens ein Hochwasser aus dem Mittelgebirge. Dann wissen wir ja, was als nächstes kommt.
Hefe ist nicht zu kriegen, trocken, flüssig, fest, alles ausverkauft. Ich schon wieder: Achso…?
Ich gebe 264 Seiten Serie ab! Was soll ich auch sonst machen, liebe Nachwelt, rumrennen und in Panik schreien? Nudeln mit Klopapier horten, mit Hefe überbacken? Mich bewaffnen? – Das machen die Amerikaner. Die Franzosen angeblich Kondome und Wein, well I dont think so, das hat sich doch jemand ausgedacht…
Begrenzungen
Im Supermarkt jetzt Klebestreifen auf dem Boden. Am Imbiss Tape auf dem Boden davor. Quadrate, Striche. Die Geometrie des urbanen Raums. Einteilen, aufteilen, abgrenzen, begrenzen. Flatterband um die Spielplätze, die Parkbänke.
Bitte treten sie einzeln ein. Nicht mehr als drei Personen gleichzeitig.
Die Verkäuferin hinter Plexiglas. Bitte zahlen sie mit Karte.
Mecklenburg-Vorpommern lässt keine Berliner mehr rein. Grenzkontrolle am anti-viralen Schutzwall. Die finden das geil, da bin ich sicher, unser Land muss sauber bleiben. Ausländer und Berliner raus.
Die Maske, die Maske, die Maskendebatte eskaliert. Ja, nein, eventuell unter bestimmten Umständen. Plötzlich: Mundschutzpflicht beim Einkaufen in Jena. Bayern prescht nach. Näh- und Bastelanleitungen all over the Internetz. Die Maske kommt, mit Warnungen, als Empfehlung, Gebot, Pflicht. Die Asiaten wundern sich schon die ganze Zeit: Wieso haben die Leute in Europa keine Masken auf? Entwicklungsland…
Eine joggende Mama, früh am Morgen, die ihre beiden quasselnden Mädchen, so 6, 8 Jahre alt, vor sich hertraben lässt – damit die Ponys für heute gleich mal ein bisschen Auslauf haben.
Plötzlich neue Stimmen. Ist das nicht alles undemokratisch, autokratisch, kann man einfach so Grund- und Freiheitsrechte aushebeln, den Datenschutz aufgeben fürs RKI?, was passiert hier mal eben schnell, unter der Hand, nur weil es grade mal eben schnell passieren muss?
Die Wirtschaft meldet sich zurück. Wieso die so viel und wir nur so wenig? Was habt ihr euch überlegt? Für ein Leben danach. Denn lange lässt sich das hier nicht mehr durchhalten. Wie sollen wir das durchhalten? Wie soll das alles hier nicht zusammenbrechen?
So langsam kippt die Stimmung. Keiner hat mehr Bock. Der Virus kommt jetzt aus einem Labor in China.
Sogar die Zahlen geraten in Verruf. Verschwimmen, geraten ins Wanken. Wie der Boden unter unseren Füßen, wenn er kein gemeinsamer mehr ist. Die Statistiken sind plötzlich alle fragwürdig, müssen oder können anders betrachtet werden. Das macht mir zu schaffen.
Demonstrationen im Mindestabstand gegen die Einschränkung der Versammlungsfreiheit. Eine Mischung aus Wir sind das Volk-Rufern, Impfgegnerinnen, Verschwörungstheoretikern und angeschlagenen Mittelständlern findet sich zur Empörung gegen den Staat zusammen.
Die Öffnung. Wann wird geöffnet, wie wird geöffnet, wer wird geöffnet, ab wie viel Quadratmetern und unter welchen Voraussetzungen. Öffnungsdiskussionsorgien, sagt die Kanzlerin genervt.
Trump stellt die Zahlungen an die WHO ein. Derweil sterben die Leut und werden in Massengräbern beerdigt. New York ist eine Geisterstadt. Die Leute gehen vermummt durch die Straßen. Die Arbeitslosenzahlen schießen durch die Decke.
Bilder aus Neu Delhi. Wanderarbeiter in riesigen Migrationsströmen, auf dem Weg in ihre Heimatorte, tausende Kilometer gehen sie zu Fuß, dicht an dicht, der Bus- und Bahnverkehr wurde von einem Tag auf den andern eingestellt. Vorher versuchen sie noch massenhaft an der Busstation eine Mitfahrt zu bekommen. So agiert auch die Türkei: Schnell mal ansagen, dass jetzt dicht gemacht wird und Massenaufläufe und -schlägereien vor Supermärkten produzieren
In der Zwischenzeit zeigt die Weltkarte kaum mehr einen Fleck ohne Virus.
In Wales laufen Schafe durch die Fußgängerzone. Endlich mal in Ruhe shoppen, jetzt, wo die nervigen Menschen weg sind. Die Rabatten schmecken auch nicht schlecht. Tiger auf der Straße in Indien, Seelöwen irgendwo anders.
Alles. geht. so. schnell.
April 2020 – Corona 34 – 20erJahre
Ich hab doch gesagt, die 20er werden wild. Alles pochte und kochte auf ein Nadelöhr zu und nun ist es soweit, irgendwas explodiert hier, wenn auch in Zeitlupe, alle rasen ineinander, aufeinander und wollen irgendwo durch, müssen, und die Frage ist, wird danach alles anders? Oder nichts? Was wird das hier für eine Erfahrung gewesen sein? Was wird sie mit uns machen? Welche Kräfte werden gewinnen?
April 2020 – Corona 26 – Wildwuchs1
Meine Haare werden lang und länger.
Ich hab vergessen, vor der Apokalypse nochmal zum Friseur zu gehen.
März 2020 – Corona-Knast
Der Radius wird immer kleiner. Jeden Tag die gleichen fünf Straßen. Am Wochenende mal in den Park. Erst kam man aus dem Land nicht mehr raus, dann nicht mehr aus der Stadt, dem Kiez, der Wohnung. HomeOffice, HomeSport, HomeFood, HomeAlone. Wie halten die in Spanien das aus, die Ausgangssperre haben, nicht nur Ausgangsbeschränkungen. Die Perspektive fühlt sich bedrückend an, den Sommer zuhause verbringen, nicht wegfahren, der Sommer der Tagesausflüge.
Ich befürchte, Wien im Juni ist gestrichen.
April 2020 – Therapie 4 – Karate Kid
Ich bin noch nie gerne zur Therapie gegangen. Wer geht schon gerne zum Zahnarzt. Wer unterzieht sich schon gerne einer langwierigen, schmerzhaften, dringend notwendigen Prozedur. Jetzt, nach vielen Monaten in dieser Therapie, bei diesem Therapeuten, habe ich zum ersten Mal das Gefühl, ich gehe zu einem Wellnesstermin. Oder sagen wir, zu einer Trainingsstunde. Einmal die Woche fahre ich zu meinem Mentor, meinem sensei, der mir zuhört, der mich ernst nimmt (aber nicht zu sehr), der mich sieht. Der möchte, dass es mir besser geht, und der anders als ich, daran glaubt, dass das passieren kann. Der mich dabei begleitet, zu mir zu kommen, zu dem was ich bin, und der das, was ich bin, aushaltbar findet. Klar tut mir nach dem Training alles weh. Aber manchmal ist auch plötzlich alles leicht. Ich sauge auf, was ich dort erlebe, und es trägt mich, wirkt in mir den Rest der Woche. Ich freu mich auf die nächste. Das hatte ich noch nie.
April 2020 – Corona 25 – Isolation
Mich macht die Isolation nicht verrückt,
ich führe einfach Selbstgespräche.
März 2020 – Corona 17 – Brot
Ich komme vom Einkaufen, es ist noch früh am Morgen. Ich gehe Richtung S-Bahn-Unterführung, niemand ist auf der Straße. An der Ecke zur Unterführung liegt ein umgekippter Einkaufswagen voll mit Broten: Kastenbrote, Rundbrote, Stullen. Die Hälfte der Brote liegt auf dem Gehweg. Es war kalt heute Nacht, die Brote sind steinhart. Hier in der Unterführung übernachten oft Obdachlose. Jemand hat es also gut gemeint. Jemand ist eine erfolgreiche, stadtbekannte Bäckerei, ihr Name ist dem Einwickelpapier der Stullen zu entnehmen.
Ich zücke mein Handy, um die Situation zu fotografieren. Ein junger Mann kommt aus dem Haus gegenüber und sieht die Bescherung. Was ist das denn? fragt er. Ja, sage ich, ich wollts grade fotografieren. Das braucht man nicht fotografieren, sagt er genervt, da packt man an und räumt es auf.
Ich schäme mich. Sie haben recht, sage ich. Er fängt an, das Brot in den Wagen zu räumen, ich helfe ihm, doch einen Moment später hab ich keine Lust mehr, das hier ist Schwachsinn:
Der junge Mann und ich nah beieinander, nachdem ich es den ganzen Morgen geschafft habe, mich auf Mindestabstand zu halten, ich ärgere mich über die Bäckerei mit ihrem dumm-nervig schlechten Gewissen, das verständlich ist, aber hier in der Ausführung zu einem absoluten Desaster führt, das kann doch nicht das erste Mal sein, dass die sich um ihre übrig gebliebenen Brote Gedanken machen, nur weil Corona ist und plötzlich die Obdachlosen in aller Munde? Was stellen die sich vor, dass die Obdachlosen hier kraftvoll in eiskalt gefrorene Kastenbrote von gestern beißen, dass sie sich schön Bütterkess auf die Laibe schmieren, Salami und Gürkchen obendrauf, um das Frühstück ihres Lebens zu genießen, dass die sich freuen bis zur Weihnachtsrührung, dass ihnen endlich mal jemand Brot schenkt? Ich finde, man sollte die Bäckerei darüber unterrichten, dass ihr Schuss nach hinten losgeht, dass es so nicht funktioniert, dass sowas nur die Ratten anzieht und ein paar Blödmänner, die den Wagen umschmeißen, dass man so niemandem eine Freude bereitet, sondern ein Gesundheitsrisiko, und jetzt wird es mir zu doof dem jungen Mann weiter zu helfen, der anders als ich ein Nachbar hier ist, vor dessen Haustür sich die Sauerei geriert, den ich also plötzlich irgendwie zuständiger finde als mich, und ich hätte wohl ein Foto davon machen sollen, warum hab ich mich geschämt, mich von ihm verunsichern und davon abbringen lassen?, es ist meine Art mich den Dingen zu nähern, ein Dokument herzustellen, das hat auch seinen Wert, und ich hätte denen in der Bäckerei das Dokument unter die Nase halten können, damit sie sehen, was für einen Blödsinn sie verzapft haben, er hat ja recht, man läuft an zu vielem vorbei, statt es zu ändern, und sagt dann, ist ja alles mal wieder irre hier, krasskrass, und bildet lediglich ab, was man sieht, aber ich hab jetzt keine Lust mehr, ihm zu helfen. Ich bin wütend und lasse ihn stehen.
März 2020 – Corona 18 – Träume
1 Hieronymus Bosch-Traum: Menschen werden geschlagen, gefoltert, man sieht Gliedmaßen und hört Schreie, vor mir auf dem Boden liegt ein großes weites Hemd, der Oberkörper und die Arme darin sind nur noch Matsch, trotzdem wird weiter drauf geschlagen, mit einem Baseballschläger.
2 Ich träume von Ratten, sie sind in den Schächten einer Wohnung, rasen, laufen über eine Lampe, verbinden sich mit einer Kakerlake, die ihnen ins Auge spuckt, mein Vater ist da, er treibt eine der Ratten in die Ecke, fängt sie mit der Hand, es ist ein guinea-pig, oder eher eine Maus ohne Schwanz.
März 2020 – Corona 16 – allein
Wer jetzt allein ist,
lese ich in einem Artikel kurz nach der Kontaktsperre,
wird es lange bleiben.
Danke für die Info.
März 2020 – T33
Beim Therapeuten gewesen,
über die alte Frage des Kämpfens oder Loslassens gesprochen, und darüber, dass es dabei nicht um richtig oder falsch geht, sondern darum, beide als mögliche Anwendung im Sinne eines Werkzeugs zu begreifen.
März 2020 – Corona 12 – Liebe in Zeiten des Corona
Wie soll das jetzt gehen, die nächsten Wochen und Monate? Irgendwas mit irgendwem anzetteln? Ist die Corona-Krise eine Krise der Dating-Portale? Was machen die denn jetzt eigentlich, wenn sich keiner mehr treffen will, komisch, dass die noch nicht auf ihre prekäre Situation aufmerksam gemacht, noch keine schnelle, unbürokratische Hilfe vom Staat angefordert haben.
Ist ja in gewisser Weise fieser als bei STDs, man muss ja nicht mal Sex haben, um sich anzustecken, man muss ja nur zusammen was trinken gehen. Küssen geht gar nicht, vögeln nur im empfohlenen Mindestabstand von 2 Metern. Oder kapier ich’s nur wieder nicht und alle verabreden sich hinter meinem Rücken fröhlich? G. meint, ja. G. meint, genau andersherum wird ein Schuh daraus, in solchen Zeiten sehnen die Menschen sich besonders nach einer Beziehung und deswegen gehen die User-Zahlen bei den Dating Portalen jetzt erst richtig hoch. Dann wird halt erstmal gechattet für die nächsten Wochen. Ach so, gechattet wird. Und sich ausgedacht, wie man die üblichen Dating-Treffpunkte Bar, Café, Kino anpassen könnte. Also z.B. rausgehen und sich bei einem Mindestabstandsspaziergang unterhalten. Das kapiere ich sofort. 2 Meter Abstand finde ich gut. Wenn man jemanden nett findet, kann das auf Dauer richtig erotisch werden. Ach, was könnten wir brennen, aber wir dürfen nicht. Ach, was denken wir uns für schöne Sachen aus, wie wir beisammen sein können, ohne uns zu berühren und mit unseren Tröpfchen voll zu spucken. Und natürlich kriegsromantisch: Damals, Kinder, die Welt war aus den Fugen, die Zeiten (vor allem für Solo-Selbständige) hart, aber wir hatten einander und liebten uns via Videochat.
Die Zahlen für Sex Toy-Verkäufe sind jedenfalls schon in die Höhe geschossen, weiß G. zu berichten. Wobei, da muss man aufpassen, gebe ich zu bedenken, Sexspielzeuge sind ja doch erstmal vor allem Dildos und Vibratoren, die meistens zum Masturbieren verwendet werden. Und das ganze andere Plastikspielzeug weist außerdem ja eher darauf hin, dass bereits vorhandene Paare sich überlegen, naja, also wenn wir jetzt hier schon wochenlang aufeinander hocken, können wir ja auch mal wieder ausführlich Sex machen. Dann wäre die Sex Toy-Sache also doch eher ein Hinweis auf: Singles spielen die nächsten Wochen mit sich selbst.
März 2020 – Corona 10 – ältere Leute
Keine Ahnung, ob sich da hormonell was verändert oder sich sonstwie was im Hirn anders verbahnt, aber ältere Leute scheinen echt kein Bewusstsein mehr für die Gefahr zu haben. Wie oft ich das jetzt schon gehört habe, dass die erwachsenen Kinder auf ihre Eltern einreden, nicht mehr zur Rush Hour mit dem Bus zu fahren, doch bitte darüber nachzudenken, den Spanienurlaub zu verschieben, nicht mehr im Kirchenchor singen zu gehen, das ist schon verwunderlich. Als ich meinen älteren Nachbarn – angetriggert durch Aufrufe in den Medien zugegebenermaßen, wirklich wohl ist mir dabei nicht – im Hausflur frage, ob alles okay ist und ob sie was brauchen, reagiert er irritiert und unwirsch. Vom Vater einer Freundin höre ich, dass er zunächst denkt, er solle seine Enkelkinder nicht sehen, um sie vor ihm zu schützen, nicht anders herum. Als man ihm sagt, dass er zur Risikogruppe gehört, kann er das nicht glauben, er ist doch noch gar nicht alt. Erst 76. Von einem anderen älteren Herrn wird kolportiert, er halte die 20-Sekunden-Handwaschregel für völlig überzogen (dafür hab ich keine Zeit) und wolle es sich nicht nehmen lassen, den Leuten jovial wie immer die Hand zu schütteln, alles andere wäre ja auch unhöflich. Was ist das bei diesen älteren Leuten? Das Leben am Abgrund, das man sowieso gewohnt ist? Das Gefühl, keine Zeit mehr zu haben, für so ein aufgeschobenes, abwartendes Leben, weil das eigene ja jederzeit vorbei sein kann? Die Idee einer Unverletzlichkeit, weil man nun schon so viel erlebt hat, und nichts davon hat einen umgebracht? Oder das Stoische der Gewohnheit, so wars schon immer und das mach ich jede Woche, warum solls jetzt plötzlich schlecht sein, warum ändert sich ständig was, man muss nicht alles mitmachen?
Wenn demnächst der junge Mann von unten an meiner Tür klingelt und fragt, ob es mir gut geht und ob er was für mich einkaufen soll, dann hau ich ihm die Tür vor der Nase zu.
März 2020 – Abgrund
Ich weiß nicht, wo du bist. An welchem Ort du all das liest, was ich lese, denkst, was ich denke, fühlst, was ich fühle. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Deiner Mutter, deiner Tante, deinen Freunden in Spanien. Ich weiß nicht, ob jemand bei dir ist, der all das von dir weiß, während ich allein in meinem Bett liege.
Nur einen Abgrund entfernt.
März 2020 – T33xx
Nicht beim Therapeuten gewesen,
wegen Corona abgesagt.
März 2020 – Corona 9 – Dienstag
17.3. Dienstag. Bis letzten Dienstag hab ich mir Sorgen gemacht. Dass ich krank werde, mit hohem Fieber allein in meiner Wohnung liege, dass meine Freunde krank werden, meine unvorsichtigen Eltern. Bis dahin dachte ich: Ich gehöre ja nicht zur Risikogruppe. Ich bin nicht 70 plus, ich habe keine Vorerkrankungen. Wenn ichs krieg, und damit ist zu rechnen bei einer Prognose von 80 Prozent der Bevölkerung, so die in den letzten Wochen stetig in Pressekonferenzen und Talkshows nach oben korrigierte Zahl, dann krieg ichs und dann hab ichs und dann bin ich krank und hab einen milden Verlauf und bin für 14 Tage in Quarantäne und das ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht, womöglich sogar besser, denn dann ist das Thema ein für alle mal durch. Letzten Dienstag dann in Italien: Der Shutdown des gesamten Landes. Am Donnerstag Berichte aus Kliniken am Rande des Kollaps, Ärzte, die nach Triage behandeln wie zuletzt im Krieg, den keiner von ihnen mehr erlebt hat, die Menschen sterben lassen, weil nicht genug Beatmungsgeräte da sind, Patienten, die immer jünger werden und trotzdem schwere Verläufe mit Lungenentzündung und Organversagen haben. Warum sollte ich der üblichen deutschen Überheblichkeit aufsitzen, dass so etwas hier ja nicht passieren kann? Soll mich das jahrzehntelang durchprivatisierte und kaputt gesparte Gesundheitssystem mit seinem fehlenden Pflegepersonal, den dicht gemachten Kliniken, dem Mangel an Schutzkleidung, Desinfektionsmitteln und den Problemen beim Medikamentennachschub davon überzeugen? Italien und Spanien sind keine Entwicklungsländer, man kann den Virus nicht mehr in die Ferne schieben und nicht ins Fremde, wie alle seine Vorgänger, man kann ihn nicht wegdeuten in ein schmutzig-diktatorisches Asien oder ein eh nichts auf die Reihe kriegende Afrika, nein, die Gesundheitssysteme Italiens und Spaniens sind modern, europäisch und ebenso gut bzw. schlecht aufgestellt wie unseres.
Heute ist wieder ein Dienstag. Italien verzeichnet 25.000 Infizierte und 2000 Tote. Ich mach mir keine Sorgen mehr. Ich hab Angst. Davor, einen schweren Verlauf zu haben, in einem Krankenhausflur zu liegen und übersehen zu werden, weil nicht genug Personal da ist oder kein Beatmungsgerät mehr übrig ist. Davor, dass es Freunden so ergehen könnte, Angehörigen.
Derweil stehen die Leute Schlange am Eisstand, gehen ins Nagelstudio und shoppen bei Other Stories und Weekdays. Wir brauchen eine Augangssperre.
März 2020 – Corona 8 – Schönwetterkatastrophe
Das kann doch einfach nicht sein, bei dem schönen Wetter! Das Wetter ist doch immer schlecht, wenn Katastrophen stattfinden, das weiß man doch. Da regnet und hurricanet es doch am Himmel, da dräut das Unheil doch am Horizont. Nicht so hier, nein. Hier ist das Wetter sonnig, warm und vielversprechend, es macht Lust auf Leben und Zusammensein. Wie kann es also sein, dass sich hier, zwischen uns, gerade die Katastrophe ereignet? Es kann nicht sein. Es fühlt sich einfach nicht so an.
Die Katastrophe wird erst da sein, der Virus wird erst dann sichtbar sein, wenn wir Angehörige haben, die infiziert sind, um ihr Leben kämpfen oder sterben. Das Wetter wird dann immer noch gut sein. Bestens, sogar.
März 2020 – T32
Beim Therapeuten gewesen,
über das andere Wärmelevel eines potentiellen nächsten Beziehungskandidaten gesprochen.
März 2020 – Corona 7 – biggest fear
Meine größte Angst ist nicht, dass das Klopapier ausgeht, sondern das Internet.
März 2020 – Stadtnatur
Auf dem schmalen Gehweg in meiner Straße liegt eine Taube quer: Tot, ohne Kopf. Jemand, ein Hund?, eine Katze?, hat ihn ihr abgebissen. Als ich eine halbe Stunde später zurück komme, sitzt eine Krähe auf der Taube und hackt ihr mit ihrem großen Schnabel die Eingeweide raus. Oder das was in den Eingeweiden drin ist. Die Federn fliegen nur so, mir vor die Füße.
März 2020 – Corona 6 – Corona Party
14.3. Samstag. Die Leute unten auf dem Platz als wenn nichts wäre. In Gruppen von zwei bis zehn stehen sie zusammen in der Frühlingssonne, trinken Rosé vom Weinladen und schwatzen sich ihre Tröpfchen ins Gesicht. Und ich denke, mann, klar, würd ich auch gern, aber come on, lest ihr keine Zeitung? Es geht doch nicht nur um euch, sondern um alle. Und wie passt diese Sorglosigkeit zusammen mit den Preppern und dem Hamstern und dem ausverkauften oder rationierten Desinfektionsmittel (jeder bitte nur zwei) und den Home-Office-Vorgaben und den zum ersten Mal in der Geschichte flächendeckend dicht gemachten Einrichtungen? Was soll diese Corona Party? Oder ist das eine Versammlung der Berliner Impfgegner? Ist das: Wir gehören eh nicht zur Zielgruppe, denn wir sind jung und gesund? Oder ist das: Wir sind hier in Deutschland, was soll schon passieren? (Klar, unser zusammen gespartes Gesundheitssystem wird uns retten.). Ist das: Politik du kannst mich mal, statt wie sonst: Wo bleibt die Politik? Oder ist das Tanz auf dem Corona-Vulkan, heute nochmal feiern, weil morgen ja vielleicht schon krank? Versteht man es erst, wenn man den ersten Infizierten kennt oder selbst krank wird? I dont know. Ich finds jedenfalls im höchsten Maße nicht okay.
März 2020 – Corona 5 – Wunder
14.3. Samstag. Bei der Bio Company ein Wunder: eine Packung Toilettenpapier liegt im untersten Regal. Ich steh davor und denke, na komm, nimmste mit und will gerade zugreifen, da kommt eine Mutter flankiert von Mann und zwei Kindern von rechts, und schnappt zu. Wow. Menschen mit Familie sind gefährlich, sag ich ja schon immer. Ihr Trieb, die Brut zu versorgen und die geöffneten Schnäbel ihrer Kleinen mit Klopapier zu stopfen, ist so ausgeprägt, da ist Breaking Bad einfach immer round the corner. Dabei hätte ich das Klopapier freiwillig rausgerückt, guck mal, eine Familie, die braucht das nötiger als ich.
März 2020 – Corona 4 – Ereignisse
11.3. Mittwoch. Die Volksbühne schickt eine Mail: Bis 19. April alle Veranstaltungen gestrichen. Das Berghain verkündet, dass es dicht macht.
Das Berghain macht dicht?!
12.3. Donnerstag. Der Regierende Bürgermeister Müller agiert zögerlich.
Auftritt Merkel.
Sukzessive wird in B alles geschlossen. Bäder, Bib, Museum,… – Schule und Kitas ab Montag!
13.3. Freitag. Ab Montag sollen nun alle Clubs, Bars, Kneipen schließen. Also jetzt am Wochenende nochmal richtig schön anstecken?
Am späten Nachmittag beschließe ich, für nächste Woche alles abzusagen: Therapie, Physiotherapie.
Keine Lust mehr, Bahn zu fahren. Plötzlich husten alle. Derweil schüttelt Trump Bolsonaro die Hand.
Der Virus überlebt 72 Stunden auf Metall und Plastik. Was ist mit Stoff? Hat denn niemand Stoff untersucht?
14.3. Samstag. Ich spaziere morgens um 7 durch die menschenleere, sonnige Stadt. Kaufe einen Kaffee, obwohl ich mir vorgenommen habe, meinen Kontakt als Kundin deutlich zu beschränken.
Boris Johnson regiert den Virus nach der Nudging-Methode. Na, wenn das mal gut geht.
Nun doch schon ab heute alle Clubs, Bars und Kneipen zu. Die Polizei geht von Tür zu Tür und schmeißt die Leute raus.
März 2020 – Corona 3 – Italien
10.3. Dienstag. Italien macht nach dem Norden nun das ganze Land dicht. Die Nachrichten aus den Kliniken sind dramatisch. Es gibt zu wenig Beatmungsgeräte. Die Ärzte arbeiten mit Triage, einem Behandlungsplan bei Katastrophen und im Kriegsfall. Er reguliert die Entscheidung, wer noch behandelt wird und wer nicht mehr. Es gibt Überlegungen, über 90jährige gar nicht mehr aufzunehmen. Dann heißt es, über 80jährige.
Ich bin schon eine ganze Weile auf der Welt. Es gab schon ne Menge. Aber das gabs noch nie. Seit heute nehme ich die Sache ernst.
März 2020 – Corona 2 – Zettelwirtschaft
In der Apotheke hängt zu meiner Überraschung ein Zettel im Fenster: Desinfektionsmittel und Atemschutzmasken ausverkauft. An drei weiteren Apotheken an denen ich im Laufe des Tages vorbei komme: Die gleichen Zettel. Auch bei Obi sind sämtliche Masken weg. Ich will da nur Kappen für Stuhlbeine kaufen (super schwierig by the way).
In der Drogerie fragt eine Frau, wann denn wieder Desinfektionsmittel da ist. Das kommt wenns kommt, so die gereizte Verkäuferin. Es gibt keine Vitamin C plus Zink Kapseln mehr, stelle ich fest.
Im Supermarkt sind die Regale leer. Nudeln, Chili con Carne, Reis. So langsam frage ich mich, ob die anderen doof sind oder ich.
Wir haben heute keine Lieferung bekommen, sagt der Kassierer und ärgert sich: Das ist alles Panikmache! Total übertrieben!
2.3. Heute der erste Infizierte in Berlin.
März 2020 – Corona 1 – Lust der Ausnahme
Im Einkaufswagen neben meinem: Nudeln, Fertigsaucen, Chipstüten und Klopapier in rauen Mengen. Man könnte fast meinen, die Leute freuen sich auf den Ausnahmezustand. Endlich mal in aller Ruhe zuhause abhängen, futtern, glotzen, auf Klo gehen.
März 2020 – Twitter-Justiz
Lobo, Stokowski und Passig u.a. unterschreiben einen Brief an den Rowohlt Verlag (ihren Verlag). Sie wollen nicht, dass der die Autobiografie von Woody Allen veröffentlicht wird. O-Ton aus dem Brief:
Wir haben keinen Grund an den Aussagen von Woody Allens Tochter Dylan Farrow zu zweifeln.
Wow.
Leben wir in einem Rechtsstaat – der Woody Allen im übrigen zweimal den Prozess gemacht hat – oder in der Twitter-Justiz? Ist das jetzt investigativer, Sorgfalts-Journalismus? Und: kann ich mir bitte mal eine eigene Meinung bilden, ohne dass diese selbstgerechten Super-Blogger mir wegen Hörensagens ein Buch unzugänglich machen?
Enttäuschend!
März 2020 – Gehörige Wörter
Unterhalte mich mit G. in der S-Bahn. Als wir aufstehen, um an der nächsten Station aus zu steigen, spricht mich eine ältere Frau an, die allein im Nachbar-Vierer sitzt:
Solche Wörter sagt ein Mädchen aber nicht.
Ich, verblüfft: Welche Wörter denn?
Sie: Na, da hab ich einige gehört, die sich nicht gehören. Mehrmals!
Dass das Mädchen Ende vierzig ist und sich an höchstens zweimal scheiße und eventuell fuck erinnern kann, und die alte Frau aus dem letzten Jahrhundert stammt, macht nichts,
das Mädchen schämt sich trotzdem.
Februar 2020 – Therapie 3
Der Therapeut als Übergangsmann.
Jemand an dem man sich abarbeiten, den man kennen, verstehen lernen kann, jemand, auf den man wütend sein kann, den man schlecht behandeln kann, den man in aller Ruhe nerven, ärgern, provozieren kann, jemand, zu dem man scheiße sein kann, jemand, zu dem man nett sein kann, für den man schwärmen, den man zutexten und vollheulen kann, jemand von dem man sich abhängig fühlen und die nächste Stunde absagen kann,
ohne Angst haben zu müssen,
nächste Woche nicht wieder hin zu dürfen,
ohne Gefahr zu laufen,
sich oder ihm
weh zu tun.
Februar 2020 – Jetzt oder morgen
Dokumentarfilm aus Wien. (Auf der Berlinale gesehen, am Publikumssonntag, zusammen mit H.),
Im Zentrum des Films eine junge Frau, etwa 19, mit ihrem dreijährigen Sohn. Frisch getrennt vom Vater des Kindes zieht sie zurück in den Heimathafen, in die kleine Wohnung der Mutter, um die 50. In der Wohnung lebt schon: Der Bruder der jungen Frau, Anfang zwanzig.
Hier wird sich nicht geschlagen, eigentlich sind alle ganz lieb zueinander. Der wichtigste Ort ist die Couch, auf der alle schlafen, dösen, glotzen, daddeln, scrollen, kuscheln, sich umarmen, balgen, auf und abspringen, eine unglaubliche Körperlichkeit gibt es hier, ausgehend von der den ganzen Tag in ihrem Bürostuhl vor zwei Bildschirmen sitzenden Mutter, die darin täglich dicker zu werden scheint. Alle wollen nur eins: ihre Ruhe. – Alles was von außen kommt, sei es noch die kleinste Anforderung, wird als total Belastung erlebt. Eine Bewerbung schreiben, ein Besuch beim Amt, ein Arzttermin, eine Rechnungaufforderung. Niemand ist hier in der Lage mit dieser Art von Druck umzugehen. NIemand will hier raus. Man möge sie doch endlich alle in Frieden lassen. Ein paar Mal gibt es Zoff, der Bruder, noch am Lebendigsten von allen, ist gekränkt, weil man seinen Geburtstag nicht richtig feiern will, das VErsprochene RAusgehen am Ende nicht stattfindet. Das Kind, das ist es, was in diesem Film am Schwersten auszuhalten ist, geht dabei vor die Hunde. Es ist noch klein, wird im Laufe des Films irgendwann ein Schulkind, und doch denkt man schon jetzt: Alles verloren, nochmal zurück auf Los, bitte!, irgendwo anders hin, dann vielleicht, hat es eine Chance, aber so: Sehen wir ihn schon jim Geiste auf dem Sofa sitzen, wenn er so alt ist wie seine Mutter jetzt, in diesem Kokon verbleibend in den man ihn verstrickt hat, wie alle anderen auch. Der temporäre Auszug mit Mama zum neuen Daddy erweist sich als Desaster, das junge Paar macht schnell Schulden, verliert die Wohnung, und Mama, Kind, plus neuer Daddy sind wieder daheim bei Oma.
Wirklich arm ist hier niemand. Computer, Laptop, Handy, alle haben alles, allerdings auch Schulden. Es lohnt sich nicht zu arbeiten, damit kann man die Schulden nicht tilgen, findet der neue Daddy. Auch sonst verdient man beim Arbeiten einfach zu wenig Geld für zu viel Stress. Bei Licht betrachtet stimmt das auch.
Diskutiere danach mit H. Was ist da schief gelaufen? Ist das was schief gelaufen? Sind die einfach so wie sie sind, soll man sie einfach so lassen wie sie sind? Wäre diesen Menschen mit einem Grundeinkommen (wirklich) geholfen?
Ich denke noch oft an den Film. Vor allem an den kleinen Jungen, der in einer schrecklichen Szene von Mama und dem neuen Daddy gedemütigt wird. Weil er nichts kann, nichts, weil er dumm ist, zu dumm und noch dazu lahm.
Februar 2020 – T31
Beim Therapeuten gewesen,
über Abhängigkeit gesprochen und was sie mit mir und mit mir in Bezug auf andere macht.
Februar 2020 – Ich war 13
Nehmen wir an, ich würde meinem 13jährigen Ich erzählen, wie ich heute so lebe.
Also, Elli, 13, du lebst in Berlin und arbeitest als Autorin. Das geht mehr schlecht als recht und du hast keinen Erfolg, aber du hängst sehr daran und willst es nicht aufgeben. Du hast oft Geld- und Zukunftssorgen. Du wohnst alleine in einer kleinen Wohnung mit einem Balkon mitten in der Stadt. Du hast nicht geheiratet und keine Kinder bekommen. Du hast eine große Liebe gehabt, die dich verlassen hat und nun bist du traurig. Du hast wenige, aber gute Freunde. Du hast Ängste und Depressionen und gehst regelmäßig zur Therapie. Du hast ein paar Reisen gemacht.
Was würde mein dreizehnjähriges Ich dazu sagen. Ein Ich, das keine konkrete Vorstellung von der Frau gehabt hat oder gewagt hat, sie zu haben, die sie einmal sein und werden will, von dem Beruf, den sie einmal haben will?
Berlin und Autorin fände sie cool. Nicht verheiratet, keine Kinder auch. Große Liebe sowieso. Aber warum, würde sie fragen, hast du so wenig Freunde? Bist du nicht nett zu den Leuten oder warum mögen sie dich nicht? Kannst du dich da nicht mehr anstrengen? Noch immer hast du so viele Ängste?, würde sie sagen (und das würde ihr Angst machen), ich dachte, das hört auf, wenn man erwachsen ist, ich dachte, das wächst sich raus. Und: Ich verstehe, würde sie sagen, dass du traurig bist, weil der mit der Liebe weg ist, aber kannst du dir nicht einen neuen Freund suchen? Und was ist mit dem Erfolg, (Geld war ihr noch nie wichtig, da hat sie schon immer trotzig getan und gefunden, das sollte auf den Bäumen wachsen.), ich meine, bist du jetzt eine Autorin oder tust du nur so? Ich dachte, würde sie sagen, und verträumt gen Himmel schauen, du fährst mal als Journalistin überall auf der Welt herum und schreibst kluge, einfühlsame, preisgekrönte Artikel und Reportagen über Menschen. Und du hast einen Freund, der dich sehr liebt und du lebst alleine oder mit ihm, aber eher alleine, in einer sehr coolen, und sehr cool eingerichteten Wohnung. Und du hast viele Freunde, gute, aber nicht wenige, sondern viele. Die kommen bei dir vorbei, und setzen sich an den Tisch, und dann gibt es Essen und alle diskutieren miteinander wie in einem Salon, und es entstehen Ideen und Gedanken, die fliegen über den Tisch, und am Ende geht aus der einen oder der anderen Sache sogar etwas hervor, ein Buch, ein Film, eine Veranstaltung. Und du kannst viele Sprachen, Spanisch, Französisch, Italienisch mindestens, aber auch Japanisch und selbstverständlich fließend Englisch, denn du bist ja so viel im Ausland gewesen und warst doch immer so gut in Sprachen.
Phff, würde ich zu Elli, 13, sagen, denn so langsam wäre ich genervt, hör du erstmal auf ins Bett zu machen. Das einzige, was du bis jetzt gemacht hast, ist, dich weg zu wünschen, in ein diffuses Rausda ohne Ideen und Umrisse, geschweige denn Ziele, achja, und: das Essen einzustellen. Als hätte das je jemanden interessiert. Während du noch vor dich hin rottest, bin ich schon längst raus, ich bin in Berlin und arbeite als Autorin, und das ist gar nicht soo weit weg von deiner doofen Journalistin mit ihren preisgekrönten Etepetete-Freunden, und nein, die Ängste wachsen sich nicht raus, sie bleiben, und kosten einen Haufen Kraft und Zeit und limitieren dich dein fucking scheiß Leben lang und du musst gegen sie kämpfen, als wärst du selbst dein größter Gegner, und du warst, ehrlich gesagt, auch nicht gerade eine große Hilfe dabei, mal früher damit anzufangen, dich damit zu beschäftigen, und deiner ganzen scheiß Familie zu sagen, was du denkst, und was du brauchst, du feiges, kleines Opfermädchen.
Elli, 13, fängt an zu weinen.
Ich entschuldige mich. Ich weiß, du bist ein Kind, du tust, was du kannst. Nein, sagt sie, das ist es nicht. Ich tue zu wenig, das weiß ich schon. Aber…
Aber was? frage ich.
Hast du mich mitgenommen? fragt sie und schaut mich hoffnungsvoll an.
Wohin, frage ich.
Na, raus, sagt sie.
Klar, sage ich, und seufze. Klar hab ich dich mitgenommen.
Anders wärs ja nicht gegangen.
Februar 2020 – T30
Beim Therapeuten gewesen, (Halbzeit, eigentlich Stunde 31),
schon wieder Wut verspürt.
Februar 2020 – Miss Trust
Ich mag niemanden mehr anfassen und ich mag auch nicht mehr angefasst werden.
Februar 2020 – Therapie 2
Heute zum ersten Mal seine Hände registriert. Blöderweise eine Stunde lang verliebt gewesen. Beim nächsten Mal nicht mehr hingeguckt.
Februar 2020 – T29
Beim Therapeuten gewesen,
über meinen Körper gesprochen, den Feind, Saboteur und Spaßverderber.
Februar 2020 – Migräne
Ich behalte nichts bei mir, nicht einmal einen Schluck Wasser. Und es hört und hört nicht auf.
Februar 2020 – #Thüringen oder: Hallo Übermorgen
5.2., Dammbruch in Thüringen. Was für ein Buben-Coup.
Hab ich hier nicht sogar mal was über Mohring geschrieben, der im November 2019 niemanden mehr für verrückt erklären wollte, der mit der AfD paktieren will?
„Die Verfassung schreibt uns nur die Methoden vor, nicht aber das Ziel. Wir werden auf diesem verfassungsmäßigen Wege die ausschlaggebenden Mehrheiten in den gesetzgebenden Körperschaften zu erlangen versuchen, um in dem Augenblick, wo uns das gelingt, den Staat in die Form zu bringen, die unseren Ideen entspricht.“ Berühmte Persönlichkeit, 1930

Februar 2020 – Notiz
Mein Arm tut weh. Ich fühl mich schwach.
Januar 2020 – T28
Beim Therapeuten gewesen,
verzweifelt geweint.
Januar 2020 – DSGVO
Ich weiß nicht, hat`s das jetzt gebracht? Auf jeder Website sage ich jetzt:
einverstanden,
einverstanden Datenabgabe, einverstanden Kapitalismus, einverstanden Bullshit,
einverstanden, dass mir transparent vor Augen geführt wird, dass und wie ich und der Kapitalismus zusammen arbeiten, einverstanden, dass es jetzt dank DSGVO ein richtiges Leben im falschen gibt, einverstanden, dass ich selber schuld bin, wenn ich mir das falsche nicht DURCHLESE, sondern einfach auf okay klicke.
Einverstanden Verarsche war gestern, einverstanden Selbstverarsche ist heute, das ist, ich meine das ohne jede Ironie, denn so sind die Verhältnisse, ein hart erkämpfter Fortschritt, der uns zu mündigeren Bürgern macht.
Januar 2020 – 11 Minuten
Immer wieder an der Tram-Haltestelle,
starre ich sie an,
die Parship-Klone,
schön und groß und schlank, mit überirdischen Haaren, Bärten, Brüsten, Zähnen aus der Parallelwelt hinter Glas, die sich im Live-Photo-Modus Haarsträhnen hinters Ohr streichen oder von unten nach oben lächeln, Blickkontakt – aufnehmen, halten, wegsenken – , Flirten als Tutorial und in Zeitlupe, die ticking clock hat Parship auch mit eingebaut, alle 11 Minuten, alle 11 Minuten muss sich verliebt werden, 11 Minuten und schon wieder einer weg, 11 Minuten oder du verpasst was, 11 Minuten oder es setzt was, 11 Minuten, 11 Minuten, 11 Minuten.
Hey BVG, bitte mal Taktfrequenz erhöhen.
Januar 2020 – T27
Beim Therapeuten gewesen,
über Freundschaft gesprochen und die Frage, ob, wann und wie man sie beenden muss.
Januar 2020 – T26
Beim Therapeuten gewesen,
er will irgendwas, ich glaube, dass ich stolz bin, bin ich das nicht?
Januar 2020 – Therapie 1
Zum ersten Mal kann ich mir vorstellen, einem Therapeuten das Geschenk zu machen, so etwas wie gesund zu werden.
Januar 2020 – T25
Beim Therapeuten gewesen,
ihn sprechen lassen, ganz ruhig geworden.
Januar 2020 – Druck
Druck und Arbeit Arbeit und Druck Geld und Druck und Gelddruck und kein Geld kein Druck und ohne Arbeit kein Geld und keine Arbeit gegen Geld und für Druck und Arbeit und Selbstverwirklichung und Arbeit für Selbstverwirklichung und Druck zur Selbstverwirklichung und Geld für Selbstverwirklichung. Oder dagegen. Druck um Druck, kommt von drücken.
Januar 2020 – T24
Beim Therapeuten gewesen,
über den kaputten Arm gesprochen und was jetzt zu tun ist.
Dezember 2019 – Notaufnahme
Ein junger Mann hat einen tiefen Schnitt im Finger. Die Verletzung muss gespült werden. Der junge Pfleger fragt seine ältere Kollegin, ob das jetzt schon angesagt ist, da ist ja noch so viel Blut drin. Obwohl ich nichts sehe, hinter dem grünen Vorhang, wird mir schlecht.
Später eine Frau, ich höre nur ihre Stimme, offensichtlich sifft ihre Wunde, immer wieder muss irgendein Beutel gewechselt werden, damit die ganze Suppe ablaufen kann. Wie kann man das alles jeden Tag aushalten?
Drei Feuerwehrleute und drei Polizisten bringen einen der üblichen Pappenheimer. Ein Mann, der sich am Rollator festhält, betrunken, hat herumkrakeelt. Die Polizisten geduldig, sie dürfen zuerst gehen. Eine Ärztin kommt, holt den Mann in ein Sprechzimmer. Hinter der Tür höre ich ihn laut schimpfen, aggressiv, es geht um Alkohol. Ich mache mir Sorgen um die Ärztin, was, wenn er sie angreift. Ein anderer Mann, später, wird von der Schwester angesprochen die seine Vitalparameter messen soll: Haben sie Alkohol getrunken? Jawoll! brüllt er sie an als wär sie sein Oberleutnant.
Die Assistenzärztin untersucht mich, holt später vorsichtshalber noch eine erfahrenere Kollegin dazu. Die lässt sie nicht zu Wort kommen. Eine dynamisch resolute Krankenschwester taucht auf, mischt dynamisch resolut das Zimmer auf, sie erinnert mich an J, sie ist lieb, zugewandt, aber ein Bully, die Assistenzärztin hats schon wieder schwer.
Ein Assistenzarzt kommt herein, reißt den grünen Schamvorhang beiseite, greift das Gerät neben meinem Bett: Ich brauch das! Und: Habt ihr hier mal Platz? Er meint mich. Er rollt mit dem Rad des Gerätes über dessen dickes Kabel, es scheppert. Als der junge Pfleger von nebenan sagt, ich mache noch diese Naht hier, sagt der Assistenzarzt, ich mach dir keine Naht, ich bin Chirurg. Nein nein, stell der Pfleger richtig, ich meine, ich mache noch diese Naht hier, dann wird der Platz frei, der Chirurg ist schon zur Tür raus.
Die Assistenzärztin sucht in Schubladen, moniert, das nichts an seinem Platz ist, keine Pinzette, keine Schere. Die resolute Krankenschwester: Jetzt mach mal keinen Stress, unterbricht den Gips, den sie mir anlegt, holt eine sterile Kiste aus dem Schrank, öffnet sie und hält der Assistenzärztin das Besteck entgegen, Gesichtsausdruck: Damit du aufhörst zu quengeln.
Eine junge Frau kommt mit ihrem Freund, sie hat seit Stunden Nasenbluten, es hört einfach nicht auf, sie ist in Panik, wär ich auch, als fließe einem das Gehirn raus. Eine andere Frau hat schlimmen Husten, es hört sich nach Lungenentzündung an, ist nur meine bescheidene Meinung als Laie, ich habe Angst mich anzustecken. Eine ältere Frau mit Tüten. Im Urban wollte sie nicht bleiben, jetzt ist sie hier, sie schläft auf dem Stuhl, es sieht aus als wäre sie deswegen gekommen, um zu schlafen.
Wie unterschiedlich die Menschen sind, wenn sie leiden, viele von ihnen unerträglich. Wie sie ihre unbescheidenen Signale senden. Oder so tun als wäre gar nichts. Oder anfangen zu heulen, so wie ich, wenn man ihnen sagt, dass der Arm laut Radiologie gebrochen ist und dann so etwas Lächerliches sagen wie: Das ist eine Katastrophe. Das bedeutet ich kann nicht arbeiten.
Eine Frau Anfang 70, im Rollstuhl, ich halte sie für eine Alkoholikerin, eventuell crazy. Später erfahre ich, sie ist Diabetikerin, ihr Wert liegt bei 40, totaler Unterzucker. Sie sieht meinen Gipsarm, fragt: was haben Sie denn gemacht? Ich erzähle es ihr, sie: ach, wissen Sie, der Sänger von T-Rex ist auf einem Kirschkern ausgerutscht und war sofort tot.
6 Stunden später komme ich raus. Als erstes gehe ich einkaufen. Morgen ist Silvester. Und es gibt verdammt nochmal Toast Hawai wie geplant, kapiert?! Mit meinem Gipsarm an der Kasse bei Rewe, einarmig räume ich die Sachen ein. Ich zur Kassiererin, weils so lange dauert: Hab mir pünktlich zum neuen Jahr den Arm gebrochen. Kassiererin: Na passt doch.
Ach, Berlin.
Frohes, neues
Dezember 2019 – auf die Fresse
Zum Abschluss des Jahres fall ich auf die Fresse.
Unter Strom laufe ich einen Weg entlang, in meinem Kopf die üblichen Kämpfe, gerade hat ein Freund mir noch gesagt, dass er wegzieht, sofortige Erhöhung der Instabilität, ich bleibe mit der Schuhspitze in einem Vorsprung auf dem Gehweg hängen, und stürze nach vorne um wie ein Baum.
In meinem Mund ist Dreck, der Knochen über dem rechten Auge ist als erstes aufgeprallt, mein Kiefer fühlt sich verschoben an, der Arm tut weh. Das erste was ich denke ist: Jetzt kann ich nicht mehr schreiben.
Der junge Mann, der stehen geblieben ist, und zu dem ich jetzt hochschaue, sieht aus wie ein Engel. Did you faint or did you trip? fragt er. Es könnte ein meet cute sein, aber er schaut auf mich herab, wie auf eine alte Frau. Unangenehm berührt.
Ich beruhige ihn weg, setze mich auf eine Bank, und breche in Tränen aus. Ich bin mir sicher, dass Jemand, das Universum, Gott, T., meine Psyche, mein KörpermeinFeind, mich von hinten zu Fall gebracht hat, mit einem machtvollen kleinen Schnips aus Daumen und Mittelfinger dafür gesorgt hat, dass alles, was ich in diesem Jahr aufgebaut und worum ich gekämpft habe, und alles, was ich fürs nächste Jahr geplant und geschmiedet und worauf ich mich offen und ehrlich gefreut habe, nicht funktionieren wird. Bzw nur mit noch viel mehr Kämpfen. Und viel weniger Freude. Alle Pläne stehen in Frage, purzeln zeitlich hintereinander weg wie Dominosteine, sind der knirschende Dreck zwischen meinen Zähnen, der höhnische Schmerz in meinem Gesicht, die lapidare Untauglichkeit meines Armes.
Ich bin durcheinander.
Dezember 2019 – T23
Beim Therapeuten gewesen,
an den zwei Seiten vom Tau gezogen, er: positiv, ich: negativ.
Dezember 2019 – Das Jahr
Das Jahr
ist zu Ende.
Was soll ich sagen.
Ich habs überlebt.
Dezember 2019 – T22
Beim Therapeuten gewesen,
mich verteidigt.
Dezember 2019 – T21
Beim Therapeuten gewesen,
Lust gekriegt, ihn zu killen.
Dezember 2019 – Der Schwan
Ich muss gerade dauernd an den kleinen Schwan denken, der vor ein paar Jahren mal zum Meme geworden ist, weil er einen Sommer lang diesem riesigen Holzboot-Schwan hinterher geschwommen ist. Das ist Darwin in Reinstform. Dieser kleine Schwan tut das, was alle Schwäne tun müssen, um zu überleben, er „prägt sich auf“ etwas, er geht eine Verbindung ein, und weil der echte und eigentliche Schwan nicht da ist, weil er gestorben ist oder den kleinen Schwan aus sonstigen Gründen verlassen hat, nimmt der kleine Schwan, um zu überleben, eben den Holzschwan,
der ihn nicht füttern, nicht unter seine Fittiche nehmen, ihm nicht beibringen wird, wie man schwimmt,
aber das wird der kleine Schwan akzeptieren, und nicht nur akzeptieren, er wird den Holzschwan mithilfe seiner implementierten Bereitschaft zur Projektion, für den echten und eigentlichen und vollkommenen Schwan halten, weil er gar nicht anders kann,
weil er getrieben ist von seinem Lebenswillen, seinem Überlebenswillen, der irgendwo in ihm sitzt und pumpt, und ihn dazu bringt, Dinge zu tun, von denen er denkt, dass er sie tun will, dabei will es nur dieser pumpende Impuls in ihm, den sich keiner, der auf dieser Erde lebt, erklären kann, der aber unter allen Umständen versucht, sicher zu stellen, dass Leben gelebt wird, egal wie es dem Leben dabei geht oder wie sehr es sich quält.
So rührend der kleine Schwan ist, weil er versucht, das Beste aus der Situation, aus seiner Verlassenheit und der daraus resultierenden Lebensbedrohung zu machen, weil er eine unbändige, für so einen kleinen Schwan geradezu heroische Kraft entwickelt, sich das zu suchen, was er braucht, ist und bleibt der kleine Schwan ein Idiot. Bereit, sich selbst hinters Licht zu führen, für den pumpenden Impuls in sich, von dem er denkt, das sei er, geleitet von der inneren Idee, die dieser Impuls mit sich bringt, es könne sich lohnen.
Man kann jetzt auch sagen, was macht es denn für einen Unterschied, solange der Holzschwan seinen Zweck erfüllt. Was interessiert es die Liebe, ob sie erwidert wird, solange der der liebt, daran glaubt. Ich bin auch absolut sicher, dass er überlebt hat, der clevere kleine Idioten-Schwan, z.B. weil andere Lebewesen ihn gefüttert haben, denn auch das hat er ja geschafft, dafür zu sorgen, dass man ihn rührend fand, und Anteil genommen hat, an seinem Schicksal, ihm geholfen hat, mit dem Nötigsten. Ich bin mir aber auch sicher, dass er sein Leben lang tief in sich drin wusste, dass da ganz am Anfang was faul war, dass irgendwas nicht gestimmt hat, und deshalb niemals stimmen wird, dass er einem Missverständnis auferlegen ist, einem Betrug und Selbstbetrug, und bestimmt hat der kleine Schwan in seinem Leben alles gemacht, was ein Schwan so macht, einen anderen Schwan finden, Kinder kriegen, rumdümpeln, aber genauso sicher bin ich mir, dass er dabei
niemals
wirklich
ganz
war.
Bleibt die Frage, wie es dem Holzschwan eigentlich mit all dem ergangen ist.
Dezember 2019 – Weimar
Goethe, Schiller, Weimarer Verfassung, Bauhaus, Buchenwald – hier ist alles auf einem Haufen was deutsch ist. Dichter und Denker auf jedem Straßenschild, Anna Amalia-Bibliothek allüberall. Hier kann keiner behaupten, er weiß von nix. Rechts gewählt wird hier bei vollem Bewusstsein.
Dezember 2019 – Die neue Volksdroge
Wenn ich noch einen Artikel über Einsamkeit lese, kotze ich.
Dezember 2019 – T20
Beim Therapeuten gewesen,
über Sex und Dating gesprochen, uff. Das hat Überwindung gekostet.
Dezember 2019 – Scham
Seltsam.
Das Gefühl der Scham,
das auftaucht,
wenn ich etwas bekomme,
das ich
haben wollte
und worum ich
gekämpft habe.
Die Tränen, die das Gefühl begleiten,
verweisen auf einen frühen Ursprungsort,
eine alte Ausgrabungsstätte.
Dezember 2019 – Schwimmbad
Kein leichter Tag.
Ich halte dagegen,
setze noch einen drauf,
und gehe in ein Schwimmbad,
das ich nicht kenne.
Als die Wellen losgehen,
sehe ich,
am Beckenrand sitzend zu,
wie ihr alle
da drin seid, mittendrin,
und ich
verschwinde,
ohne zu gehen.
Gerade noch,
war ich da,
doch jetzt bin ich weg,
ich,
diese schmale Frau,
in ihrem schwarzen Badeanzug
so unsichtbar
dass kein Blick
sie retten kann
nicht der von innen
nicht der von außen
weg
wie ein Geist,
der nach den Gesetzen der Geister
nicht zu sehen ist,
auf der Fotografie.
Nicht aufgehoben
in der Zeit
nicht eingefangen
im Moment
und deshalb
möglichweise
nie gewesen.
Dezember 2019 – T19
Beim Therapeuten gewesen,
über die zufällige Begegnung mit T. gesprochen, meine daraufhin abgefeuerte Mail, das Ereignis seiner Antwort, und das Gefühl, jetzt endlich anfangen zu können, zu arbeiten.
Dezember 2019 – Luft
Ich treffe dich zufällig, du tust
als wäre ich Luft.
Einmal mehr schiebst du mich ins Unsichtbare, ins Nie-Dagewesene,
einmal mehr, lässt du mich verschwinden, löschst mich aus.
Man könnte auch sagen: Behandelst mich wie Dreck.
Die Reaktionen meiner Umgebung spiegeln das PingPong wieder, das seit Monaten in mir tobt:
wie sollst du da loslassen, das ist kein Abschied, das reißt doch nur immer wieder auf, wie kann er das machen, er lässt dich nicht raus.
Vergiss den, von dem ist nichts mehr zu erwarten, wozu brauchst du den, lass das hinter dir, geh weg da, geh weiter, das ist nur Quälerei.
Mir reichts. Ich überschreite die von dir gezogene Grenze, ich übertrete die von dir aufgestellten Regeln und Gesetze
und schreibe dir.
Mache mich bemerkbar.
Ob das wirklich das ist, was du willst. So tun, als wären wir Fremde, die sich noch nie in ihrem Leben gesehen haben, die nicht Tische geteilt haben und Betten, die sich nichts zu sagen hatten, jeden Tag, die nicht wichtig füreinander waren, die nicht eine Beziehung geführt haben, für die man dankbar sein kann, weil sie bei einem war, einen begleitet hat, und man es geschafft hat, immer wieder, sie zu behandeln, wie ein scheues, seltenes Exemplar, dem man, nachdem es sich entschlossen hat, einen zu verlassen, doch nichts entgegen bringen kann als Respekt und Wertschätzung und eine zumindest innere Haltung der Freundschaft.
Du antwortest.
Ich werde ruhig.
Endlich.
Und zum ersten Mal bist du mir so fremd, wie du es unbedingt sein wolltest.
Mein Herzschlag entfernt sich von dir.
November 2019 – T18
Beim Therapeuten gewesen,
über U. gesprochen und ihre Nacht am Bett meiner Kindheit.
November 2019 – Ich hätte
Ich hätte manchmal
einfach gerne gewusst,
was du fühlst.
November 2019 – T17
Beim Therapeuten gewesen,
über das Gefühl von Befriedung gesprochen, das sich bei der Relektüre einer Mail von T. einstellt.
November 2019 – U.
Ich bin nicht allein mit dir, ich bin nicht bei dir, du erreichst mich nicht,
ich sitze zu weit hinten.
Und es gibt Menschen, um die ich mich kümmern, die ich im Auge behalten muss.
Im Sarg liegt jemand, jemand, der du gewesen bist, ein Bild von dir daneben, wie zur Erläuterung.
Das Lied, das du uns am Ende mit auf den Weg gibst, ist ein Abschiedslied, von jemandem, der geht, und den Zurückbleibenden wünscht, sie mögen beschützt und getröstet sein.
Als alle raus sind, aus der Kirche, durch deren Fenster an diesem Novembertag das Licht fällt, wie in einem der von dir so gemochten Chagall-Bilder, setze ich mich noch einmal in eine der Bänke, um endlich bei dir zu sein, Kontakt aufzunehmen zu dir. Ich bin dir dankbar. Ich habe von dir gelernt. Du wirst mir einfallen. Ich werde dich befragen.
Neben mir bei der Trauerfeier ein jüngerer Mann, der weint. Vielleicht einer deiner ehemaligen Studenten? Wie viele Menschen hier allein sind mit ihrer Trauer um dich, ohne dass jemand gewusst hat, dass es sie gibt. Das ist seltsam und schön. Als gäbe es da draußen weitere Kinder von dir.
November 2019 – Friedrichstadtpalast
Wie sehr er mir gleich aus der Seele spricht, Fabian Hinrichs, der lange Schlaks im goldenen Anzug, denn in was sonst sollte man durchs Leben gehen, wenn nicht in einem GOLDENEN! ANZUG!, durch diese One-Man-Show mit Revue-Charakter, die Leben heißt, in der der One Man flankiert wird von den anderen, den Tänzern, die um ihn sind, ihm zuhören, chorisch auf ihn reagieren, freundliche Gesellen, die höchstens mit einem Doch! widersprechen, wenn man Nein! sagt, das gute, alte Kinderspiel.
Hier geht es um nichts weiter als um die Einsamkeit im Kapitalismus, um eine Welt in der es kein Zuhause gibt und geben kann. Und einsam sind alle, woran man das merkt? Beim Netto steckt man den Leuten in der Schlange an der Kasse seine Telefonnummer zu, und ALLE! ALLE! rufen an.
Die Biographie schon: Eine Erzählung von Gewalt, diesem Gegenteil von Zuhause, dem man nicht entkommt, außer man begeht Selbstmord.
Alle suchen, suchen weiter, suchen ein Zuhause. Suchen im Eskapismus (denn gegen den sind nur GEFÄNGNISWÄRTER), der Droge, dem Feiern, der Stadt. Doch es GELINGT nicht.
Suchen unter der Brücke, unter der wir schlafen. Und die sie uns dann auch noch nehmen.
Suchen, natürlich, in der Liebe:
Ich will
mit dir zu Decathlon gehen,
ein Zelt kaufen.
Da ist er, der ganze, gegen die Wand geschriene, ins Universum trotzig hinaus geschleuderte, leuchtende Text, und der Schauspieler, der diesen Text abarbeitet mit seinem Körper, ihn durcharbeitet, mit seinem Schweiß, im Gegenpol zu seiner eigenen Empfindlichkeit, im Modus eines inneren Tatsachenberichts, bis er fix und fertig ist, am Ende, der Körper und der Text.
Ein Stück wie ein Tocotronic-Song. Die Bühne hat Tiefe und Breite und kann durchschritten werden.
Am Ende der Pop-Song, der schon immer so viel mehr zu sagen hatte als tausend Worte, die Weisheit des Populären. All by myself schwebt der Goldene Anzug Bowie-Style durchs All. Mit sich selbst und um sich selbst und auf sich selbst bezogen und geworfen zugleich,
dank des Bühnen-Equipments.
November 2019 – Guten Morgen
Meldung eins: Trump steigt aus dem Klimaabkommen aus. Meldung zwei: CDU Landeschef Mohring will Verhandlungen über eine Koalition mit der AfD in Thüringen nicht ausschließen.
November 2019 – AfD Typ
Ein Foto aus der Zeitung nach der Wahl in Thüringen beschäftigt mich. Ein junger Mann ist darauf zu sehen, Anfang zwanzig, schätze ich. Hellblonde Haare, Undercut, die oberen, langen, akurat zurück gestrichen, ein Tribal Ohrring im Ohrläppchen, diese Dinger, die das Ohrloch ausweiten, dazu ein weißes Hemd, Anzug, eine blaue Krawatte und ein AfD-Abzeichen am Revers. Er jubelt auf einer Wahlveranstaltung der AfD in Thüringen, offensichtlich angesichts der Ergebnisse.
Es sind die Gleichzeitigkeiten, bzw. Uneindeutigkeiten, die mich wie immer irritieren, die die Einordnung erschweren oder unmöglich machen, nicht so
WIE FRÜHER.
Hier ist auf nichts mehr Verlass. Nicht auf die Jugend, nicht auf den Ohrring, nicht auf die Medienbrille, nicht auf den Undercut, nicht auf den Anzug, nicht auf die Krawatte. Die Dinge sind in einer Geschwindigkeit unlesbar geworden, dass das Rauschen in meinem Kopf Mühe hat, sich zu beruhigen. Hier geht, das lässt sich nicht mehr leugnen, eine REVOLUTION vor sich, an der ich mich nicht beteiligen möchte, würde, werde. Im Gegenteil. Wie meistens also, vor allem, Irritation über mich selbst. Ich dachte immer, wenn die Revolution kommt, mach ich mit.
November 2019 – T16
Beim Therapeuten gewesen,
über Freundschaft und Übelnehmen gesprochen, und den Punkt, den es zu verstehen gilt und der nicht verstanden wurde.
Oktober 2019 – Fick-mich- Stiefel
Ein Typ, Teil einer kleinen Horde Typen, ist unzufrieden mit dem Samstagabend-Angebot in Berlin: „Wasn das hier, kommt mal nach Potsdam!“ brüllt er. (Ich treffe am HKW auf sie, vielleicht liegts daran.) Ein anderer ruft: Ey, geile Fick-mich-Stiefel! Damit meint er meine geilen Fick-mich-Stiefel und ich finde, er hat absolut recht. Die hab ich jetzt seit Jahren, irgendwann mal Second-Hand gekauft, und wenn man die zusammen mit einem kurzen schwarzen Rock anzieht oder über einer engen Hose, sind das einfach sowas von geile Fick-mich-Stiefel, dass ich jedes Mal denke, ach, die sollte ich echt öfter mal anziehen, auch wenn sie tendenziell – wie die meisten geilen Fick-mich-Klamotten – unbequem sind, aber wenn du die anhast, dann kannst du sonst aussehen wie du willst, du hast eben einfach mal so richtig geile Fick-mich-Stiefel an. Und das Tolle an Fick-mich-Stiefeln ist ja,
dass sie gleichzeitig immer auch Fick-dich-Stiefel sind.
Oktober 2019 – T15
Beim Therapeuten gewesen –
Situationen sortiert, Tante B. grüßen Ja, zum Geburtstag gratulieren Nein?
Oktober 2019 – Wir sind das Volk 2
19 Tage nach dem Anschlag auf eine Synagoge in Halle wählen fast 24 Prozent der Thüringer die AfD unter Spitzenkandidat Björn Höcke.
Oktober 2019 – T14
Beim Therapeuten gewesen,
T. in einen Tresor gesperrt.
Oktober 2019 – Wahnsinn und Methode
Aus meinem Kopf kommen kleine Figuren, die fangen an zu laufen und zu sprechen und bauen sich eine Welt. Es ist herrlich. Und eine große Quälerei. Die einen nennen es schreiben, die anderen müssen dafür in die Psychiatrie.
Oktober 2019 – Wir sind das Volk 1
Attentat auf Synagoge und Döner-Imbiss in Halle. Alle heben vornehmlich darauf ab, dass sich der Täter den Feiertag Yom Kippur ausgesucht hat, um möglichst viele Tote zu produzieren. Es war aber auch der Jubiläumstag zu 30 Jahren Beginn der Friedlichen Revolution.
September 2019 – T13
Beim Therapeuten gewesen,
über die Lücke gesprochen.
Jetzt ist er erstmal in Urlaub.
September 2019 – Eis
Ich bin nackt auf einer Eisfläche. Ich versuche zu laufen, aber ich rutsche aus, ich schliddere bei jedem Schritt, ich krieche auf allen Vieren, ich komme nicht voran. Irgendwo rundherum am Horizont hört die Fläche auf, da ist schon was, da sind andere, das weiß ich. Aber ich komme nicht hin. Das Problem ist, wenn ich zu lange stehe oder sitze, dann bringt meine Wärme das Eis zum Schmelzen und ich drohe, im eiskalten Wasser zu ertrinken.
September 2019 – Geister
Heute will ich nicht mehr.
Ich will nichts mehr wollen. Das ewige Wollen, es führt zu nichts,
außer zu Geistern.
Niemand kann etwas dafür. Niemand hat etwas falsch gemacht. Nur ich.
Ich habs nicht geschafft, ich habs nicht hingekriegt, und es wird Zeit, das zu akzeptieren. Es gelingt mir nicht, aus dem was ich habe, etwas zu machen, was mich trösten könnte oder befrieden. Es ist einfach zu viel und ich bin zu falsch. Die Therapeuten in ihren Sesseln, die Psychiater hinter ihren Tischen, ungerührt. Mit ihren Zetteln und Blicken und Fragen, und ihren Medikamenten, die nicht mal schön sind. Ich schäme mich nur vor ihnen. Denn mir ist ja nicht mal was Schlimmes passiert.
Ich kann dieses Kind nicht überwinden, das Kind mit der Lücke. Ich kann ihm nichts geben, seine Lücke nicht füllen. Keinen Zucker, keine Suppe, kein Balsam.
Ich kann nur überleben, nicht leben.
Und ich kann ja nicht immer am Meer sein.
Als ich in den Kalender schaue ist der 23.
September 2019 – T12
Beim Therapeuten gewesen,
über die Kluft gesprochen zwischen innen und außen.
September 2019 – rumcoolen
In einer Bar belausche ich ein erstes Date am Nachbartisch. Er erzählt ein bisschen von sich, macht auf, erklärt, dass er dazu neigt, in Beziehungen so ein bisschen distanziert zu sein, sich gerne ein bisschen rar zu machen, so zu tun, als wärs ihm nicht wichtig. Ah, sagt sie, so rumcoolen, meinst du. Er lacht. Ja, genau: Rumcoolen.
Ich finds genauso super wie er. Rumcoolen. Tolles Wort. Danke. Das benutz ich jetzt auch.
Ich coole nicht rum. Kann ich mir nicht leisten. Wenn ich rumcoole, ruft gar keiner mehr an.
September 2019 – am Meer
Da an der Strandmauer lehnt eine Frau und schaut aufs Meer. Sie trägt einen Bikini. Und eine Sonnenbrille. Ich weiß nicht, wer das ist. Nur ihr Bikini kommt mir bekannt vor. Möglicherweise habe ich denselben.
September 2019 – Palermo im September – solo
Der alte italienische Mann in Palermo.
B. erklärt ihm, dass N. ihr marito sei. Und sie?, fragt er, und deutet auf mich, wer ist sie? A friend, antworte ich, amica. Ah, sagt er, solo, und klopft mir auf die Schulter. Klopft mir auf die Schulter, in dieser Mischung aus Mitleid, Verachtung und schlicht Beleidigung, die unter alten Leuten sehr verbreitet ist, für die das Wichtigste ist, dass man jemanden abgekriegt hat, und zwar mit Trauring, egal, ob man diese Person lebenslang verarscht und betrogen hat oder von ihr verarscht und betrogen wurde,
ein Schulterklopfen, das aufmunternd, anerkennend, augenzwinkernd wäre bei einem Mann, der es solo richtig schön krachen lassen, um die Häuser ziehen kann, sich aber hier, in meinem Fall, nur noch runter reduzieren lässt auf: Kann man nichts machen, wir können nicht alle Glück haben, bist halt hässlich geraten und jetzt auch zu alt.
Was, wenn diese ekelhaften, niederträchtigen alten Leute einfach recht haben?
September 2019 – Palermo im September – Kapuziner
Palermo 3
Ich mag den Ort nicht, er soll mich erfassen, tut es aber nicht. Leichen hängen und liegen hier nebeneinander, in Regalen, auf Ständern, gut erhaltene Mumien, manche in Kleidung, andere kaum bedeckt, die Hände und Füße gekrümmt, die Schädel leer, die Augen hohl, die Haut wie Leder. Schmal sind sie, erstaunlich klein, ausgedörrt, manche von ihnen sehen nach Schmerz aus, als wäre das Sterben eine Pein gewesen. Ich spüre zu kaum jemandem Kontakt, eine junge Frau bleibt mir in Erinnerung, das Kleid einer älteren Frau, in dem sich ausdrückt, dass sie alles getan hat, um Gott zu gefallen. Die Besucherin neben mir nervt mich, die mit betroffenem Gesicht das Fotografieverbot umgeht, und das zweijährige Kind mit dem Smartphone ablichtet, das hier als die am besten erhaltene Mumie gilt. Betroffenheit als Gier. Das Kind sieht aus wie eine Puppe und liegt hinter Glas.
Die Menschen hier wollten nicht einfach verschwinden, von der Bildfläche der Welt und des Lebens, nur weil sie tot sind. Dafür haben sie Geld bezahlt. Sie wollten erhalten bleiben. Den Tod nicht alles bestimmen lassen. Das hat etwas Trotziges, Verzweifeltes, auch Eitles. Und etwas sehr Kirchliches. In der Reihe Profession sind Ärzte zu sehen, Anwälte, auch eine Reihe mit Mönchen gibt es, Bruder Soundso.
Wie war das Leben dieser Menschen, was hat es bestimmt, Härte, Repression, den Versuch ein guter Mensch zu sein im Sinne Gottes und der Kirche. Was wirst du deinem Herrgott sagen können, wenn du am Ende vor ihn trittst, warst du eine guter Mensch oder ein schlechter? Und wenn du schlecht warst, was hast du dafür getan, da rauszukommen, hast du dich schuldig bekannt, hast du gebeichtet, gebetet, gezahlt.
Wie anders das bei uns heute ist, wie anders die Frage, die wir uns stellen (und nicht uns der Herrgott). Hast du das gemacht was du wolltest, hast du es geschafft, ein glücklicher Mensch zu sein, hast du alles auf der Liste abgehakt, an Reisen und Büchern und Filmen und Sexpositionen, hast du alles erreicht, was du vom Leben haben wolltest und was du in der Welt sein wolltest? Wenn das geklappt hat, dann bist du irgendwie auch sowas wie ein guter Mensch.
September 2019 – Palermo im September – Der alte Mann und das Meer
Palermo 2
Am Strand in Cefalu beobachte ich einen alten Mann. Er ist erstaunlich rüstig für sein Alter, ich schätze ihn auf über achtzig. Die weißen Haare liegen kurz geschnitten wie ein Kranz um seinen kahlen Oberkopf, er hat ein angenehmes, hübsches Gesicht mit einem Ausdruck entspannter Freundlichkeit. Er ist schlank, auch am Bauch, nur die Haut ist weich, und hängt dort, und auch sonst, an Armen und Beinen und überall ein bisschen. Auf seinen Knochen hat er noch einiges an Muskulatur. Zuerst denke ich, er ist allein hier. Er kommt aus dem Wasser und setzt sich in den Sand, schiebt ihn mit beiden Händen unter sich, wie zur Erhöhung seiner Sitzknochen. Er betrachtet die Badenden. Schiebt Sand. Betrachtet. Wie alle hier am Meer in dieser sich seltsam ausbalancierenden Mischung aus Beisichsein und Wahrnehmung der Umgebung, als würde das Meer seinen Rhythmus übertragen, außen, innen, innen, außen. Zuerst denke ich, er ist alleine. Dann kommt sein Sohn kommt aus dem Wasser. Vielleicht Anfang vierzig, Haare. Sie sitzen nebeneinander, aber doch jeder für sich, der Sohn auf seinem Handtuch, der Vater im Sand. Sie sprechen kaum. Sie sind sich auch so nah. Sie haben ihre Routine. Abwechselnd gehen sie ins Wasser, schwimmen geradeaus. Am Strand macht der Vater Armkreisen, der Sohn wie zur Antwort auch. Es geht darum, sich fit zu halten. Gesund zu bleiben. Um sich und das Leben noch möglichst lange haben.
(Ich muss an das berühmte Bild von Ben Gurion denken, der am Strand von Tel Aviv einen Kopfstand macht. Er hatte mit Hilfe von Moshe Feldenkrais seine Rückenprobleme überwunden.)
Einmal, als der alte Mann im Sand sitzt und den Sohn zwischen den Badenden im Wasser entdeckt, winkt er ihm. Der junge Mann winkt zurück. Dabei sind sie so voller Freude übereinander und über das, was sie teilen. Das haben sie bestimmt schon immer so gemacht, schon als der Sohn noch ein Kind war.
Am Ende machen sie ein Spiel. Sie stehen, die Füße fest im Sand, einander gegenüber, und versuchen sich gegenseitig aus der Position wegzudrücken. Mit dem ganzen Körper gilt es, die Balance zu halten, den drückenden Händen des anderen auszuweichen, und die Füße nicht zu bewegen. Sie lachen, der Sohn deutet auf den Fuß des Vaters, der sich doch ein bisschen bewegt hat, beschuldigt ihn des Tricksens. Wieder sprechen sie kaum.
Ich habe lange nichts so Zärtliches gesehen wie die beiden.
September 2019 – Palermo im September – La ragazza con il pallone
Palermo 1
Ich sehe das Bild zuerst aus der Ferne. Schon auf den ersten Blick macht es einen dunklen und leuchtenden Eindruck zugleich, einen Eindruck der harten Kontraste. Eine schwarz weiß Fotografie, nicht nur der Technik wegen. Ein Kind, ein Mädchen, vielleicht 11 oder 12 Jahre alt. Sie lehnt an einer dunklen Hauswand, oder ist es eine Tür? Unter ihrem Arm trägt sie einen Fußball, ihr Kleid ist weiß und leicht. Den anderen Arm hat sie über den Kopf gehoben und an der Wand abgelegt. Eine Pose, die ihre Achsel freigibt, die Hüfte macht einen leichten Knick. Das dicke, schwarze Haar liegt in einem Rundschnitt um ihr Gesicht, der Pony ist hoch über die dunklen Augen geschnitten. Sofort fliegt dem Bild mein Herz zu. Ich finde den Kontrast zwischen dem männlichen Fußball (die Szenerie verweist auf die Siebzigerjahre) und der mädchenhaften Pose im Kleid genial. Sogar etwas Witziges kann ich darin entdecken.
Als ich näher trete, verändert sich das Bild. Im Gesicht des Mädchens liegt so viel Schmerz, dass ich erschrecke. Trauer, auch ein leiser Unmut, ein Unwille sind zugegen. In der eingenommenen Haltung liegt plötzlich etwas – zu? – Frauliches. Ist es die Pose eines Models, die das Mädchen in den Zeitschriften gesehen hat und die sie imitiert? Die Pose einer Prostituierten? Das Bild bekommt einen Schrecken. Etwas spielt sich in ihm ab, zu dem das Mädchen einen Zugang hat, aber nicht wir. In der linken Hand hält sie, nur vom Daumen gehalten, ein zusammengefaltetes Stück Papier, das ich als Geldschein identifiziere. Wer hat ihn ihr gegeben? Die Mutter, der Vater, ein Freier, die Fotografin? Hat sie ihr gesagt, sie soll sich dort hinstellen?
Später finde ich in einem Fotobuch zwei weitere, diesem Bild nachgestellte Fotografien des Mädchens. Sie spielt den Ball mit den Händen an die Wand, lacht, ein anderes Mädchen ist zugegen. Diese Fotos haben nichts als das Spiel des Kindes an einem Sommernachmittag in sich, man meint, die Wärme der Sonne zu spüren, die Straßengeräusche zu hören.
In dem Buch schildert die Fotografin Laetizia Battaglia, wie sie im Straßencafe saß und das Mädchen sah. Sie stand genau so da, sagt sie sinngemäß, an dieser Wand, und ich hatte alles in allem vielleicht sieben Sekunden.
September 2019 – Palermo im September – die nette alte Frau
Neben mir im Flieger sitzt ein Mexikaner, ich hätte Lust mit ihm zu schlafen. Er ist dick und trägt seinen Haare in einem Undercut, darüber einen kurzen Zopf aus dichtem schwarzem Haar und einen Bart, seine Hände sind hübsch, ich mag die Form seiner Nägel, die dunkle Farbe seiner Haut. Ich würde ihn gerne küssen, trotz des Barts, er ist so weich, man kann sicher gut ihn ihm versinken. Er hört Musik mit riesigen Sony Kopfhörern, die er die ganze Zeit nicht abnimmt. Auf seinem Knie liegt das Buch eines bekannten, mexikanischen Autors. Auf Spanisch. Ich frage mich, wie das geht, mit ihm schlafen, mit seinem Bauch. Mir fällt so einiges ein. Ich kritzele in mein Notizbuch. Als ich aufs Klo muss, steht er auf und lässt mich raus, wir lächeln uns an. Oder eher ich ihn.
Ich sitze im Shuttle-Bus ins Stadtzentrum. Da taucht er plötzlich im Gang auf, sein Gepäck über der Schulter, Ach, hallo, sagt er, als er mich erkennt, in astreinem Deutsch, und läuft durch den Gang an mir vorbei. – Ein berliner Mexikaner, mexikanischer Berliner, logisch, das hätte ich mir ja denken können. Hoffentlich hat er nicht gelesen, was ich in mein Notizbuch gekritzelt habe. Nein, er hat die meiste Zeit geschlafen oder zumindest die Augen zu gehabt unter seiner Musik, und keine Ahnung gehabt, in was für einem Film er da nebenan mitspielt. Sollte ich ihn nochmal sehen, in den nächsten Tagen, dann spreche ich ihn an, nehme ich mir vor, das kann man dann doch machen, oder?, hey, sagen, ist ja witzig, ist jetzt das dritte Mal, dass wir uns sehen, jetzt müssen wir aber mal kurz reden, und was machst du so in Palermo, was hast du vor, willst du mitkommen, wir gehen da und da hin. Das geht doch, oder, das kann man doch machen. Wir werden ein Paar und dann fliegen wir nach Mexiko zu seiner Familie und ich verbessere mein Spanisch auf Hochformat und wir unterhalten uns über Schriftsteller und die politische Lage in Mexiko und haben wunderschönen, weichen Sex und erzählen uns, wie das war, als ich im Flieger neben ihm saß und da schon alles wusste.
Als er aussteigt, eine Station früher als ich, geht er grußlos an mir vorüber. Natürlich sehe ich ihn nie wieder. Stattdessen schäme ich mich. Ich drehe hier durch, mit meinen Jungmädchenfantasien, und er hat sich nur gedacht, ach, da ist ja wieder die nette alte Frau aus dem Flieger.
September 2019 – T11
Beim Therapeuten gewesen,
doof rumgejammert, solange bis er auch nicht mehr weiter weiß.
September 2019 – my bat
Nachts wache ich auf, oder bin noch wach, das ist schwer zu unterscheiden in den letzten Jahren. Der Rechner ist an, ich bin über einer meiner Netflix-Gutenacht-Geschichten eingeschlafen, wie eigentlich fast immer, das einzige was hilft, gegen die Angst. Ich fahre das blaue Licht herunter, kippe das zweite Fenster und krieche zurück ins Bett. Im Dunkeln warte ich auf meine innere Reaktion, die hoffentlich Schlaf sein wird. Plötzlich schrecke ich hoch, weil ich ein Geräusch höre, ich weiß sofort: ein Tier ist im Raum. Vor mir, über meinem Bett, bewegt es sich, ein Falter, nein, zu groß, zu kreisend – eine Fledermaus. Schemenhaft, kaum wahrnehmbar dreht sie ihre schnellen Runden unterhalb der Zimmerdecke, immer wieder, im gleichen Rhythmus, das ist nicht eine, das sind zwei, verdammte Scheiße, die Zimmerdecke ist nicht hoch, mein Bett aber schon, was mach ich bloß, die sind mir zu nah dran, ich dreh mich aus dem Bett raus, gehe mit eingezogenem Kopf zur Zimmertür, ich will nicht, dass sie sich in meinen Haaren verfangen, und betrachte von hier aus die beiden dunklen Schatten, die lautlos ihren Tanz aufführen, ängstlich wirken sie, aufgeregt, aber auch aufeinander bezogen, sie drehen sich wie ein absurdes Mobilé. Soll ich das Licht anknipsen, verwirrt sie das, quält es sie gar?, idiotischerweise habe ich Handy und Laptop neben meinem Bett liegen lassen, sonst könnte ich jetzt das Weltweite Netz befragen, flapflap, Fledermäuse im Zimmer, was tun, Schluss jetzt, ich brauche einen Überblick, muss ja auch an mich denken, Licht an: es bleibt dabei, zwei Fledermäuse, kreisend, ich schalte das Licht wieder aus. Ich muss das Fenster öffnen, sperrangelweit, dann finden sie bestimmt raus, aber ich kann da nicht rein, in das Zimmer. Mein Eindruck: sie werden müde, sie kreisen immer weiter unten, schon fast auf der Höhe meiner Schulter. Ich hole ein Handtuch aus dem Bad, lege es mir über den Kopf, flapflap, das sind sie noch immer, Ich trau mich nicht da rein, in den schwarzen Kreis, trotz Handtuch, so zwischen denen durch, das bringt sie womöglich komplett durcheinander, und es gibt Kollisionen, also vielleicht wenn ich bei ihnen das Licht anmache, und hier nebenan, im Wohnzimmer die Balkontür ganz weit auf und das Licht aus, es zieht sie doch ins Dunkle…?
Das mach ich und verzieh mich hinter die Tür um das Ganze zu beobachten, und es dauert ein bisschen, aber dann fliegt eine, die Größere, raus. Aber wo ist die andere? Nach einer Weile überprüfe ich mein Zimmer. Sieht aus, als wären sie beide weg. Ich schalte das Licht an, suche alles ab. Ich finde, es riecht nach Urin. Was wenn sie hier vor Angst oder einfach weil sie mussten, in mein Zimmer gepinkelt haben, auf mein Bett, was, wenn sie noch irgendwo hier sind, oder die eine, vielleicht haben sie ja auch gekackt. Ich finde nichts.
Im Internet kennt man das Phänomen: Im August und September verirren Fledermäuse sich gerne in Wohnungen, da reicht ein gekipptes Fenster. Gerade junge Fledermäuse auf der Suche nach Nistplätzen verwechseln die Wohnung mit einer Höhle oder die schmale Fensteröffnung mit einem Höhleneingang. Fenster weit aufmachen, damit sie rausfliegen können. Und die Wohnung absuchen, denn manchmal legen sie sich, wenn es hell wird, zum Schlafen in geöffnete Taschen oder Schubladen, Wenn man sie schlafend findet, soll man sie vorsichtig in einen Eimer oder so legen (Handschuhe an) und in der Dämmerung hinauslassen. Ich bin froh, dass ich niemanden anfassen musste.
Komisch, schon die zweite verwirrte Fledermaus-Episode dieses Jahr. Die Echo-Ortung ist auch nicht mehr das, was sie mal war, die wirken so aus dem Takt gebracht. Das liegt bestimmt an irgendwas Menschengemachtem. Seltsam auch die Vorstellung, dass sie die ganze Zeit ganz laut geschrien haben, und ich das nicht gehört habe. Mir kamen sie so besonders lautlos vor.
Inzwischen ist es fast hell. Ich ziehe um aufs Sofa, schließe alle Fenster, auch die gekippten und schlafe zwei Stunden.
September 2019 – Meckerfixierung 5
Wieso gibt es eigentlich bei Klamotten sowas wie Größe XS, S, M, L, XL, oder 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, you got my point, aber nicht bei Brillen?! Ist doch klar, dass Leute auch im Gesicht nicht alle die Durchschnittsgröße Riesengroß haben. Gerade im Bereich Sonnenbrillen nervt das kolossal, statt supercool sieht man aus wie eine Hummel im Blindflug. Manchmal wundert man sich schon über die Lahmarschigkeit des Kapitalismus.
September 2019 – blank page
1
Manchmal wünsche ich mir, dass wir uns jetzt kennen lernen. Dann versuche ich mir vor Augen zu führen, wie schwierig alles mit uns wäre. Aber das ist es doch immer. Ich wollte es eben immer lieber mit dir schwierig haben als mit irgendjemand anderem.
2
Manchmal wünsche ich mir, dass wir uns jetzt kennen lernen. Dann frage ich mich, ob wir uns überhaupt mögen würden. Ich stelle mir vor, wie irritiert ich von dir wäre, so wie ich es anfangs immer bin und auch von dir sehr lange war, und ich frage mich, was mich dazu bewegen würde, an dir dran zu bleiben. Wären wir überhaupt dieselben, wenn wir ohne einander gewesen wären? Sind wir beieinander gewesen, weil wir sein konnten, wie wir sind?
3
Manchmal wünsche ich mir, dass wir uns jetzt kennen lernen. Dass ich in den letzten zwanzig Jahren andere Lieben gehabt hätte, dass nichts von dem geschehen ist, was geschehen ist, dass wir uns jetzt begegnen und anziehend finden und aufregend, dass wir uns einander annähern und uns ausprobieren, dass wir uns füreinander erfinden und uns streiten und hassen und zur Rede stellen und in Frage, und zusammen in Urlaub fahren und die Welt erleben, in der wir heute denken und Meinungen haben, und diese miteinander teilen. Jemand anderes wird du sein, versichert man mir. Warum kann ich daran nicht glauben.
August 2019 – allein
Dabei war ich mal so gern allein. Allein hat mich immer so stolz gemacht. Guck mal da, eine Frau, die das ganz allein macht, wie unabhängig, wie selbstbewusst, wie modern: Ins Restaurant gehen, in die Bar, auf Reisen. Jetzt hat Alleinsein was Erbärmliches, es erzählt vom Scheitern, vom Altern, vom Unvermögen sozial zu sein, von der Unmöglichkeit, jemanden zu finden, der es mit einem aushält. Allein ist ein Makel, über den niemand schafft hinwegzusehen. Auch ich nicht bei anderen.
Es war die innere Verbindung, die es möglich gemacht, das Alleinsein als Unabhängigkeit zu erleben. Als Stärke. Eine stolze Krone war das.
August 2019 – Jungs anquatschen
Ich übe mich im Jungs anquatschen. Der eine fährt Kettcar, auf der Dorfstraße in Brandenburg. Ein ziemlich cooles Teil, wie ich finde. Das sag ich ihm auch. Er sagt, dass er es zum Schulanfang gekriegt hat (diese Bestechungsgelder heutzutage…). Er zeigt mir, wie er mit durchdrehenden Reifen fahren kann. Das geht so lala. Schon ganz gut, sage ich, da kannst du ja jetzt noch üben. Später sehe ich ihn nochmal, er fährt hinter seiner Mutter her. Er sagt mir freundlich Hallo und sie faucht ihn an, komm jetzt. Die blöde Kuh.
Der andere Junge sitzt mir im Außenbereich eines Cafés gegenüber, sein Vater hat ihn da kurz abgestellt, der holt sich einen Cappuccino. Der Junge hält eine Capri Sonne in der Hand wie einen Schatz. Er hat sie noch nicht geöffnet. Auf dem Cover ist eine Figur. Oh, sage ich, Capri Sonne, cool. Der Junge nickt. Und was ist da vorne drauf? Er braucht einen Moment, bis er versteht, was ich meine. Ein König, sagt er dann und zeigt mir die Figur. Toll, sage ich, wie du. Der König der Capri Sonne. Er nickt.
August 2019 – vollendete Gegenwart
Ich stehe auf dem Bahnsteig in der Provinz rum. Kommt ein junger Mann auf mich zu, ich schätze Asylbewerber aus irgendeinem Subsahara-Land. Ich habe sie gesehen, sagt er mit einem Akzent, den ich nicht einordnen kann, Sie sind sehr schön. Danke, sage ich, das ist sehr nett, aber ich habe einen Freund. Er nickt. Mein Herz hat geschlagen für Sie, sagt er, bevor er davon geht.
Ich könnte jetzt zynisch sein und sagen, was da geschlagen hat, das war ein anderes Körperteil, ich könnte sagen, sein routinierter, für deutsche Verhältnisse viel zu cheesiger Anmachspruch, ist heute schon dreimal mindestens wahllos an eine Frau herangetragen worden, mach ich aber nicht. Mein Herz hat geschlagen für Sie. Das nehm ich jetzt einfach mal so an, und erlaube mir, es für einen Moment schön und anrührend zu finden, und ihm hinterher zu schauen, über alle Unüberbrückbarkeit hinweg. Denn fasst es nicht gut zusammen, was passiert, wenn wir jemanden entdecken, der uns gefällt und bei dem klar ist, dass es schon vorbei ist, bevor es überhaupt angefangen hat.
August 2019 – Mittelschichtsangst
Kürzlich erzählt mir eine Freundin von einem Bekannten aus der ehemaligen-DDR. Er ist Mitte vierzig, lebt noch immer in der Nähe von dort wo er aufgewachsen ist und hat seit vielen Jahren einen festen Job mit Kranken-Urlaubs-Weihnachtsgeld und Sozialversicherungen bis zum Sanktnimmerleinstag, eine Frau, ein Haus, ein Auto, ein Kind. Das Kind ist ein Junge, vierzehn. Er ist nur so einigermaßen nett, nicht der Hellste, nicht der Schnellste, und sitzt, in all dem unwidersprochen von seinen beiden liebenden Eltern, antriebslos vor dem Computer. „Da findet der doch nie einen Job, wenn da jetzt auch noch die ganzen Asylanten kommen“, sagt der Bekannte.
Tja.
Kann ich da nur sagen. Das ist es also, wovon die Mittelschicht sich bedroht fühlt? Von ihrer eigenen Dummheit, Trägheit und Faulheit?
Da wird ja nochmal ganz anders nachvollziehbar, dass die Bundesregierung über Jahrzehnte hier geborene Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund im Duldungsstatus festgehalten hat, das war ja praktisch eine Maßnahme für die innere Sicherheit.
August 2019 – ok cupid
Ich melde mich bei ok cupid an. Innerhalb der nächsten 24 Stunden hört mein Handy nicht auf zu pingen, bei 99 Matches bleibt der Zähler stehen, setzt nur noch ein Pluszeichen dahinter. Ich bin der Renner! Is klar, ich hab ja auch kein Foto von mir, sondern von einem Stofftier mit Augen hochgeladen – da schlägt die Fantasie natürlich Purzelbäume. Oder schickt ok cupid regulär allen frisch Angemeldeten 99 matches, so als motivierende Dranbleiber-Grundeinstellung der App? Leider kann ich die Männer, mit denen ich matche, nicht liken, das geht nur, wenn ich ein Abo abschließe.
Also blättere ich mich durch die kostenlos verfügbaren Männer, durch den ganzen langen Katalog, ich swipe und swipe und swipe nach links, irgendwann fange ich an, Chips zu essen, und komme mir schon vor wie das überhebliche Arschloch, das ich bin, bis ich endlich einen Mann finde. Einen, bei dem ich ganz eventuell in Erwägung ziehen würde, nach rechts zu swipen. Statt zu swipen setze ich erstmal eine Bookmark. Man will ja nichts überstürzen.
Er sieht nett aus und wie jemand, mit dem man befreundet sein könnte. Aha, das ist also das innere Kriterium: Vor wem hab ich am wenigsten Angst.
In den nächsten Tagen schlafe ich in Gedanken dreimal mitdem Typ. Na also, läuft doch. Als ich zu ok cupid zurückkehre, um mich an den Rechts-Swipe zu wagen, ist die Bookmark weg. Ich suche und suche und fluche und finde sie nicht mehr. Wahrscheinlich ist der Typ inzwischen verheiratet. Na gut, man muss also auch schnell sein. Ich scrolle weiter. Männer, Männer, und nochmals Männer, ich seh den Wald vor lauter Männern nicht. Ach, guck mal: Ich entdecke jemanden, den ich von früher kenne. Der war doch ganz lange mit einer Frau zusammen, dann ist der jetzt wohl getrennt von der, ohje. Oder nicht getrennt von der, wer weiß das hier schon. Ich entdecke jemanden, bei dem so dermaßen klar war, dass der hier rumhängt, dass ich aufstöhne und die Augen verdrehe. Ich kann ihn nicht leiden. Wegen seiner zur Schau getragenen linksideologisch hochgejazzten Player-Einstellung zu Frauen und Beziehung. Dann entdecke ich noch jemanden, von dem ich weiß, dass er verheiratet ist, und dessen Frau im Leben nicht auf die Idee kommen würde, dass er sich hier rumtreibt, und wenn sie‘s wüsste, dann würde es ihr zuerst das Herz brechen und dann würde sie einen Rosenkrieg gegen ihn führen, der sich gewaschen hat. Na toll. Also Lug und Trug wohin man schaut. Geht es denn nie auch mal ohne?
Ich finde die Vorstellung, dass es andersum Leute gibt, die mich hier finden, einen Alptraum. Ach, guck mal an, die auch hier, achja, die ist ja jetzt von T. getrennt, ohje, wie sieht die denn aus. Wie ein Stofftier mit Augen.
Ich hab Angst, noch mehr Leute zu entdecken, die ich kenne und mach mal schnell die Seite zu.
Berlin ist halt ein Vögeldorf.
Am nächsten Tag ist ok cupid mir auf die Stofftier-Schliche gekommen, bzw. die eingebaute Kulanzphase für Fake-Fotos ist abgelaufen. Dabei dachte ich schon, ich hätte die Plattform ausgetrickst und so richtig cool gescoret beim Lieblingssport des modernen Menschen im digitalen Kapitalismus, der da ist: möglichst wenig Daten preisgeben, möglichst unterm Bezahl-Radar mitschwimmen, möglichst die Lücke im Algorhithmus finden. Vergiss es.
Je länger ich mich hier aufhalte, umso trauriger und hilfloser werde ich. Wie bloß soll ich je wieder jemanden kennen lernen, wie soll ich jemanden finden, den ich mag, wie soll ich je wieder Sex haben? Geht das denn wirklich nur so? Wie ging das denn früher? Und geht das jetzt nur noch so, weil das das jetzt das zuständige Tool dafür ist, auf das sich alle verständigt haben, und außerhalb dessen findet sowas nicht statt, brauchste Bücher gehste amazon, brauchste Musik, gehste Spotify, brauchste Beziehung, gehste ok cupid, und wenn du damit woanders hingehst, in einen nicht dafür vorgesehenen, zu diesem Zweck und für dieses Bedürfnis bereit gestellten und durchformalisierten Raum, dann hast du keine Ahnung oder bist irgendwie inappropriate, so, als würdest du neben die Schüssel pinkeln? Was hat die denn für ein Problem, weiß die nicht, dass man das über ne Datingplattform macht.
Ich schwanke zwischen Spiel mitspielen und System unterwandern, zwischen Wut auf den Kapitalismus, der noch in die letzten Poren unserer Leben dringt und psychologischen Selbstzerfleischungsanalysen meiner Angstpersönlichkeit. Dazu stehen oder eine Kunstaktion draus machen? Ich fühl mich albern, weil ich mich drumrum zu drücken versuche, mein Bedürfnis zu vertuschen, wenn ich mit FakeFoto, FakeName und FakeAlter so tue, als hätte ichs nicht nötig, bzw. alles voll gesellschaftlich durchschaut. Andererseits habe ich auch keine Lust, mich jetzt einfach mal locker zu machen, jetzt einfach mal ausnahmsweise nicht so ne Klemmschwester und Spaßbremse zu sein, und das jetzt einfach mal mitzumachen und nicht so ernst zu nehmen, obwohl ich merke, dass mich diese Datingplattformsache eigentlich nur bis in die Tiefe meiner Seele traurig macht.
Ok, stupid.
What to do?
Right swipe left swipe.
Es geht ja nicht nur darum, zu erleben, dass andere so mit einem verfahren. Es geht ja auch darum, zu erleben, dass man selbst mit anderen so verfährt. Als ich auf die Straße trete, habe ich sofort das Gefühl, das überträgt sich ins real life, wo der Jungs-Katalog analog zu besichtigen ist. Right swipe, left swipe. Doable, not doable. Fuckable, not fuckable. Boyfriend material, no boyfriend material.
Muss denn immer alles so brutal sein. Ich weiß, das Böse, oder wie ich es nenne, der Kapitalismus, ist immer und überall, aber muss denn noch jeder Bereich unseres Leben von dieser Sorte normalisierter Grausamkeit heimgesucht werden oder stell ich mich nur an, und das ist nur brutal ehrlich, so wie Dating eben ist, und brutal ehrlich ist was Gutes? Auf jemand stehen oder nicht auf jemand stehen ist immer brutal, aber das meine ich nicht, man fühlt sich hingezogen zu jemand oder angezogen von jemand, das ist so oder nicht, und wenn es ungleich verteilt ist, ist das eine der härtesten. Aber hier sind doch tausend andere Sachen am Werk. Wie zum Beispiel Marketing und Präsentation, das Profil muss sitzen, das Foto muss ansprechend sein, das Alter muss passen, der Text muss offen sein, Witz haben, von Selbstreflexion zeugen, die richtigen key words setzen, die SEOs des Dating-Partners sozusagen, man will ja niemand anlocken, bei dem es sich nicht lohnt, und niemand verschrecken für den es sich lohnt. Man will nicht überrascht werden. Man will nicht überraschen. Egal, ob man einen Stromanbieter sucht oder einen Fuck-buddy, man muss als selbstbewusster Kunde das Angebot vergleichen und den Algorithmus füttern, damit der seine Arbeit machen kann: Wenn Sie den angeklickt haben, dann könnte der Sie auch interessieren. Nein, ich behaupte, das war nicht im Grunde schon immer so. Wieso macht eigentlich keiner mehr Privatpartys. Ich bin Ende vierzig und fliege in einer ganz langsamen Zeitlupenkurve aus der Welt.
Ein paar Tage nach meiner Anmeldung erhalte ich folgende Spam-nachricht auf mein Handy: +4915157311602 Auch wenn unsere Meinungen gleich oder unterschiedlich sind.. ich finde du busted wert!! Ich kann warten und gib dir die Zeit und deswegen nochmal… ich hab vollstes Verständnis was dich und dein Liebesleben angeht und deswegen sag ich dir, ich hab dich wirklich gern, Elli! Es war auch sehr schön dich und deine Kommentare zu sehen! Hoffe du bist glücklich und ich hab dich wirklich gern, Herzchen-Smiley Bis baldAugust 2019 – Kalender
1 Ich finde einen Kalender. Von 2019. Er ist leer. Ich könnte dort das Leben einer Frau eintragen, Namen, Termine.
Was stünde darin?
2 Ich finde einen Kalender. Von 2019. Er gehört einer Frau. Darin sind Eintragungen, Namen, Termine.
Ich gehe zu den Terminen.
August 2019 – T10
Beim Therapeuten gewesen,
über gute Trennung, schlechte Trennung gesprochen.
August 2019 – M.
Du freust dich, mich zu sehen. Du sagst, ich sei deine Schwester. Du schaust in mein Gesicht, studierst es, du magst die rote Farbe auf meinen Lippen, wie du es schon immer gemocht hast, wenn man sich schminkt, das ist doch ja, sagst du, das kannst du doch, und deutest auf deine Lippen und lachst fröhlich. Du stehst neben mir, als ich sitze und Tee trinke, du sitzt nicht mehr gern, und betrachtest mich. Du streichst mir die Haare hinters Ohr, mit deinen steif gewordenen, wegen einer Krankheit schon immer rauen Fingern, und plapperst dabei. Dann ist die andere Seite dran. Das ist eine Zärtlichkeit, die ich kaum erinnere, und aus einer anderen Zeit. Du bist zufrieden mit mir, mit meinem Anblick, das warst du nicht immer. Es ist keine Wut in mir, keine Enttäuschung, du bist so herrlich harmlos, ich finde dich rührend, witzig, sogar süß, ich bemitleide dich nicht, es gibt keinen Grund dafür, du bist bei dir, du kämpfst nicht, leidest nicht, du bist in deiner Stimmung, auch wenn sie schlecht ist und du schimpfen musst und deinen Mann beleidigen. Die Hose muss hoch, die Hose muss runter, auch mal in der Küche. Du läufst auf und ab, zählst die Schritte, die Kacheln am Boden, man weiß es nicht, du bist weniger im Kontakt als die letzten Male, mehr für dich. Du sagst Papa zu deinem Mann, deinen Vater hast du Vati genannt. Am Ende meines Besuchs sagst du plötzlich einmal den Kosenamen aus meiner Kindheit. Ich hab dich nie gehabt, und dennoch verliere ich dich.
August 2019 – Autobahn
In der U8 sitzt ein Typ neben mir, Anfang vierzig, Typ Familienvater mit, ich tippe: arabischem Migrationshintergrund. Während der ganzen langen Fahrt vom Wedding bis zur Hermannstraße schaut er ein Autobahnvideo auf Youtube. Das Video ist aus der Fahrerkabine eines PKW gefilmt, sieht sehr professionell aus und zeigt die Fahrt auf einer deutschen Autobahn, ich kann leider nicht erkennen, welche. Den Blick immer auf die Straße gerichtet, sieht man Schilder und Leitplanken und Autos, die sich vor einem einfädeln, vor einem abbiegen, und von einem überholt werden, sehr meditativ, ganz konzentriert, kein Schwenk in die Landschaft, nur die Straße vor uns… Ich staune mal wieder, was ich alles nicht weiß, da hab ich echt ein komplettes Genre verpasst. Die schönsten Bahnstrecken Deutschlands, an die kann ich mich noch erinnern, das war beste Fernsehunterhaltung, aber die schönsten Autobahnen Deutschlands auf dem Smartphone, das kannte ich noch nicht.
Find ich super, dieses Kompensationszeug, wenn jetzt ab sofort alle in der Ubahn Autobahn fahren, dann ist der Planet gerettet.
August 2019 – T9
Beim Therapeuten gewesen,
über die große, weiße Tür gesprochen. Und über M., die mich dahinter eingesperrt hat.
August 2019 – Macht Eigentherapie Voyeurismus
Eine befreundete Psychologin erzählt, dass eine Kollegin von ihr beim Vorstellungsgespräch gefragt wurde, weshalb sie Psychotherapeutin geworden sei. Drei Kategorien wurden ihr vorgegeben: Macht, Eigentherapie, Voyeurismus. Ich bin verblüfft. Ich dachte, man wird Psychotherapeutin, weil man Menschen helfen will. Und: Kann man hier überhaupt so antworten, dass man den Job bekommt?
Die befreundete Psychologin erläutert, dass sie die drei Vorgaben für äußerst interessant und brauchbar hält, weil sie die übliche Antwort auf diese Frage verhindern, die da lautet: Weil ich Menschen helfen will. Sie spricht den Satz mit nachäffender Stimme. Ich schäme mich ein bisschen. Bei ihr, sagt sie weiter, treffen bspw. 1 und 3 zu; dass ihr Chef, als das Gespräch darauf kam, mit 2 geantwortet hat, das hätte sie nicht gedacht.
Ich frage, ob dieses „Menschen helfen wollen“ denn für sie so gar keine Motivation war, bzw. ob sie das in ihrer Arbeit so gar nicht erlebt. Doch, sagt sie, aber sie findet die Antwort Ich will Menschen helfen einfach nichtssagend und langweilig – noch einmal äfft sie den Satz in so einem Kinderton nach, und ich frage mich, ob sie ihn auch deshalb so ablehnt, weil sie findet, dass es so eine typisch weibliche Antwort ist, eine Brave-Mädchen-Antwort. Und da sie findet, dass Frauen selbstbewusst auftreten sollten, und dazu auch gehört, zu Motivationen und Handlungsweisen zu stehen, die allgemein als dunkel und egoistisch gelten, und eben nichts mit klassisch weiblichen Eigenschaften wie Opferbereitschaft, Fürsorge und Selbstaufgabe zu tun haben, sollten Frauen das auch sagen. Und überhaupt als Therapeutin den Anspruch haben, sich selbst in ihrer Arbeit zu reflektieren, und nicht zu glauben, sie seien nur gute, selbstlose Helfer. Ich finde das alles richtig und hochinteressant.
J. kommt auf seine Arbeit als Pfleger zu sprechen, in der er es als zufriedenstellenden Aspekt empfindet, Menschen zu helfen. Jemanden gut versorgt zu haben, ist befriedigend. Es geht nicht um das Interesse an Medizin, oder um etwas Soziales im Sinne einer Kommunikation oder einer Hilfe zur Selbsthilfe, sondern um etwas Körperliches.
Der befreundeten Therapeutin fällt noch ein, dass sie immer gerne Krimis gelesen hat. Etwas herauszufinden, einer Sache auf die Spur zu kommen, ist für sie ein weiterer Grund gewesen, Psychologie zu studieren.
Ich frage, ob man nicht immer, egal welchen dieser Aspekte man mit in die Arbeit bringt, immer den Patienten braucht, um das jeweilige Bedürfnis oder Interesse zu befriedigen. Der Therapeut kann nichts, gar nichts ausrichten, wenn der Patient es nicht will, er kann weder seinen Machtanspruch erfüllen, noch sein voyeuristisches Interesse oder seine Eigentherapie-Bedürfnisse befriedigen, wenn der Patient sich weigert, ihm etwas davon zu geben. Nicht umsonst gibt es ja den Begriff des Widerstands. Und ist Therapie nicht oft auch ein langer Tanz, ein Kampf genau darum? Du willst was, was willst du, mir helfen, von wegen, so weit kommt`s noch, deinen Narzissmus kannst du woanders befriedigen, für dich bin ich nicht zuständig, du denkst nur an dich, du willst profitieren, aber nicht auf meine Kosten, du mit deinem sezierenden Blick auf mein Verhalten, du mit deinem Herrschaftswissen da drüben auf der anderen Seite, hinter dem Kleenex. Ist natürlich typisch, dass mir das dazu einfällt.
Ein anderer Psychotherapeut, den ich kenne, fügt, nachdem ich ihm von den drei Kategorien erzählt habe, noch eine weitere hinzu: Geld. Erfrischend.
August 2019 – erwachsen
Wenn erwachsen sein bedeutet, dass man weiß, dass man nichts als einsam ist, dass einen niemand retten wird und nichts, und dass man es für möglich hält, dass die Dinge und Menschen sich jederzeit ins Schreckliche wenden können, dann bin ich erwachsen.
August 2019 – Mexikaner
Ich gehe mit einer Freundin in einen Club, tagsüber, das Wetter ist schön, die Musik nett. Das Publikum ist wie so oft in Berlin so nischenartig wie in der Nische gleichförmig und liegt hier so bei antifa-/queer-links plus Feier-people, tendenziell jung, definiere jung: Mitte zwanzig bis Anfang dreißig.
An der Bar bestelle ich einen Gin Tonic und zwei Mexikaner. „Was war das“, wiederholt der Typ, Federohrringe, lackierte Fingernägel, ohne mich anzuschauen, „ein Gin Tonic und zwei Mexikanerinnen?“ „Ja, genau“, sage ich, leise beschämt.
Als ich meine Drinks davontrage, ärgere ich mich. Klar, ich krieg hier zu meinen Drinks ne lecture in punkto gender gratis obendrauf, denn das ist es, was den Typ höchstwahrscheinlich gerade persönlich und akademisch umtreibt, aber was ist mit der Rassismus-lecture? Die hat er vergessen. An die hat er gar nicht gedacht. Wäre er ein Mexikaner, hätte er wahrscheinlich gesagt: Was du willst, ist ja wohl ein Gin Tonic und zwei Tomate-Wodka-Tabasco-Shots, oder? Und könnte es nicht sein, dass Mexikanerinnen sagen kein Fünkchen besser, sondern doppelt doof ist, nämlich rassistisch und sexistisch, oder warum soll man einen scharfen Tomaten-Shot Mexikanerin nennen? Da hilft nur eins: Mexikaner und Mexikanerinnen runter von der Getränkekarte! Aber ist das dann nicht sowas wie cultural discrimination? Grenzt man damit nicht eine ganze Kultur aus, macht sie unsichtbar, drängt sie in die Nicht-Repräsentation?
Das nächste Mal bestelle ich zwei ToWoTa, und wenn der Barkeeper sagt, ham wa nich, erklär ich ihm, was er alles nicht weiß.
August 2019 – die Wissenschaft hat festgestellt
Ich lese, dass Menschen in Beziehungen den meisten Sex haben.
Sag bloß.
August 2019 – Risa
Kürzlich am Bahnhof Zoo. Ich hab Lust auf Süßkartoffel-Pommes von Risa. Ich geh da rein, ist super viel los, die hinterm Tresen schreien die Bestellungen raus. Ich stell mich in die Schlange. Mein Blick fällt rechts auf eine Werbetafel, so eine mit Bewegtbild – läuft da ein Ausschnitt aus Four Blocks: Toni futtert bei Risa. Product placement im Zentrum des Bildes.
Krass. Ich bin geschockt. Ehrlich, ich find’s nicht witzig. Klar ist Four Blocks irgendwie sinnvoll, weil es eine Welt abbildet, die unsere Welt ist und von der nie jemand aufrichtig und ehrlich was wissen wollte und wissen will, aber wir haben da diese ganzen Kids und ihre Probleme, und auch wenn die sich endlich mal repräsentiert fühlen können, mit den ganzen Schwierigkeiten, die sie haben, irgendwie anders auf die Beine zu kommen als mit Drogen und anderem Abfuck, können wir denen doch jetzt nicht ernsthaft diese Lapidarisierung reinjubeln und den geilen Verbrecher-Typen erzählen, der in ihrem Rias sitzt. Das wäre ja noch vertretbar, wenn er da mal eben so sitzen würde, im Vorbeigehen, weil das ja eben die Welt ist, genau wie irgendein Späti, den alle kennen, aber jetzt hier so richtig Merchandise-Maschine mäßig ein mit Toni identifiziertes Produkt präsentieren, damit sich die Produktionsfirma voll einen dran abverdienen kann, und Risa auch, das finde ich obszön. Die Amis haben sich Los Pollos Hermanos wenigstens selbst ausgedacht.
Ich finde, das geht gar nicht und verlasse den Laden.
Juli 2019 – Nagelstudio
Die jungen Frauen im vietnamesischen Nagelstudio tun, als wär ich nicht da. Sie quatschen in ihrer Sprache an mir vorbei, durch mich hindurch und über mich drüber, anschauen tun sie mich nicht. Sie halten kurz beim Feilen inne, um irgendwas laut lachend quer durch den Raum zu rufen oder die Nebenkollegin was zu fragen, sie gucken sich gegenseitig über die Schulter, reden über meine Nägel. Ich bin Luft. Nur ab und an richten sie eine Frage oder einen Befehl an mich. Rund? Locker! Oder: Hier! Aber meistens machen sie nur schweigend eine Handbewegung oder führen meine Hand mit ihrer Hand irgendwohin, in das kleine Aufweichbecken oder unter den Trockner. Eine fängt an, mit der Prozedur, aber sie hat keine Lust und bleibt dauernd mit der Feile hängen, die alt ist und abgenutzt, sodass ich schon überlege, ob ich was sagen soll, sie kann nichts, und das weiß sie auch. Die zweite schiebt die erste weg aus meinem Frontalblick, und sich rein, ins Bild. Die zweite macht das schon ganz gut. Dann kommt die dritte, die kanns. Als ich bei der dritten, die vor mir auf dem Stuhl auftaucht, grinse, und sage, Jetzt bin ich verwirrt, du bist schon die dritte, lacht sie und sagt: Ja?, dann redet sie mit den beiden Vorher-Mädchen auf Vietnamesisch weiter.
Keine Ahnung, vielleicht hab ichs verdient, weil ich ins Nagelstudio gehe, oder es ist so ein Kulturding, dass ich nicht kapiere oder kenne, aber ich finds unhöflich. Dabei hab ich doch ein schickes, mittemäßiges Studio gewählt, die jungen Frauen und Männer sehen alle aus wie Hipster, die aufs Gymnasium gehen und vor allem eins wollen: Arbeiten und Geld verdienen, damit sie sich Klamotten kaufen können. Kostet ja auch das Doppelte hier wie im Billigstudio. Trotzdem ist es ein Job bei dem man den ganzen Tag Lack einatmet und was weiß ich noch für andere giftige Substanzen – meine giftigen Substanzen! Und man weiß nicht, unterstützt man damit jetzt die vietnamesische Community mit ihren selbst aufgebauten Geschäftszweigen oder die vietnamesische Mafia mit ihren selbst aufgebauten Geschäftszweigen, Kulturförderung oder Mädchenhandelförderung, Selbstermächtigung oder moderne Sklaverei?, die Linien sind fein, das weiß man ja, wo ist was, kolonialistisch, imperialistisch, globalkapitalistisch, ich guck jedenfalls alle an und mich guckt hier keiner an,
ich bin eine Hand mit Nägeln.
Am Ende freu ich mich über die herrlich sauber gemalten kleinen roten Flächen an meinen Fingern und sehe es so: Die Mädchen hier sind alle hübsch, selbstbewusst und unhöflich. Das lässt doch hoffen!
August 2019 – T8
Beim Therapeuten gewesen,
über Papa gelästert.
August 2019 – Sekundenschmerz
Gestern im Cafe. Ich sehe vom Rechner hoch, fährt da ein Typ auf dem Rad am Fenster vorbei, ich sehe ihn von hinten, und für eine Sekunde denke ich: Da ist T.
Der Schmerz (die Liebe?, die Angst?, wer könnte sie unterscheiden, ich nicht), fährt mir in die Eingeweide, und ich gehe in die Knie. Ich denke an deinen Körper und kann es nicht fassen: Noch immer bin ich verliebt in dich.
Wann soll das jemals aufhören. Warum und wodurch. Und womit hat ein anderer Typ das verdient.
August 2019 – Was hat dich bloß so traumatisiert
Ich schlafe und erwache mit Angst.
Angst vor dem Tag, der Arbeit, der Zukunft. Alles ist leer und eng zugleich.
Vor dem letzten Aufwachen: Traum mit T. Ich bitte ihn, mit mir zu sprechen, mir zu erklären, was in ihm vorgeht, mir zu sagen, was er denkt. Er sitzt entfernt von mir, rutscht noch weiter bis ans Ende des Sofas, wendet sich ab, ist ungehalten, Da gibt es ganz klar 3, 4 Punkte, sagt er, ich bitte ihn, mir zu sagen, welche, ich verstehe ihn nicht, er nuschelt, dann sagt er: Also gut, wenn dus wissen willst: Ich fand noch nie eine Frau so abstoßend.
Warum träume ich das? Warum muss ich damit durch den Tag gehen? Warum heile ich nicht?
Warum hat mich das so traumatisiert?
August 2019 – T7
Beim Therapeuten gewesen,
eine Übung gemacht.
August 2019 – press here

Never pressed so far.
(Bad art.)
August 2019 – Spam
Man sollte immer alle seine Spam-Nachrichten lesen. Hier findet man nämlich oft Momente aphoristischer Weisheit, sieht sich mit interessanten philosophischen Fragestellungen konfrontiert (Brauchen Sie Geld?), und kommt in Kontakt mit Menschen, die einen mit seinen Grundbedürfnissen und inneren psychologischen Aufstellungen erkannt zu haben scheinen und in höflicher Form darauf ansprechen. Hier zum Beispiel eine Nachricht von Niels Günther aus Hohenroda in Deutschland: Elli April Sie möchten auch endlich viel mehr Härte?
August 2019 – Loslassen
Ob ich das will, fragt mein Therapeut. Was? frage ich. Loslassen.
Natürlich nicht. Loslassen ist wie sterben. Und wenn es wie fliegen sein sollte, dann kommt doch immer noch unten der Aufprall. Also der Tod. Oder zumindest die schwere Verletzung. Warum also sollte ich loslassen und vor allem was? Das, was gut ist? Meine Liebe, meine Loyalität, meine Treue, meine Integrität, meine Überzeugung, meine Freundschaft, meinen Respekt, mein besseres Leben?
August 2019 – T6
Beim Therapeuten gewesen,
blöd rumprovoziert.
Juli 2019 – Die Stadt
Die Stadt ist ein Mantel.
Groß und schwer, hüllt er mich ein,
wärmt mich, erdrückt mich,
zieht mich runter, mit seinem Gewicht.
Der Mantel ist alt, zerschlissen und kratzig,
voller Flecken und Löcher und kleiner Tiere, die in ihm wohnen, genau wie ich. Er riecht und er stinkt, er lässt Luft. Unter ihm bin ich nackt.
Ich bin nicht denkbar ohne den Mantel. Ich kann mich nicht verlieren ihn ihm.
Die Stadt ist ein Mantel,
der Mantel mein Haus, mein Gehäuse.
Die Stadt ist mein Mantel.
Die Stadt ist mein Mantel.
Juli 2019 – Neues vom Feminismus
1 Die Vulva
Die Vulva ist gerade in aller Munde. Die Vulva ist das nächste große Ding. Die Vulva ist voll im Kommen. Nein, im Ernst jetzt. Aufgrund des repräsentationspolitischen Versuchs, die Vulva aus ihrer strukturell bedingten Unsichtbarkeit zu holen und ihre Gleichstellung mit der Pimmelzeichnung zu erreichen, findet man sie inzwischen praktisch auf jeder zweiten Toilette. Ich persönlich begrüße das sehr. Sogar meine Frauenärztin greift nämlich, wenn ich eine vulvabezogene Frage stelle, freundlich nickend zum Spekulum und taucht damit in meine Vagina ab. Die Vagina, die Vagina. Die hatten wir doch jetzt. Sogar Monologe musste sie halten. Jetzt sind wir gespannt, was die Vulva uns zu sagen hat. Wie so eine Vulva aussieht, weiß nämlich im Grunde kein Mensch. Anders als der Penis, der ja quasi auf die 12 und in ya face am Männerkörper angebracht ist, braucht man für eine ordentliche Vulva-Selbstbetrachtung schon zwei Hände plus einen Spiegel (!). Was man dann sieht, kommt einem suspekt vor. Ob das so gehört? Keine weiß es. Die medizinischen Abbildungen haben mit dem, was man da vorfindet, nur abstrakt etwas zu tun, der Pornografie ist nicht zu trauen, und anders als der Penisvergleich zur männlichen, gehört der Vulvavergleich nicht zur weiblichen Sozialisationskultur. Da hilft nur eins: Der Rückgriff auf die DIY-Kultur. Vulva-Strickmützen, Vulva-Kissen, Salzteig-Vulva, Vulva-Malbücher, Vulva-Gipsabdrücke, endlich kommt Licht in die Sache. Im Internet scrolle ich mich durch Vulva-Abdrücke und staune einmal mehr über die unendliche Vielfalt der Natur.
Doch wie das so ist in Kapitalismus und Patriarchat, kaum hat man Sichtbarkeit und Repräsentation erkämpft, steigt auch schon der Druck. Beauty- und Optimierungsstress sind round the corner, der übliche Gentrifzierungskreislauf der Körperpolitik. Das System tritt an, die vielen unschuldig-diversen Blüten dem Markt zu unterwerfen, und uns ganz genau wissen zu lassen, wie sie denn nun gehört, Germanys Next Top Vulva: Straff, faltenfrei – und mit einem Schuss personality. Und die Männer, die sich, so mein Eindruck, bisher nicht besonders für die Vulva interessiert haben, ihr eher beiläufige Blicke zugeworfen haben, und wie meine Frauenärztin lieber rasch nach ihrem Instrument gegriffen haben, um damit freundlich nickend Richtung Vagina abzutauchen, (orale Umwege über die Klitoris, immerhin part of the vulva, nehmen sie ja, was für eine historische Errungenschaft, was für ein Kampf, mal kurz erinnern, bitte, und danke sagen nicht vergessen) die, ja die sind jetzt natürlich aufgewacht und auf die Idee gebracht, auch die Vulva in ihre definitionsmächtigen Attraktivitätskategorien einordnen zu können und ganz genau zu wissen, welche Vulven sie so an- oder abtörnend finden. Und schon finden wir uns mit unserer Problemvulva im Fitnessstudio, beim Friseur oder beim Schönheitschirurgen wieder (Schamlippen-OP im Trend).
Aber wie zeichnet man jetzt eigentlich eine Toiletten-Vulva? So ein Pimmel ist ja schnell aufs Wesentliche reduziert, mit einem einzigen durchgehenden Strich kriegt man ihn hin, inklusive ein paar Eiern. Noch einen kecker Schwung für die Eichel, ein Strichlein für die Harnöffnung, schon hat man ihn. In all seiner Charakteristik. Schon rein zeitlich kann man sich dann noch ein paar spratzige Hoden-Haare als Verzierung leisten, die verleihen der Sache immer so einen gewissen Witz, wahrscheinlich weil sie im Kontrast zum schnell gekritzelten Rest so schön auf die äußerliche Unterkomplexität des männlichen Geschlechtsorgans verweisen. Die Vulva der Frau hingegen ist natürlich wahnsinnig komplex, ja, na klar! Äußere Schamlippen, innere Schamlippen, Klitoris, Harnröhrenöffnung, vaginale Öffnung – da ist ne Menge los und mit ein zwei Kritzelstrichen wird’s knapp. Was tun? Versucht man, ihr gerecht zu werden, wird’s albern, wir sind hier auf Toilette und nich beis Rembrandts. Versucht man sie so knapp wie möglich zu halten, längliches Oval mit einem Punkt für die Klitoris, sieht sie aus wie ein nach oben schwimmender, evangelischer Fisch. Ich hab bisher wenig Überzeugendes gesehen. Aber da hilft nur eins: Üben, üben, üben. Ich kenne Jungs, die haben das jahrelang gemacht, Peniszeichnungen, schulhefteweise. Am Ende sahen die aber auch echt top aus.
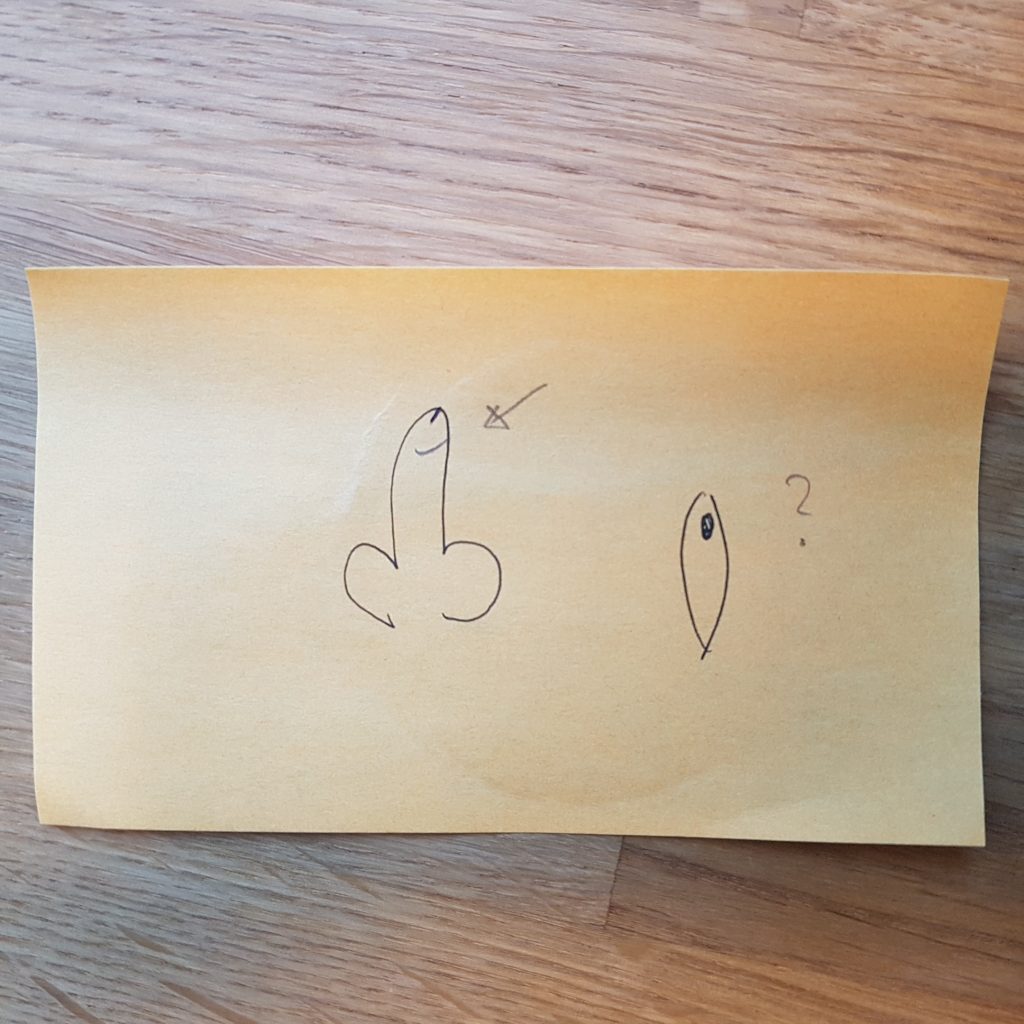
2 Die Menstruation
Hier eine Zusammenfassung der aktuellen Debatte. (Man beachte auch die Vulvazeichnung oben-mittig, hier in einer Variante mit smiley.)
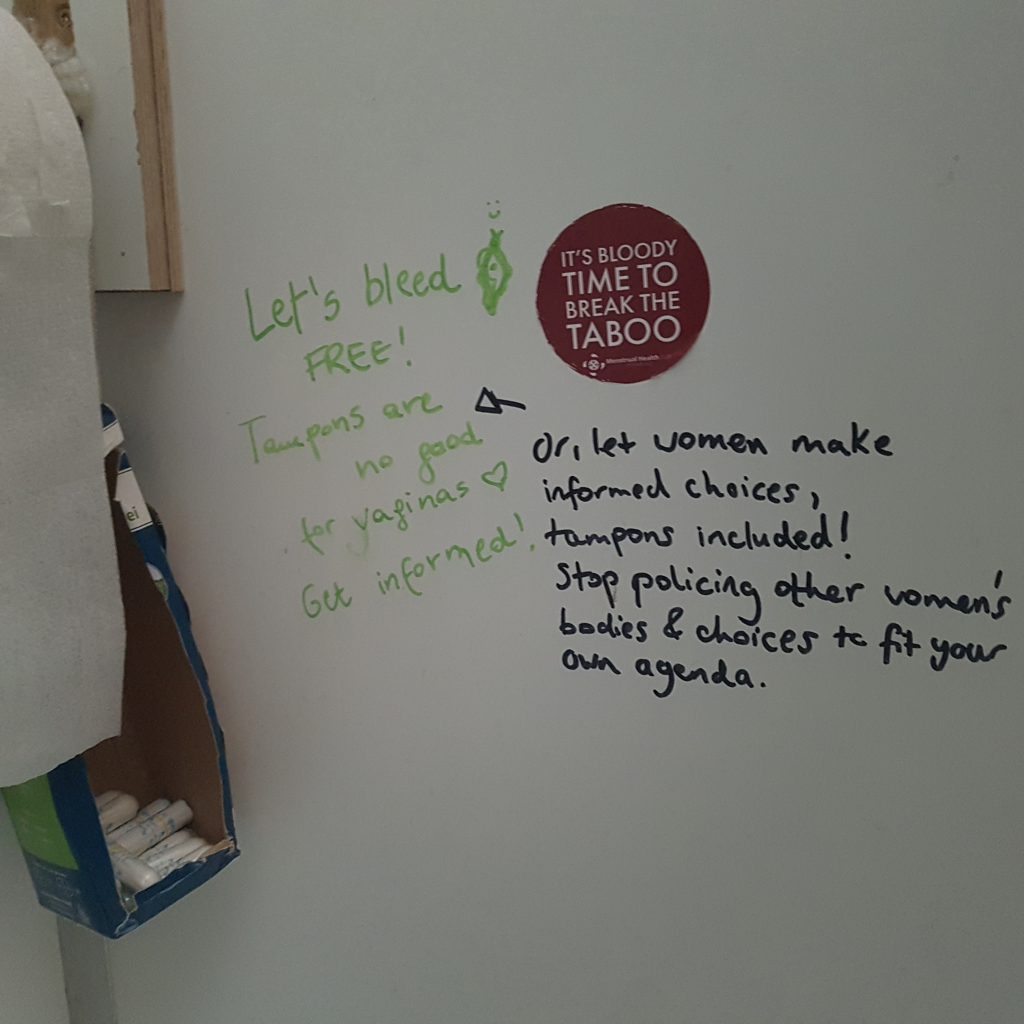
3 Die Burschenschaft
Linksrechts, linksrechts im Umkehrschluss. Das Beste zum Thema kommt gerade aus Österreich. Hier haben Frauen die Burschenschaft Hysteria gebildet. Ihr Schlachtruf: Patriarchat wegfotzen!
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Juli 2019 – weise
Ein Junge, so ca. 5, stellt sich an der Ubahn-Haltestelle vor mich hin und starrt mich an. In gebührendem Abstand zwar, aber er starrt. Erst lass ich ihn und guck weg, damit er in Ruhe starren kann. Ich verstehe Starrbedürfnisse. Aber er hört nicht auf. Es fängt an, mich zu nerven. Also schau ich zurück. Er starrt weiter. Was guckst du mich so an, sage ich schließlich. Kurz dreht er beschämt den Kopf weg – nur um mich gleich wieder anzustarren. Schließlich tut er einen sehr tiefen Seufzer. Und dreht sich weg.
Der weise, kleine Mann.
Juli 2019 – T5
Beim Therapeuten gewesen,
im Anschluss heulend Taschentücher gekauft und der Frau am Kiosk gesagt, ich hätte Allergie.
Juli 2019 – Anonyme Spende
Ständiges inneres Stress-Dilemma in se Börlin Sitty: Wem was geben, wie viel, wie oft. Kann man spontan entscheiden, klar, irgendwelche Kriterien anwenden, dem hab ich noch nie was gegeben, das ist ne Frau, dem geht’s aber schlecht heute, was ist das denn für ne neue Obdachlosenzeitung, hab schon ewig niemand mehr was gegeben, jetzt sitzt der auch im Rollstuhl, hab heute Geld von der VG Wort bekommen, der ist ja rührend – was auch immer. Aber das stört mich. Dieses der Nase nach. Ich will niemanden meiner Stimmung ausliefern, von meiner Tagesverfassung abhängig machen, meinem Sympathieempfinden unterwerfen, meinen ganzen subjektiven Ego-Assoziationen. Ich will das rationalisieren, abstrahieren. Wer bin ich zu entscheiden, wer von mir Geld bekommt? Ich will was spenden, aber ich will nicht wissen für wen. Ich will:
Die anonyme Spende.
Meine aktuelle Lösung: Immer wenn meine Pfandflaschentasche voll ist, packe ich die Flaschen in eine saubere Papiertüte mit Henkel und stelle sie neben den BSR Mülleimer auf die Straße. And off I go. Das Schicksal nimmt seinen Lauf.
Davon bin ich gerade begeistert. Von dieser Lösung. Die macht mich total zufrieden. Ein Dilemma weniger.
Vielleicht. Ist es aber auch so: Ich trickse Menschen in Zwangslagen aus, damit sie Dienstleistungen für mich verrichten, auf die ich keinen Bock habe, weil ich stinkfaul und -reich bin. Gut, dass die Anonymität für beide Seiten gilt.
Juli 2019 – T4
Beim Therapeuten gewesen.
Im Anschluss hungrig einen Burger verschlungen.
Juli 2019 – GTGA
Ein Typ und sein Kumpel laufen an mir vorbei. Beide son bisschen punkig-schwarz gekleidet, Mitte fünfzig, schon rough, aber jetzt auch nicht obdachlos oder so. Der Typ, Bierflasche in der Hand, zu mir im Vorbeilaufen: Geile Titten. Ich, im Weiterlaufen: Arschloch. Er, im Weiterlaufen, checkt meine Rückseite: Und geiler Arsch! Ich rufe: Sexist, Arschloch und bleibe stehen. Er dreht sich um, hält beide Mittelfinger in die Luft, lacht dreckig. Der Kumpel neben ihm die ganze Zeit kein Wort zu gar nix.
Jaja, sowas ist nicht schön. Ekelhaft ist das. Dumm kommt man sich vor, hilflos und kläglich in seiner Reaktion, reduziert auf seine sexuellen Merkmale, an denen sich jemand einfach so delektiert ohne darum gebeten worden zu sein. Und dennoch. Fühle ich mich den ganzen Tag: Geile Titten, geiler Arsch, summt es in mir und ich laufe beschwingt weiter. This asshole made my day. Wann hab ich mich in den letzten Monaten so gut gefühlt? So viel Anerkennung bekommen? Dieser widerliche, voll gestörte, abstoßende, hässliche Vollhorst, dem ich am liebsten in die Eier treten würde, hat es geschafft, dass ich plötzlich denke, vielleicht ist ja doch noch nicht alles verloren und man kann mich wollen. Ich weiß, der Ekeltyp sagt das nicht mir, ich bin ja nicht blöd, der meint nicht mich, der meint nicht mal meine Titten und meinen Arsch, der sagt das zu jeder Frau, bzw. zu allen Titten und allen Ärschen, die vorbeilaufen, völlig egal, ob die geil oder ungeil sind, da wird angelabert was rumläuft, solange kein Mann neben den Titten und Ärschen geht, dessen Besitzverhältnisse man in Frage stellen würde, mit so einem Spruch.
Seine eigene Attraktivität steht hier natürlich nicht zur Debatte, nie. So einer geht praktisch permanent durch den Supermarkt – der ist noch dazu so alt und so prollig, dass er nicht mal wegswipet, davon hab ich hier schwer profitiert – liefern muss der gar nix, der ist ein Mann, das reicht als Währung aus, der will Frauen vögeln, bzw. Titten und Ärsche, und hat alles recht dazu, ob die Frauen ihn wiederum vögeln wollen, spielt dabei erstmal keine Rolle. Er macht das dann schon. Er verständigt sich schon mit den Titten und den Ärschen. Zur Not gegen Geld oder mit Gewalt.
Das ist das Perverse an dieser Welt. Der Cat-Call, die Belästigung, die Nötigung, der Missbrauch, sogar die Vergewaltigung tragen in sich den Kern eines Kompliments, einer Anerkennung, einer äußerst schmeichelhaften Wahl, die auf uns als Frau gefallen ist, einer Auswahl von der wir getroffen wurden, (positiver Sexismus, Hierarchie nett gemeint), die wir nicht loswerden, die an uns klebt und in uns wirkt und weswegen wir dann auch die sexualisierte Gewalt so schlecht loswerden. Das ist die Logik innerhalb derer wir uns bewegen. Und als Frau, die sich dessen bewusst ist und die versucht, da rauszukommen, ist man dann auch noch mit seinem schlechten Gewissen beschäftigt, dass man da was gut findet, dass man da was draus zieht, wogegen man sich aber doch eigentlich wehren muss, was man nicht gut finden darf, wogegen man sich richten muss, gegen die aufgezwungene Logik, gegen die verkackte Welt. Wir haben das Gewissen, nicht die. Nicht ein bisschen Gewicht auf ihnen.
Juli 2019 – in die Stadt
Gestern auf der Rolltreppe. Rechts stehen die Leute in langer Schlange hintereinander den Berg hinab, ich laufe links die Stufen runter, frei und flüssig, produziere dabei diesen typischen Sound, den die hohen Stufen machen, wenn man von oben auf sie tritt, fällt ja beinahe, dieses leicht nachschwingende dack, dack, dack, ich liebe es – bis ich bei einem Paar ankomme. Sie versperren den Weg, sie links, er rechts, beide leicht angeprollt, sie Mitte vierzig, er Anfang fünfzig mit Sonnenbrille. Das übliche Dilemma: „Entschuldigung“ sagen, „darf ich?“ und vorbei gelassen werden – oder stoisch aushalten bis die Rolltreppe am Ende in einem natürlichen Prozess alle Wegversperrer in die Umgebung verteilt?
Die Frau motzt irgendwas, weil offensichtlich gerade ein Typ vor mir, dem ich neidisch hinterher schaue, ums Vorbeilassen gebeten hat. Ich mische mich ein. Rechts stehn, links gehen geht ja auch besser, sage ich. Da dreht die Frau sich zu mir um, holt mit beiden Händen aus und schubst mich an der Brust so kräftig nach hinten, dass ich strauchle, und mich gerade noch am Gummigeländer festhalten kann, um mich nicht komplett auf den Hintern zu setzen: Halt deine dreckige Fresse!, brüllt sie mich an. Hey!, schreie ich, spinnst du! Sie: Halts Maul, Votze! Ich: Ja, gleichfalls!
Die Rolltreppe ist am Ende. Das Paar gleitet auf die Erdgeschossfläche Bahnhof Friedrichstraße. Er, der die ganze Zeit nicht mal ne Augenbraue gehoben hat, jetzt zu ihr:
Du wolltest ja unbedingt in die Stadt.
Juli 2019 – Für einen Moment
Heute habe ich hier etwas gelesen und seit sehr sehr langer Zeit, hab ich mich mal wieder für einen Moment gemocht.
Juli 2019 – T3
Beim Therapeuten gewesen,
die Übertragungsmaschine angeschmissen.
Juli 2019 – bi-curious
Alle sind jetzt bi-curious. Ich nicht. Ich bin überhaupt nicht curious. Schon gar nicht bi. Außer bi meint zwei Hetero-Jungs, die mit mir Sex haben wollen. Das stört mich nicht. Und wenn zwei Jungs sich anfassen wollen, während ich dabei bin, da hab ich auch nichts dagegen. Was ist das dann? Gay-curious? Und wenn ich selbst mal einer der Männer sein könnte, da hätte ich auch nichts dagegen, was ist das dann, dick-curious?
Aber am Ende, wie ichs drehe und wende, alles was ich will ist meine hetero-normative Ruhe und ein imaginäres Gesamt-Sex-Szenario in dem ich die einzige Frau weit und breit bin, am besten nach der Frauen-Apocalypse.
Juli 2019 – T2
Beim Therapeuten gewesen,
über Kleenex gesprochen.
Juli 2019 – leiser
Leise höre ich dich flüstern, auch du liegst gerade allein im Bett:
Wie geht es dir?
Du weißt doch, flüstere ich zurück, und lächle dich an:
Ich bin zäh.
Manchmal brauche ich diese Vorstellung.
Juli 2019 – Mütter, die Haare kämmen
Im Prinzessinnenbad beobachte ich, wie Mütter (eher so Migrationshintergrund) ihren Töchtern die Haare kämmen. Obsessiv und stundenlang. Ich glotze hin, so dass es schon unhöflich ist, aber ich kapiers nicht. Was da vor sich geht. Ich kann es nicht deuten. Ich guck und guck und verstehs nicht, nichts davon kenne ich, nicht die Haare der Töchter, lang und dick, nicht die Mütter, die die Haare kämmen, mit langen, bestimmten Bürstenstrichen, nicht sanft, eher grob und kräftig, das Haar spannt, das Mädchen hält dagegen, die Mutter fährt mit der Bürste über die Kopfhaut, den Nacken hoch, sie und die Tochter ein eingespieltes Team, das muss sein und dennoch machen sie das gerne, da korrespondiert was zwischen den beiden, hier wird eine Erinnerung produziert, eine Kulturtechnik zelebriert, ein Frauenleben tradiert, früher hat mir meine Mutter immer so die Haare gekämmt, und nun kämme ich dir deine. Das Mädchen guckt mit diesem Innenblick nach außen, die Mutter bürstet und findet die Tochter schön und das Haar der Tochter schön, stolz ist sie darauf, und ihre Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die Tochter schön bleibt und auch in Zukunft schön sein wird, weil es wichtig ist für Mädchen, und schön, dass sie schön sind und schöne Haare haben, lange und gepflegte, genau wie Mama, später mal, kann sie sie färben, und Frisuren und Wellen haben wie sie, aber jetzt noch nicht, jetzt hat sie noch diese natürlichen, langen Haare, die man bürsten muss, in die man Zöpfe flechten und Haargummis binden und Klammern stecken und all die anderen Drogeriemarktartikel aus der Haarschmuckecke einpflegen kann, vor denen ich genauso interessiert davor stehe wie vor Werkzeug bei Obi, lange, dichte Haare an denen man zupfen und die man streichen kann, bis alles so ist, wie es sein soll, immer wieder, von oben bis runter, die ganze Strecke bis in die Spitzen, das Kind will schon weg, aber die Mutter muss noch hier und da, und doch noch einmal besser ganz durch mit der Bürste, Kontrolle, Stolz, Fürsorge, Besitz, und etwas was ich nicht kenne, erkenne, vielleicht ist es Liebe, ich bin mir aber nicht sicher.
Juli 2019 – Mitte
Drei Anfang Zwanzigjährige, ein Mädchen, zwei Jungs, groß, blond, Tennis, Anwaltseltern oder Arzt, parken ihr Auto in zweiter Reihe, steigen aus, legen das Smartphone aufs Mäuerchen, hier hin, wo alle sind bei dem schönen Wetter, Eltern, Kinder, Weißweingläser, schieben mit der Kreditkarte ein bisschen Koks auf dem Display zusammen, und kichern rebellisch während sie sich die Lines reinziehen.
Juni 2019 – new Model T – T1
Beim Therapeuten gewesen,
geweint.
Juni 2019 – TTTherapie
Beim Therapeuten gewesen.
Der Arme
Juli 2019 – Sommer
Zwei junge Mädchen auf dem Rasen am Alex. Nackte Beine unterm Rock. Sie haben sich Handventilatoren gekauft bei primark. Jetzt föhnen sie ihre Kniekehlen. Ich liebe sie.
Juli 2019 – The Dead Dont Die
Hübscher Kinderfilm von Jim Jarmusch. Der mich immer öfter an Wes Anderson erinnert, aber vielleicht liegt das auch nur an Bill Murray. Schön finde ich, dass die Frauenfigur (Chloe Sevigny) Angst haben darf, und nicht der in Zeiten von Meetoo und Pro Quote naheliegende Fehler begangen wird, zu glauben, die „starke Frauenfigur“ sei gleichbedeutend mit der Figur „furchtlose Superlady, die alles im Griff hat“. Schön auch, wie die Köpfe der Zombies beim Wegballern eine Asche-Explosion nach sich ziehen, Asche zu Asche, Staub zu Staub, eine wundervoll poetische Idee.
Juli 2019 – Stockholm
Wir fahren Schiff. Der Kapitän ist sehr hübsch, vielleicht Mitte zwanzig, ich sage jetzt nicht, an wen seine Figur mich erinnert, das kriegt hier so langsam einen Bart. Seine Matrosin im gleichen Alter hat heftig unrasierte Beine und wirkt, als sei sie sehr glücklich und im Reinen mit sich und ihrem Job. Sie muss das Schiff an der Spundwand befestigen und Fika und Kanelubulle verkaufen.
Stockholm ist sehr nah. Buchstäblich – nach einer Stunde 20 landen wir schon, aber auch sonst. Nichts ist hier fremd, könnte auch ein Ausflug nach Hamburg oder Lübeck sein. Wir tauschen keine einzige Krone um, weil absolut alles mit ec-Karte geht.
Der Audio-Guide auf dem Schiff schildert selbstbewusst und mit viel Liebe, was schwedisch ist, was den Schweden so wichtig ist und wie die schwedische Geschichte so war. Gut nämlich. Das wäre hier in Germany nicht möglich, behaupte ich mal, das finde ich schon interessant. So eine (Leit-) Kulturidentität. Würden wir nicht schildern. Wir würden nicht voller warmherzigen Stolzes uns selbst gegenüber erzählen, dass wir pünktlich sind, am liebsten Sauerkraut und Kartoffeln essen, eine große Handwerks- und Ingenieurstradition haben und viele tapfere Helden, die blutige Schlachten gewonnen haben.
Juni 2019 – kein Blut, rot
Nur ein Satz. Reicht aus. Von jemand. Über dich. Um mich in der Badewanne zu sehen. Einer Badewanne voller Blut. So konkret war das noch nie.
Von wegen Rollvenen.
Das war schon immer ein Mythos.
Ich weiß wie das geht.
Man lässt das Wasser an,
gegen die Sauerei.
Man ist in Aufruhr, in Panik
Aber das
ist nur dein Körper
Der sich wehrt
Das ist seine Natur.
Das muss man überwinden
Da muss man durch
Dann wird es ruhiger
Und man wird müde.
So müde wie man
Die ganze Zeit schon war
Und hätte sein sollen
Nützen diese Medikamente denn gar nichts?
Juni 2019 – Geld
Geld Geld Geldigeld.
Geld ist ein Problem.
Money is time.
No money no time.
No time for money.
Money, its time.
Geld Geld Geldigeld,
Geld ist ein Problem.
Juni 2019 – LiebeundBeziehung
Zuerst musst du so tun, als wär`s wahnsinnig wichtig. Du musst dich reinhängen und dranbleiben und verzeihen und weitermachen, du musst es leben und reden, aber auch nicht zu viel, du musst das breit machen in dir und in deinem Leben und es zulassen, du musst teilen und teilnehmen und fragen und zuhören, du musst die Nähe aushalten und die Distanz, die Liebe und den Hass, die Schönheit, das Glück, die Hässlichkeiten und die Verzweiflung, du darfst den anderen nicht einengen, aber auch selbst nicht zu kurz kommen und und und, wichtig wichtig wichtig, jahrelang
Dann, von einem Tag auf den anderen. Musst du so tun, als wärs nicht wichtig. Als wärs nie wichtig gewesen. Du musst es vergessen. Du musst es ignorieren, hinterfragen, kaputt machen, zersetzen, über den Haufen werfen, beerdigen. Du musst es „egalisieren“, banalisieren, es als Einbildung, Projektion, Fehler, Abhängigkeit, Schuld deklarieren. Du bist jetzt wichtig, dich musst du lieben, dir musst du genügen. (Als wär das nicht die ganze Zeit schon sinnvoller Teil davon gewesen.)
Das ist die Aufgabe. Der Anspruch. Die totale Verunwichtigung von Liebe und Beziehung.
Und natürlich
muss dir eines Tages.
Wieder jemand
wahnsinnig wichtig sein.
Aber da.
Mach ich nicht mit.
Juni 2019 – damalig
Ich nehme Anlauf, konzentriere mich, beschließe, es zu sagen. Dann sage ichs, nehme die Hürde, so mitten im Satz:
Mein damaliger Freund.
Es kommt mir vor wie ein Betrug. An mir selbst.
Juni 2019 – mit auf den Weg
Wie kann es sein, dass jemand im Sterben liegt, der nichts möchte als leben und jemand lebt, der nichts möchte als sterben.
Ich schäme mich deshalb. Ich fühle mich schuldig.
Du hast immer so gern gelebt. Du hast es gut gemacht. Du hattest ein Talent dafür. Dein Leben reich zu machen. Und das der anderen. Voller Bindungen und Beziehungen, voller Klugheit und Offenheit.
Ich möchte nicht sterben, das wollte ich noch nie, ich wollte schon immer gerne leben. Aber es klappt einfach nicht. Ich hab kein Talent dafür. Ich weiß nicht, wies geht. Und irgendwann. Sollte man das vielleicht einfach mal anerkennen. Und es lassen.
Gib gut auf dich acht, und mach das, wozu du Lust hast, am besten jetzt. Das sagst du mir. Gibst es mir mit auf den Weg.
Juni 2019 – Wait to be seated
Sind Sie alleine?
fragt mich die Bedienung im Sushi Laden jedesmal.
Tja, was soll ich dazu sagen.
Ja
Juni 2019 – Sommer
Ich liebe den Sommer.
Der Fluss ist schön. Das Wasser ist klar. Ich schwimme! Ich bewege mich. Die Räder des Fahrrads unter mir. Ich komme voran. Ich gleite. Ich trinke, und rauche, ich rede. Mit jemandem, den ich wirklich mag.
Warum also.
Nützt es nichts.
Juni 2019 – Solidarität
Gestern auf dem Heimweg. Wedding, kurz vor Ubahnhof Pankstraße, es ist 23 Uhr. Läuft ein Typ an mir vorbei, Mitte 50, klein, dick, migrationsprollig. Ich trage einen Rock, ein bisschen Bein schaut raus – Tssch, schnalzt er genüsslich mit der Zunge, macht unvermittelt eine Bewegung in meine Richtung und schnipst mit Finger an mein Bein, gerade so ohne es zu berühren. Ich erschrecke, die Bewegung kommt so plötzlich, im Weiterlaufen mache ich auch Tss, und sage laut „Arschloch.“
An der Ampel kommt eine junge Frau neben mir zu stehen, Mitte zwanzig, sie ist hübsch, bisschen New Yorki gekleidet, sie spricht mich an: Are you okay? Yes, sage ich, thank you, und lächle sie an. I hate, when this happens, sagt sie. Yes, sage ich, its always horrible, thank you for asking, thats very nice, really: Thanks for asking. Wir nicken uns zu. Es ist wundervoll.
Am I okay?, frage ich mich im Nachhinein. Das, was in mir aufwallt, ist etwas anderes als das, was ich getan habe (Weiterlaufen, Arschloch sagen). Ich hätte ihm gerne die Fresse poliert, meinen Hass, meine Verachtung und meine Frustration über meine Ohnmacht in sein Gesicht gehauen, ihm mit dem Fuß Thai-Box mäßig gegen seinen Wanst getreten, um ihm ein für alle Mal das Handwerk zu verderben. Das ist, weil er mich erschreckt hat. Weil ich zusammen gezuckt bin. Weil er nicht nur dumm und sexistisch agiert hat, sondern weil er meinen Körper affiziert hat. Weil ich mich aufrege, weil ich zittrig bin, weil er mir den Abend versaut hat. Einfach so. Weil ers kann.
Vielleicht wäre es doch besser gewesen, stehen zu bleiben und ihn mit mehr als einem „Arschloch“ zu konfrontieren, worüber er eh nur kichert. Vielleicht ist es doch mal an der Zeit Kampfsport zu machen. Oder wenigstens einen Selbstverteidigungskurs. Auch wegen und für die junge Frau, die mich angesprochen hat. Solidarnosc
Juni 2019 – Silhouette
Ich sehe deine Silhouette, deinen Gang, deinen Körper, ich kenne deine Haut, die Linien und Flecken, deine Hände, deine Augen. Ich kann alles aufrufen und abrufen und vor mir sehen, und ich werde einen Teufel tun, das zu tun, ich bin ja nicht bekloppt, und dann kommt ein Traum und tut genau das.
Juni 2019 – Rechtsterrorist erschießt CDU-Politiker
Lübcke ermordet. Ich schreibs hier auf, damit ichs nicht vergesse. Ist nicht so, dass nicht schon Hunderte anderer ermordet wurden. Ist aber ein Politiker. Wird nicht der letzte gewesen sein. Der Aufschrei in der CDU bleibt überraschend klein. Kommt nur langsam in Gang. Schleppt sich.
Juni 2019 – am Leben
Ich mach so viel. Aber es reicht nicht. Ich bin so sehr am Leben wie ich kann. Aber es nützt nichts.
Es nützt einfach nichts.
Juni 2019 – leise
Noch immer will ich dir
alles erzählen.
Noch immer will ich dir
alles zeigen.
Noch immer will ich
alles von dir wissen.
Jeden Tag und jede Nacht.
Juni 2019 – DNT
FCK NZS
steht auf dem T-Shirt einer Frau.
Müsste es nicht heißen:
DNT FCK NZS
Wir wollen die ja jetzt nicht auch noch mit Sex belohnen.
Juni 2019 – Staub
Ich guck mal, was passiert, wenn man sich totstellt.
Nichts, wie sich herausstellt. Man hört einfach auf zu existieren. Man gewöhnt sich an die Abwesenheit. Es wird still um einen. Man wird vergessen. Irgendwann ist man tatsächlich tot. Man muss es nur durchziehen. Aufhören zu essen. Aufhören ans Telefon zu gehen. Aufhören die anderen ständig mit seinen Ideen für Aktivitäten zu nerven. Man muss einfach leise sein. Keinen Pieps mehr von sich geben. Den Puls herunterfahren. Den Atem flach halten. Dann geht es irgendwann ganz von alleine. Das ist kein großer Akt. Damit lockt man niemanden hinterm Ofen vor.
Heimlich still und leise
in den Staub
Juni 2019 – Mein Vater
hat eine Tochter.
Mai 2019 – was bleibt
Was bleibt sind ein paar Texte. Die keiner habe wollte oder anders oder nur gegen Kämpfe und keines Falls gegen Geld. Ich werd das nie verstehen. Warum es nicht geklappt hat. Mit mir und der Welt. Ich finde, ich habs echt versucht.
Mai 2019 – get! over! it!
Wie lang ist es jetzt her?, fragt Ch., als ich mitten am Tag im Cafe anfange zu weinen. Was?! frage ich grob. Er antwortet nicht.
Er hat recht. Es nervt, es reicht, es dauert zu lange, warum wirds nicht besser, warum geht’s nicht weg, warum funktioniere ich nicht, warum komm ich nicht raus, warum gehts nicht weiter oder sogar los. Stop it, annoying bitch.
Juni 2019 – Schöne Grüße aus der Parallelwelt
In meinem Kopf sehe ich ein Foto. Ich bin darauf zu sehen. In einer roten Bluse. (Sehr ungewöhnliche Farbe für mich. Aber ich will schon die ganze Zeit so eine.) Neben mir ein Typ. Ich stehe, er sitzt, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, alles ein bisschen verschwommen, Wir sind nah beieinander, mein Arm liegt locker auf seiner Schulter. (Aha, er sitzt also). Ich wirke kleiner und zierlicher neben ihm, denn er ist eher dick. Weil er sitzt, bin ich etwas größer als er. Wir wirken wie ein ungleiches Paar, so eins bei dem man sich wundert, dass es eins ist. Ich gucke fröhlich in die Welt, und ein bisschen wütend, aber eher im Sinne von frech, provokant, nicht im Sinne von streng und bitterböse wie sonst. Er schaut sehr geduldig, aber wach. Er hat dunkle Haare und trägt eher dunkle Kleidung, so viel kann ich sehen. (Überhaupt hat er Haare, trägt keinen Hut und reißt nicht jedes Gespräch an sich, um es auf das Thema zu lenken, das ihn gerade interessiert, und wenn er alltägliche oder grundlegende Lebensentscheidungen trifft, dann sieht er keinen Mehrwert darin, so zu tun, als wäre ich nicht Teil seines Lebens, weil er mich ja drin haben will, in seinem Leben, und wenn die Welt böse zu mir ist, und das ist sie oft, dann sagt er, diese Arschlöcher, und nicht, das ist, weil du es falsch machst, und wenn es ihm schlecht geht, dann darf ich nett zu ihm sein, und wenn ich sage, es ist Winter in mir, und es geht mir nicht gut, dann sagt er, Ja, und legt sich neben mich oder er sagt, komm, baby, wir fahren drei Tage weg aus der Scheiße, ich lad dich ein).
Das Komische ist, dass ich auf dem Foto jung aussehe und der Typ auch (ich so etwa Ende dreißig, er so Mitte vierzig). Ich schätze also, dass das ein Foto aus meiner Parallelwelt ist, denn aus der Zukunft kann es nicht sein.
Juni 2019 – leichtes Gewicht
Ich fahre mit dem Fahrrad durch eine Überdachung am Alexanderplatz. Es ist ein lauer Sommerabend, warmer Wind weht meine Haare nach hinten. Ein leichtes Gewicht legt sich plötzlich in meinen Nacken, ich bin irritiert, fasse mit der Hand dort hin, aber da ist nichts, plötzlich fliegt eine Schwalbe im Querflug links von mir weg, irgendwie torkelnd, sie braucht einen Moment, bis sie sich gefangen hat. Saß sie in meinem Nacken? Warum? Das leichte Gewicht bleibt in meinem Körper als Erinnerung hängen.
Wochen später, ich denke immer wieder mal daran, sehe ich eine Fledermaus. Wie nach Gleichgewicht suchend schwankt sie in schnellem Flug und starkem Winkel, kaum wahrnehmbar, ein schwarzer kleiner, gegen die Dämmerung unwirklicher Schatten. Da wird mir klar, dass es eine Fledermaus war, die mir im Nacken saß. Vielleicht haben meine Haare sie irritiert oder der Wind oder meine Geschwindigkeit. Ein bisschen gruselig ist das, aber auch wunderschön. Ich mag es, dass so ein kleines Tier mich berührt hat. Als hätte es eine Verbindung aufgenommen.
Juni 2019 – lieblos
Ich wünsche mir, geliebt zu werden.
Aber nur von dir. Bei allen anderen ist es mir egal.
Mit der Lieblosigkeit leben
September 2017 – Sardinien
Die Strände sind perfekt. Flaches Wasser, unfassbar klar, sandiger Boden, kaum Wellen, fantastische Kulissen. Ich übe schwimmen. Oder besser: Ich übe, ohne Angst mit dem Kopf unter Wasser zu sein. T. hilft. Arsch hoch, Arsch hoch, brüllt er. Die Leute am Strand haben viel Spaß mit uns. Es geht richtig gut. Ich bin glücklich.
Mai 2019 – mutig, stark und schön
Frauen sind mutig! stark! schön! Lese ich auf einem Plakat.
Bullshit, kann ich da nur sagen. Sie sind feige, schwach und hässlich. Sie pupsen und scheißen, sind dumm, fies und gemein. Und sie können einen Haufen Sachen nicht. Guckt mich an. Also hört auf, mir Druck zu machen, ladies. Klar, das andere stimmt auch. Aber solange ich kein Mensch sein darf, will ich keine Frau sein.
(Natürlich muss man das Plakat im historischen Kontext sehen, aus dem es gerade wieder hervorgeholt wird, hier also die geschichtliche Einordnung. Als der Spruch entstand, 1989/90 rum, DDR, by the way, war alles noch ein bisschen anders. Es ist rührend, bzw. mutet fast tragisch an, dass man das Frauen und Männern sagen musste. Dass solche informierenden, trotzigen, tröstenden, aufmunternden, selbstermächtigenden Worte gesprochen werden mussten. Danke, dass ihr das getan habt, ladies.)
Mai 2019 – gay porn
Als ich probehalber hübsche Jungs im Inkognito Fenster eingebe, komme ich direkt zu gay porn. Und was soll ich sagen, da gibt es tatsächlich hübsche Jungs. Ab und an. Sie stehen unter Duschen oder liegen in Betten und stöhnen ganz angenehm, man sieht jede Menge Schwänze und einigermaßen verzückte Jungs-Gesichter. Oh Mann, wieso bin ich da nicht früher drauf gekommen! Eine Welt ohne weibliche Geschlechtsteile, stumm fickende Macho-Männer und nerviges Frauengestöhne! Funktioniert viel besser. Und dennoch, wieder mal alles erschreckend einfallslos. Ich dachte, ich hol mir ein paar Tipps ab, was Jungs so mögen. Aber die zuppeln auch nur son bisschen an ihren Schwänzen rum. Scheint zu reichen. Und bei den Fickszenen frage ich mich mal wieder, wieso da bis heute so ein Theater drum gemacht wird, ist doch echt das gleiche in Grün. Beine breit, bisschen rumgeleckt oder rumgefingert und dann das gute alte Rein-Raus-Spiel, auch die Stellungen sind die gleichen, von oben unten hinten links rechts. In Bezug auf Unterwürfigkeit, Dominanz, kommen sie mir allerdings schmerzfreier vor, die Videos. Das ist auch nicht immer nett. Also sowas wie: Zwei weiße Männer und ein junger Asian Boy, den sie eine Stunde lang „so richtig rannehmen“, und wahrscheinlich „gemessen am Durchschnittslohn vor Ort sehr gut dafür bezahlt“ haben, da wär mit ner Frau schon tendenziell die Grenze überschritten.
März 2019 – Sex
Das nervt mich am meisten. Dass ich jetzt keinen Sex mehr habe. Dass ich jetzt Sex mit jemand anderem haben soll, obwohl ich das gar nicht will. Dass, in dem Moment, in dem ich Sex mit jemand anderem habe, T. kriegt, was er will. Und nicht ich. Ich sitze in der Falle. Im Knast. Im Handlungsknast. Es gibt keine Freiheit, keine Eigenständigkeit, keine Unabhängigkeit. Egal was ich mache, ich machs wegen ihm gegen ihn für ihn trotz ihm ohne ihn.
Mai 2019 – Ping Pong
Ich will auf eine Veranstaltung. Aber T. könnte dort sein. Wenn T. dort ist, will ich nicht auf die Veranstaltung. Wenn T. nicht dort ist, und ich gehe nicht hin, weil er dort sein könnte, bin ich im am Ende nicht hingegangen, obwohl er gar nicht da war und ich hin wollte. Wenn ich aber hingehe und er ist da, dann geht es mir schlecht. Wenn ich nicht hingehe, gehts mir aber auch schlecht, weil mein Leben eingeschränkt und scheiße ist und ich nicht mal mehr auf Veranstaltungen gehen kann auf die ich gehen will. Es könnte auch sein, dass er nicht da ist, aber Freunde von ihm, die dann sehen, wie schlecht es mir geht. Ich hätte eine Freundin fragen können, ob sie mitkommt. Aber die kennt T. Wenn er also da ist, dann stehen wir alle voreinander herum und die einen müssen sich da hinsetzen und die anderen dorthin oder was? oder er läuft wieder davon oder ich laufe davon oder noch schlimmer, alle tun so als wär nichts, und ich muss mir sein Gesicht angucken, mit dem er so tut als wär nichts, egal was, egal wie, es bricht mir das Herz.
Am Ende gehe ich nicht hin. Sondern liege eingequetscht zwischen den hochgeklappten Tischtennisplatten in einer Garage am Rande der Stadt.
Mai 2019 – Dickpic
Ich verstehe nicht, wieso sich alle über Dickpics aufregen. Ich finde die irgendwie süß. Ich würde gerne mal eins kriegen. Dickpics sind so ein bisschen hilflos und irgendwie rührend narzisstisch. Ich meine, was sollen die Jungs denn sonst machen? Mit irgendwas müssen sies ja versuchen, also warum nicht mit was, worauf sie stolz sind und was sie echt gerne mögen? Im Grunde ist so ein Dickpic doch auch nur ein verlängertes Selfie. Und das ist wenigstens ein interessantes. Ein Dickpic erzählt uns doch eigentlich von etwas sehr Emotionalem, nämlich der großen Liebe des Mannes zu seinem Penis, diesem so freudvollen wie quälenden Objekt, das da so lebenslang identitär an ihm dranhängt und unter dessen Knute er ja irgendwie permanent steht. Da macht sich doch jemand verletzlich, mit so einem Dickpic, das wollen wir doch, und ein bisschen witzig oder manchmal ja auch wirklich attraktiv ist so ein dick doch auch, come on. Auch dieses grundlegende Missverständnis, dem Männer in Bezug auf Frauen aufsitzen, weil sie denken, es ginge um irgendwas, dabei gehts um was ganz anderes, tritt einem im Dickpic entgegen, ein ewiger Fluch, das Ganze, aber auch das finde ich irgendwie berührend. Immer wieder aufs Neue diese zarten Versuche, sich zu verständigen, eine Kommunikation herzustellen, voller Hoffnung. Please like me als please let me fuck you. Das ist doch was. Warum macht man sich darüber lustig, findet das unmöglich oder gar ekelhaft? Wenn ich jetzt anfangen würde, Vulvpics zu verschicken oder Tittpics, dann macht mich dafür keiner blöd an. Gut, wer Tittpics (ist das der offizielle Term?) verschickt, gilt als son bisschen doof, das ist dann gleich alles eher so mobbingmäßig konnotiert, Mädchen, pass auf, was du machst, da musst dich nicht wundern, wenn, der Ruf ist schnell ruiniert, und am Ende reden alle über dich als super Schlampe, Männer wie Frauen. Vulvpics – oder muss man in genauer Analogie sagen Cuntpics, fies, oder Pusspics? – würden gerade garantiert als voll feministisch durchgehen, eine Weile lang jedenfalls. Vielleicht wärs eine Überlegung wert, eine Dating App zu machen, in der man nur Dickpics mit Pusspics matcht. Dann sollen die beiden gucken, wie sie klar kommen, wenn sie sich in der Bar auf ein Bier oder auf einen Spaziergang im Park verabreden. Und wir können so lange was anderes machen.
Mai 2019 – 35a
Als ich G. (mal wieder) von meinen Ängsten erzähle, sagt er, (Kinder- und Jugendtherapeut), also ne 35a wärst du schon.
Paragraf 35a des Kinder- und Jugendhilfegesetzes besagt, dass seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, also Kinder, deren
1 seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht, und daher
2 ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist – einen Anspruch auf Eingliederungshilfe haben.
Dass ich beide Kriterien voll und ganz erfülle, muss ich hier ja wohl nicht mehr erläutern. Ich habs schon immer geahnt, gewusst, gesagt, endlich hab ichs schwarz auf weiß. Ich gehöre zu einer Edition, die limitiert ist. Oder wie P., ein alter Freund von mir mal gesagt hat, ach Elli, wir lieben dich trotz deiner Behinderung. Es gibt also einen offiziellen Paragrafen über mich, der meine Umstände näher regelt. Wenn dem so ist, frage ich mich, wieso mir eigentlich keiner hilft. Die Psychiaterin hat ihre Praxis zugemacht. Die Arzthelferin hat die AU verschlampt, was das Aus fürs Krankengeld bedeutet noch bevor es überhaupt angefangen hat. Der mühsam heraus telefonierte und stundenlang probierte Therapeut meldet sich seit fünf Wochen nicht. Weil wiederum der Gutachter der Krankenkasse sich nicht sicher ist, ob sich eine Investition da noch lohnt.
Ist mir egal. Wenigstens weiß ich jetzt, was ich bin. Ne 35a.
Mai 2019 – Treibsand
Es wird nicht besser, es wird schlechter. Ich rutsche tiefer in die Depression. Werde bewegungsloser. Verzweifelter. Abgetrennter. Kopfloser. Kampfloser. Die Angst ist laut und präsent. Ich kann nichts mehr tun.
Es tut mir leid. Es tut mir alles so leid. Entschuldigt bitte.
Mai 2019 – Rückzug
Nichtssagen
Absagen
Versagen
Lossagen
Mai 2019 – fahren
Ich nehme an einer Fahrschule für E-Scooter teil. Unser Fahrlehrer, Typ türkischer Papi, bisschen untersetzt mit Schnurrbart. Ich bin verknallt in ihn, ist klar. Er erklärt gut, ist geduldig und ein bisschen streng. Wir üben auf der Etage einer leer stehenden Hochgarage. Gas geben, Slalom fahren, vollbremsen. Er steht ganz hinten, zwischen den Hütchen, und wenn ich losfahren soll, hebt er die Hand. Das mag ich. Ich fahre auf ihn zu (nicht auf den Boden gucken, zu mir!), und bremse vor ihm zwischen den Hütchen ab. Ihm zuliebe fahre ich das nächste Mal auch ein bisschen schneller. 20 km/h. Am Ende fahren wir alle durchs ganze Haus wie die Entchen hinter ihm her.
Mai 2019 – schwimmen
Meine Schwimmlehrerin heißt Dolores. Schon deswegen bin ich verknallt in sie, ist klar. Sie ist groß und trägt einen klassischen, gut geschnittenen, schwarzen Badeanzug. Ich finde sie schön. Sogar die hässliche Schwimmbrille steht ihr. Sie bringt uns Brustschwimmen bei. Gleiten! Atmen! 1 2 34 fühnf seechs. Sie ist ruhig und geduldig und ein bisschen streng. Sie ist mit uns im Wasser und schwimmt uns vor, wie es geht. Ich könnte sie umarmen.
Mai 2019 – Typ
Schon wieder beim Einkaufen. Guckt mich ein Typ an. Dreht eine Runde. Quatscht mich an. Hallo, einen Einkaufskorb in der Hand. Ich verstehs nicht. Ich versteh nicht, was er sieht. Sieht er nicht, dass es nicht geht. Sieht er nicht, wie müde ich bin, wie alt, wie hässlich, wie verschlossen, wie krank an Leib und Seele. Kann er nicht sehen, dass hier nichts passt. Dass ich ihn nicht mag, er mich nicht mag, nicht mögen würde? Was sieht er? Kann er nicht gucken? Ich hab einen Rock an, achso. Wahrscheinlich wars das.
Mai 2019 – Die Abdeckung
Ich wache auf. Ich bin so müde, aber ich wache auf. Augenblicklich ist es da, das Brennen. Das ich nicht loswerde, so sehr ich mich anstrenge. So geht das. Jede Nacht, jeden Morgen. Wirken diese Medikamente eigentlich gar nicht?
Ich stehe auf. Ich laufe los. Erstmal laufen. Laufen.
Da vorne ist eine Polizeiabsperrung. Fußgänger dürfen vorbei. Am Ende der Straße noch mehr Polizei. Ein Krankenwagen. Ich werde langsamer. Ein LKW. „Man unterschätzt die Kreuzung leicht“, sagt eine Frau zu einem Mann in einem Hauseingang. Eine Abdeckung am Boden. Ich bleibe stehen. Ich fange an zu weinen. Ich drehe um. Ich gehe zurück, ich kann kaum noch an mich halten, ich biege ab, laufe davon, mache einen großen Bogen, um die Verletzung, den Schmerz, die Tortur, den Tod, der da vorne auf der Straße liegt.
Mai 2019 – Medikament
Man gibt mir ein Medikament gegen die Angst. Dabei brauche ich eins gegen die Liebe, die Zärtlichkeit, die Sehnsucht, das Verlangen und die Hoffnung. Das will ich alles nicht mehr haben.
Mai 2019 – 23
Noch immer hat jeder verdammte Monat einen 23.
Mai 2019 – Männer mit Bierflaschen
So sitzen sie, die Bierflasche in den Schritt geklemmt, die Hand schön dicht um den Hals der Flasche gelegt, sodass nur oben die Öffnung rausguckt. Ein Schelm wer da nicht an was denkt.
Mai 2019 – verloren gehen
Ich gehe verloren an einer Kreuzung auf einer Straße in einer Stadt, die ich kenne, ich weiß nicht, wo ich bin, es gibt keine Straßenschilder, aber ich muss dringend auf den Zug, ich komme zu spät, wenn ich den verpasse, das wird teuer, ich hab aber kein Geld, ich weiß nicht, ob ich die S-Bahn nehmen könnte, aber wo fährt die ab und wann, und reicht es dann noch,
zum Laufen ist es zu weit, es kommt kein Taxi, niemand ist hier, kein Auto, kein Fußgänger, keine Bahn, es ist zu früh am Morgen, ich gerate in Panik, ich bin völlig haltlos, tippe fahrig auf meinem Handy herum, drehe und wende mich, auf der Suche nach Orientierung, Nein, Nein, Nein, bettle ich, Nein, nein, nein, rufe eine Taxinummer an, aber die gibt es nicht mehr, bei einer anderen sagt man mir süffisant, ich sei in der falschen Stadt, ich kann mich nicht konzentrieren, nicht sortieren, denk nach, was muss man machen, denk nach, was muss man machen, in so einer Situation!
Das war letzten Oktober.
Heute kommt mir das vor wie ein Vorbote der Trennung.
Mai 2019 – Wellensittich
Ich rede mit meinem Spiegelbild. Ich schnattere und quassle, erzähle und schimpfe.
Ist halt schön, wenn jemand da ist.
Mai 2019 – In Beziehung treten
reintreten
drauftreten
nachtreten
wegtreten
Mai 2019 – republica
Drei Tage lang habe ich das erhebende Gefühl an einer breiten zivilgesellschaftlichen Zusammenkunft teilzunehmen, die ein großes Unbehagen teilt, nämlich erstens: Hier läuft was schief und zweitens: So kanns nicht weiter gehen. Andererseits ist eben auch Porsche da und Amazon und Google, die ihre tollen neuen Sachen präsentieren, während sie parallel auf der großen Bühne im Track Politics & Society kritisiert oder gar in Gedanken schon abgeschafft oder zumindest mal ordentlich durchreguliert werden. Aber das hier ist ja auch Zivilgesellschaft und nicht Linksradikalismus oder Anti-Kapitalismus. Trotzdem, Wut tut gut. Und die ist da. Politische Zeiten. Endlich.
April 2018 – Hip Hop Misogynie
Man soll die Diskriminierungen ja nicht aufrechnen, aber wieso kriegen die ihren Preis aberkannt wegen Antisemitismus und nicht schon vor Jahren wegen Misogynie? (Bang/Kollegah)
Mai 2019 – Ich bin
ein Möchtegern.
Mai 2019 – Ich laufe
ins Leere
April 2019 – Nette Männer
Neben mir im Café zwei Männer. Normalos. Sie umarmen sich zur Begrüßung. Sie haben sich länger nicht gesehen. Sie sind gute Freunde. Sie sprechen miteinander. Über ihre Frauen, ihre Jobs, ihre Kinder. Sie sind offen miteinander. Sie fragen sich um Rat. Der eine ist ein bisschen der größere Bruder, der andere der etwas Unsichere, der wissen will, was der Große denkt. Das Gespräch könnten auch zwei Frauen miteinander führen. Sie sind ungefähr so alt wie ich.
Zwei Tage später. Wieder zwei Männer neben mir, bisschen Mittemäßig-erfolgreicher, gleiches Alter, diesmal auf ein Bier. Der eine Mann erzählt von seiner Frau. Es fühlt sich gerade fremd an mit ihr. Sie ist so gestresst. Aber wie ist es denn, wenn ihr zusammen seid, fragt der andere. Damit meint er: beim Sex. So drückt er das aus. Dem anderen macht seine Tochter, Anfang zwanzig, Sorgen. Das Kind hat alles, sagt er. Die spricht jetzt schon drei Sprachen, die kann hingehen mit ihrem Studium (Medizin), wo sie will. Und dann machen die sich so fertig heute, diese jungen Frauen. Sie will keinen Badeanzug anziehen, weil sie meint, sie ist irgendwo zu fett.
Ich weiß nicht, ob ihnen zu trauen ist. In ihrer Sanftheit, Zugewandtheit, Emotionalität. Zueinander und zu den Frauen in ihrem Leben. Am Ende vögeln sie doch nur die Frau vom Freund, schauen den ganzen Tag weibliche Geschlechtsteile in Großaufnahme auf youporn und würden ihre Frauen jederzeit gegen eine eintauschen, die aussieht wie Germanys Next Topmodel auf das sie vorgeben zu schimpfen.
Vielleicht sind sie auch alle schizophren.
April 2019 – Am Tisch
Ich sitze am Tisch mit Menschen.
…
Wie eine Farbe, die fehlt.
April 2019 – Das junge Paar
Hinter mir im Café, ein Paar. Jung, 18, 19, noch halbe Teenager. Sie streiten sich.
Sie will nicht, dass seine Ex-Freundin zuguckt, wenn er Basketball spielt. Er weiß nicht, was er da machen kann, denn die Ex-Freundin is ja nich wegen ihm da, sondern wegen einem gemeinsamen Freund. Und, es ist ja nun mal sein Verein. Aber warum bist du überhaupt da hingegangen, es gibt doch viele Vereine, wo man Basketballspielen kann, sagt sie. Er hat eben über den Kumpel gehört, dass der Trainer da am besten ist. Sie findet, es liegt in seiner Verantwortung, das zu organisieren, dass sie der Ex nicht begegnet. Weiß er, wie sie sich da fühlt, wenn die da rum sitzt? Denkt er, das ist normal? Aber er hat die doch nicht eingeladen, da rumzusitzen!, verteidigt er sich, er macht das ja nicht mit Absicht, so: Hey, ich spiel heute, kommst du. Es ist deine Aufgabe, das zu klären, sagt sie. Du willst auch nicht, dass mein Ex Freund irgendwo rumsitzt.
Irgendwann wird seine Anspannung zu groß und er steht genervt auf. Läuft den Gang runter, knallt die leere Kaffeetasse auf die Ablage. Dann kommt er zurück. Setzt sich. Und fängt an zu weinen. Hey, sagt sie, geht zu ihm, setzt sich ihm auf den Schoß, tröstet ihn. Sie flüstern, küssen sich, lachen.
Ich staune.
Ich frage mich, wie die Situation bei mir und T. abgelaufen wäre.
Vollkommen anders.
Ich hätte das nicht verlangt.
Er hätte nicht geweint.
April 2019 – in der U8
„Bruder“ steht auf dem Handy-Display des etwa 10jährigen Jungen neben mir. Er geht dran. „Wirf schon mal die Playstation an“, sagt er, „ich bin gleich Hermannplatz“. Es ist Dienstagmorgen um kurz vor 9.
April 2019 – Lächeln
Vor dem Eingang zur Bank immer der Typ mit Hund. „Bringst du uns einen Groschen mit, oder ein nettes Lächeln?“ Jedes Mal wenn er das sagt (und er sagt es jedes Mal) merke ich, dass ich krass genervt bin. Für diesen Claim könnte ich ihn treten. Warum?
Dass er da sitzt und schnorrt, stört mich nicht. Auch nicht, dass er seinen Spruch gefunden hat, jeder von uns muss heute gucken, wie er‘s macht, mit dem Marketing. Was mich aggro macht, ist die Sache mit dem Lächeln. – Gut, der Groschen nervt auch, der kommt so ein bisschen treuherzig, Mittelaltermarktmäßig rüber, überhaupt der ganze Typ und sein Setting so ein bisschen schnuffig, harmlos-provinziell, die Ansage immer so mit dem Blick von unten nach oben vorgetragen, mit leicht schief gelegtem Kopf vom harten, kalten Boden hoch, auf der Decke die versorgende Hundeschale, der Hund daneben gerollt. Aber das ist es nicht. Es ist das Lächeln, das er haben will. Wenigstens das! Ich meine, wer bin ich, seine Tanzmaus? seine Lächel-Prostituierte? Ich kann gucken wie ich will, es geht ihn einen feuchten Dreck an, ob ich einen guten Tag habe oder einen schlechten, ob ich miese Laune habe oder die beste, er muss mir auch nicht unterjubeln, dass die Welt aus meiner Sicht doch lächelnswert sein muss, dass mein sauertöpfisches Gesicht unangebracht ist, wo doch sogar er, der auf der Straße lebt, einen so lustigen Spruch drauf hat, was hat der Typ für eine Ahnung von mir und meiner Welt, glaubt er etwa, nur ihm geht’s scheiße, und alle anderen haben Grund zu lächeln, mein Lächeln gehört mir, „Gib mir was“, ist was anderes als „sei was“, Geld, das ist der Rhythmus bei dem jeder mit muss, okay, aber seinen Lächel-Porno, den kann er sich bei youtube runterladen, und vor allem: Sagt er das nur bei Frauen? Bittet er Männer um ein Lächeln? I doubt it!
Bei mir hat er seinen Groschen jedenfalls verkackt.
April 2019 – Untersuchungsgegenstand
Ich bin mir selbst ein ständiger Untersuchungsgegenstand. Seit ich denken kann, versuche ich, mich zu verstehen.
Durch Texte und Therapien, Spiegel und Menschen, Rasierklingen und Selfies. Ich finde mich wirklich wahnsinnig interessant.
Begreifen aber, tu ich mich nicht.
April 2019 – Einbleuen
Eine Songzeile trifft mich.
Let me go
I dont wanna be your hero
Das singe ich in den folgenden Tagen ungefähr 20.000 Mal.
Um mir’s einzubleuen.
April 2019 – Gewinner
Neukölln. Ein Typ kommt ins Cafe. Er ist total aufgeregt, freut sich tierisch, gibt dem Mann hinterm Tresen ein fettes Trinkgeld auf seinen Cappuccino to go, strahlt, und verkündet laut:
Ich hab im Lotto gewonnen!
Ich hab absolut noch nie was gewonnen!
Alle drehen sich um. Der Gast neben mir: Na, dann haste den Ferrari ja schon bestellt. Das nicht, sagt der Typ, es sind 4000 Euro.
Ich weiß nicht warum, aber augenblicklich stellt sich bei allen Anwesenden, auch mir, Enttäuschung ein. (Achso, 4000 Euro… Ein Tropfen auf den heißen Stein.)
Der Typ aber verlässt überglücklich den Laden.
April 2019 – Begriff
In einem Artikel finde ich einen Begriff für das, was T. macht:
Ghosting.
März 2019 – Die gefährliche Frau
Ch. erzählt mir zweimal von irgendwelchen Typen. Der fand dich nett, sagt er vom einen. Mit dem würdest du dich bestimmt gut verstehen, sagt er über den anderen. Aber, schiebt er schnell hinterher, fang nichts mit dem an, der eine ist ja mit der und der zusammen, und bei dem anderen kriselt’s gerade und er kriegt ein Kind.
Was, frage ich ihn, bin ich jetzt plötzlich die gefährliche Frau, oder was? Jetzt wo ich keinen Deckel mehr auf dem Topf hab?
(Schön wärs.)
März 2019 – Das Weinen in der Stadt
Ich steige in die U-Bahn, irgendwo spielt jemand Gitarre. Neben mir sitzt eine Frau, Anfang 40. Sie weint. Nicht laut, die Tränen laufen ihr einfach runter, sie schnieft. Ich krame in meiner Papiertüte nach einem Taschentuch. Ich hab kein Taschentuch. Nur zwei absurde Rollen Klopapier, weil die auf der Party, zu der ich unterwegs bin, ausgegangen sind. Ich höre auf, zu kramen. Die Musik ist vorbei, jetzt plappert ein Kind. Die Frau weint weiter. Gleichbleibend, gleichmäßig. Ich hab kein Taschentuch, sage ich zu ihr, nur Klopapier, wenn Sie wollen. Sie schüttelt den Kopf. Ist schon gut, sagt sie.
Ich steige in die U-Bahn, irgendwo spielt jemand Gitarre. Neben mir sitzt eine Frau. Sie weint. Nicht laut, die Tränen laufen ihr runter, sie schnieft. Ich krame in der Papiertüte, die zwischen meinen Füßen steht, nach einem Taschentuch. Ich hab kein Taschentuch. Nur zwei absurde Rollen Klopapier, weil die auf der Party, zu der ich unterwegs bin, ausgegangen sind. Die Musik hat aufgehört, jetzt plappert ein Kind. Sie weint weiter. Gleichbleibend, gleichmäßig. Ich wende mich ihr zu. Ich hab kein Taschentuch, sage ich, nur Klopapier, wenn Sie wollen. Sie schüttelt den Kopf. Ist schon gut, sagt sie.
Tut mir Leid, sage ich.
Sie nickt.
Dann steigen wir aus,
laufen auf dem umtriebigen U-Bahnhof auseinander.
Ich stelle mir vor, wie sie immer weiter weint, auf den Straßen und den Plätzen, in den Bussen und den Bars, in den Wohnungen und über den Dächern.
Sie ist das Weinen in der Stadt.
März 2019 – Hat sie was drauf?
Im M29er nach Neukölln eine Gruppe Jungs, so zwischen 17 und 22, wohl auf dem Weg nach Hause. Ein Diggar is dabei, er macht dreimal den gleichen Witz: Guten Tag, die Fahrausweise bitte. Die anderen lachen auch schon nicht mehr. Sie hören Hip Hop auf dem Handy, singen ein bisschen mit, ganz süß eigentlich, der Digge singt am lautesten, scheint ne echte Hymne zu sein, auf dem Bildschirm Autos und twerkende Frauenärsche, irgendwie lustig, wie die Typen im Video fast verzweifelt versuchen, hinter den Ärschen, unter denen sie begraben liegen, noch in die Kamera zu gucken. Die Jungs reden einen Mix aus Deutsch und Arabisch, letzteres immer dann, so mein Eindruck, wenn es schnell oder präzise gehen soll, oder wenn sie diskret sein wollen, also nicht wollen, dass die Umgebung versteht, was sie sagen. Über Frauen quatschen sie auch, stört sie nicht, dass ich daneben sitze, bin ja auch keine Frau, sondern eine Mutti. Hast du sie? fragt der eine den anderen. Der andere murmelt irgendwas Knappes. Und, hat sie was drauf? fragt der erste weiter. Wieder kommt die Antwort abweisend und auf Arabisch. Nein, komm, sag mal, insistiert der erste: Hat sie was drauf? Der andere guckt genervt, spielt sein Handyspiel weiter. Ist sie gekommen? fragt der erste. Keine Reaktion. Sag, ist sie gekommen? nervt er weiter und als nun gar nichts mehr kommt, nervt er jemand anderen.
Ist sie gekommen! Spontan und überschwänglich verbuche ich das als ganz großen Erfolg der Frauenbewegung, dass der Orgasmus der Frau hier, in diesem Jungs-Teenager-Milieu, a überhaupt bekannt, und b ein Kriterium ist, das in die Bewertung der sexuellen Potenz des Mannes beim Prahlen im Kreise anderer Männer relevant ist. Woran man sich halt so klammert, angesichts der traurigen Gesamtgemengelage. Twerk, twerk, bitches
März 2019 – Die eigentliche Tragödie
Eine Frau erzählt mir, dass sie in ihrer Kindheit sexuell missbraucht wurde. Die Geschichte wird schlimm und schlimmer, und am Ende geht es um einen Suizidversuch, den sie nur knapp überlebt hat.
Ich merke, wie ich überfordert bin. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich kann nicht wirklich begreifen, was sie empfindet, wie sie sich fühlt, ich weiß es nicht, es ist so viel, zu viel, es ist mehr und anders als alles was ich kenne, ich merke, wie ich mich entferne, mich innerlich ausklinke und versuche, das zu verhindern, aber es geschieht, und ich beobachte das, und weiß: Das ist die eigentliche Tragödie. Sie ist damit alleine. Auf ewig. Und sie weiß es.
März 2019 – Eheringe
Kapier ich nicht. Zu laut, zu dick, zu breit sitzen sie plötzlich immer öfter auf den Fingern meiner Freunde. Sehen absurd aus, da, Fremdkörper im Handgemenge.
Menschen mit Geschmack tragen plötzlich Ringe aus Gold, die ihnen die Finger zur Wurst quetschen, die nicht zum Teint ihrer Haut passen oder zu ihrer sonstigen Kleidung. Diese Ringe sollen einem irgendwas sagen. Irgendwas, was man gar nicht wissen will, was einen nichts angeht.
Da gibt dir jemand Feuer oder reicht dir ne Kaffeetasse oder streicht Krümel auf dem Tisch zusammen – und jedes Mal: a glimpse of it. Der Ring, der Ring. Ihr Gollums. Jedes Mal bleibt man für ne Millisekunde dran hängen, an diesen Wichtigtuern. Ständig komm ich aus dem Takt, vom kurzen Goldgeblitze, und denke, was wollt ihr von mir, lasst mich doch in Ruhe damit. Schmuck ist Schmuck, der blitzt auch mal, den kann man hässlich finden oder schön oder egal. Aber ein Ehering ist ein Ehering, oh ein Ehering.
Ich verstehe, dass man auf die Idee kommt, zu heiraten. Ich verstehe, dass man sich signalisieren will, dass man füreinander da ist, dass das, was man miteinander hat, was Wichtiges, ernst zu nehmendes ist. Ich verstehe, dass man Verantwortung übernehmen will, auch über eine Trennung oder den Tod hinaus. Aber muss ich dieses Privatzeug ständig unter die Nase gehalten bekommen? Könnt ihr die Ringe nicht einfach in die Schublade packen, dahin wo das Testament liegt, oder sie an die Patientenverfügung tackern oder unter die Lebensversicherung legen oder zwischen die Reizwäsche oder auf den Ausdruck des Dating-Profils wegen dem ihr euch kennen gelernt habt? Oder nehmt doch wenigstens Ringe, die das für euch bedeuten, was sie für euch bedeuten sollen, denen man das aber nicht dauernd ansieht.
März 2019 – Kopfbedeckung
Eine Lehrerin erzählt mir, dass in ihrer Grundschule Kopfbedeckungsverbot gilt. Das finde ich brillant: Einfach niemand darf was auf dem Kopf tragen, keine Mütze, kein Basecap, kein Kopftuch.
März 2019 – Rasierklinge
Wenn ich nur eine Rasierklinge hätte, und ihn rausschneiden könnte, feinsäuberlich wie ein Chirurg, aus den Fugen und Ecken meiner Erinnerung, den Winkeln und Zotten meines Körpers, den Nervenbahnen und Adern meiner Gedanken, wenn ich ihn abschaben, abtragen könnte, mit Präzision, und ihn in eine Blechschale werfen, und sie der Schwester reichen könnte, die damit tut, was damit zu tun ist, dann, ja dann,
Würde ich es tun?
März 2019 – 68
Morgens in der betahaus-Kantine. Ein Mann, Anfang 70, weiße Haare, wache Augen, spricht mich vom Nebentisch aus an. Ob ich wüsste, was das hier ist. Meine freundliche, aber knappe Antwort (Coworking-Space, Kantine), nimmt er als Startrampe für das, was er eigentlich will: Mich zutexten. Einen Moment überlege ich noch, ob ich die Sache abwürge, aber dann denke ich, lassma laufen, vielleicht kommt ja was bei raus.
Innerhalb kürzester Zeit weiß ich Bescheid. Bescheid darüber, dass er Bescheid weiß. Er hat als Unternehmensberater gearbeitet, für die ganz großen Firmen, als Politikberater, für die ganz großen Namen (Stichwort F. Merz), er weiß, wies läuft – mit der Ungleichheit, den Steuererleichterungen für Superreiche und Konzerne, was bei Anne will aber wieder keiner sagt, was er schon komisch findet, als wüsste das niemand, wir haben ein Problem hier in Deutschland, ich muss wissen, er ist ein Alt-68er, zwei Jahre Studentenparlament, aus dieser Generation kommt er, die Frauenfrage ist wichtig, einen Ehevertrag sollte jede machen, da muss man genau auflisten, wieviel sie für jedes Kind bekommt, wenn er geht, sonst steht sie am Ende da, und was ich denn so mache, aha, und ob ich denn am Ende meiner Verträge auf eine fünfstellige Summe komme, aha, und was denn so ein Tagesticket im Co-Working hier kostet, aha, und dass seine Tochter demnächst-Richterin ist, und sein Sohn Unternehmensberater in der Schweiz.
Wie oft ist mir das jetzt schon passiert, mit den Männern dieser Generation. Mansplaining und Ego-Monologe, Erfolg und Geld und Selbstverständnis, hinter den Augen tickt der Taschenrechner, (dass ich ein Loser bin, hat er sofort durchschaut), aber das Studentenparlament, das muss erwähnt werden, das Alt-68er-Etikett, das signalisieren soll, dass sie das Herz eigentlich links tragen, dass sie im Grunde dieses Herzens wilde Rebellen sind, die das System durchschauen, dass sie die Frauenfrage immer mitdenken, besonders dann, wenn sie Frauen im Cafe ansprechen.
Fuck you, denke ich am Ende. Geld bis an die Haarkante, mit den Merzens auf Du und Du, die Panama Papers nicht verhindert, den ganzen kapitalistischen Schwachsinn bei vollem Bewusstsein mit betrieben, irgendwelche Werte behauptet und gegen sie gelebt, die Frauen aktiv und strukturell ausgebootet, die Affären ideologisch legitimiert, auch noch die Kinder infiziert, mit Erfolg und Geld und Status – 68 my ass.
Da ist mir so ein Merz doch lieber, der würde nie auf die Idee kommen, seinen neoliberalen Ego-Faschismus als was Gutes zu verkaufen. Nicht wie diese hochetablierte, verlogene 68er-Männer-Karriere-Bande. Wenn mir nochmal einer dieser weißhaarigen Volltexter seine zwei Jahre Studentenparlament unter die Nase hält, als wär‘s ein Gütesiegel für Anstand und Wohlerzogenheit, dann raste ich aus.
Verräterschweine.
März 2019 – Hund oder Katze
Wenn ich je auf die Idee komme, mir einen Hund oder eine Katze anzuschaffen, erschieß mich bitte, sage ich zu J.
Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, sich einen Hund oder eine Katze anzuschaffen? sagt die Psychiaterin.
Gut, erschieß ich halt die Psychiaterin.
Wie übrigens jeden, der mir sowas nochmal vorschlägt, bevor ich 83 bin.
März 2019 – Der Melle-Automat
Gehe mit G. Uncanny Valley schauen, von Thomas Melle, im Haus der Berliner Festspiele.
Am Ende sind es die Menschen, die ich uncanny finde,
die aufstehen, und nach vorne treten, zuerst vorsichtig, dann immer forscher,
um die Maschine zu begutachten, die ihnen eben noch ihre Lebensgeschichte erzählt hat, die sich bewegt, in den letzten Zügen des Programms, von dem sie in der letzten Stunde bestimmt war,
um sie zu fotografieren, zu filmen, ihr in den offenen Körper zu schauen, in ihr Gehirn, in ihre Eingeweide,
obszön kommt es mir vor, sich so auf die Kreatur zu stürzen.
Ein Rest respektvoller Distanz bleibt, schließlich hat der Automat das Gesicht und den ungefähren Körper von Melle, aber wer weiß, was wäre, wenn das Absperrband und der Techniker nicht da wären, die über ihn wachen wie Body Guards über eine Celebrity, zu was für einer Meute das geneigte Publikum werden könnte.
Ich brauche einen Moment, bis ich mich traue, näher zu treten, ein Foto zu machen, ich schäme mich dafür, aber auch ich bin begierig, das abzubilden, zu dokumentieren, wie einst ein Jahrmarktbesucher die bärtige Frau oder den einäugigen Riesen. Gleichzeitig klopft die Aufklärung in mir, mit strenger Stimme, die Wissenschaft, die Ratio, und schon wieder schäme ich mich. Diesmal dafür, dass ich Mitleid empfinde, mich mit Respekt nähere, einem Objekt aus Kabeln und Elektroden und Motoren, einem Apparat, den man in eine täuschend echt wirkende Puppe gesteckt hat. Denn KI ist das nicht.
März 2019 – Ich sehe was, was du nicht siehst
Ich bin in einer Bar. Die Tür geht auf, ich schaue nach links, da steht er. Ich sehe ihn an, er mich, in einem Bruchteil von Sekunden kommunizieren wir: Shit, du hier, sorry, klar, ich gehe. Er dreht sich um und ist weg.
Ich bleibe zurück. Neben mir stehen unsere gemeinsamen Freunde. Es ist so schnell gegangen, dass niemand etwas bemerkt hat.
Das ist doch irre. Ich sehe ihn an, quer durch den Raum, sehe seine Statur, seine Silhouette, seine Kleidung, sein Gesicht, und ich will nichts anderes, als dass er auf mich zugeht, und wir uns zur Begrüßung küssen, und anfangen zu reden, miteinander und mit unseren Freunden, und dass wir trinken, und tanzen, und später zu ihm gehen und miteinander schlafen. Ich erlebe, wie wir uns verständigen, über Meter hinweg, im Halbdunkeln, nur mit unseren Gesichtern, und es kommt mir so dumm vor, so idiotisch, so falsch und so ultra-bescheuert, dass das nicht passiert, dass das nicht passieren darf, und ich denke: Was willst du denn, wir sind doch super zusammen, wie konntest du das in die Tonne treten?!
Das ist das, was ich sehe.
Was er sieht, ist Folgendes:
Scheiße, jetzt ist die hier, ach, mit denen auch noch, und ich bin mit V. hier verabredet, bloß weg hier, wie mach ich das jetzt, schick ich V. ne sms, geh ich halt ins Berghain, wie alt sie aussah, und fertig, hab ich gar nicht mehr so in Erinnerung, ist doch gut, sie geht aus, wie richtig sich das anfühlt, puh, weg von ihr, frei, befreit, bin ich froh, viel zu lange, drauf festgehangen, ja, lass mal ins Berghain, vielleicht geht K. ja noch mit, die texte ich jetzt mal an.
März 2019 – M.
Man reicht M. das Telefon.
M.: Ja?
E: Hallo, M. Hier ist Elli.
M: Ja, wer sind Sie? Ich kenne Sie ja nicht.
Soweit sind wir jetzt.
Waren wir aber im Grunde schon immer.
März 2019 – Angela Schanelec, Ich war
Ich war zuhause, aber
Nervig und schön, wie immer.
Dem Theater nahe, mit seiner Sprache, der hölzernen Natürlichkeit seiner Dialoge. Nein, so würde niemand das sagen. Aber sie sagt es so. Die Schauspielerin als Box.
Das Kehlkopfmikrofon. Was macht das mit Vertrauen und Vertrautheit.
Hamlet, der König – schön, aufrecht und gerade, ein Junge noch, ein Mann schon, der den Kudamm herunterläuft, – warum sollte ich dieses Bild je vergessen.
Der Dialog mit dem Filmemacher, dem es so Leid tut, dass er ihr nichts Besseres bieten konnte. Der echte Körper und der Versuch, echt zu sein, also zu lügen. Diese Unverschämtheit, die da aufeinander gebracht werden soll. Ich kann ihre Empörung nachvollziehen.
Die Frau, die über ihren Auftrag spricht, einsam zu sein.
Die Kinder, die den Tieren noch ähnlich sind. Die Tiere, die tun was sie tun, sie sind ja Tiere. Die Kinder, die durch das Theater etwas bekommen, was sie längst sind und wir nicht ahnen.
März 2019 – dm
Ich steh vor einem Regal und guck Verpackungen. Spricht mich ein Typ von der Seite an, Mitte 50, weiße Haare, Brille, und sagt: Entschuldigen Sie, ich finde, Sie sind attraktiv, hätten Sie vielleicht Interesse mit mir einen Kaffee trinken zu gehen? Oh, sage ich, und werde rot wie eine 13jährige, das ist sehr schmeichelhaft, aber ich hab leider einen Freund. Als er um die Kurve ist, guck ich wieder Verpackungen, aber diesmal seh ich nichts.
Das ist, weil ich weine.
Ich weine, weil es eine Lüge ist, dass ich einen Freund habe.
Ich weine, weil die Lüge vor kurzem noch die Wahrheit war.
Ich weine, weil er seinen Mut zusammen genommen hat.
Ich weine, weil ich ihn nicht attraktiv finde.
Ich weine, weil ich versucht habe, nett zu ihm zu sein.
Ich weine, weil er einsam ist, wie Tausende andere.
Ich weine, weil ich wie Tausende andere bin.
Ich weine, weil es so schwer ist, jemanden zu finden, der zu einem passt.
Ich weine, weil ich das hatte und das vorbei ist.
Ich weine, weil das Spiel, das gespielt werden muss, eines von Hoffnung und Zurückweisung ist, bis in alle Ewigkeit Amen.
Ich weine, weil er mich gesiezt hat.
Ich weine, weil das jetzt meine Welt ist.
Ich weine, weil ich vor dem Gesundheitsregal stehe.
Ich weine, weil zwei Regale weiter eine junge Frau vor den Kondomen steht.
Ich weine, weil ich keine Freude daran habe, dass mich jemand angesprochen hat.
Ich weine, weil mir das Neue nicht aufregend, sondern abgestanden und mühsam erscheint.
Ich weine, weil es T. ganz anders geht.
Ich weine, weil ich gern mal wieder Sex hätte.
Ich weine, weil ich nicht weiß, wie das jemals gehen soll,
ohne zu weinen.
März 2019 – Rossmann
Ich steh vor einem Regal und guck Verpackungen. Ein junger Typ kommt rein, schlurfig-polyamourös, wir sind im Friedrichshain. Er telefoniert. „..echt, ah, okay – soll ich dir was mitbringen, was denn, achja, du nimmst ja immer diese Binden, echt, ernsthaft, bist du sicher, diese fetten Damenbinden, die gehen ja gar nicht, hab ich dir das schon mal gesagt, eigentlich, dass die voll peinlich sind, doch, nee, echt, die gehen nicht.“
So ist das. Die boys und die girls und die girls und die boys und alles löst sich auf und dann denken die boys am Ende, sie können sich im Namen der sisterhood und der allgemeinen Sex-Intimitäts-und-Gender-Körper-Öffnung in die Hygieneartikelentscheidungen ihrer aktuell besten Freundin mit benefits einmischen und dabei gleich noch ein bisschen peer-styling-pressure im Zyklusbereich aufbauen.
Der kleine Blödmann.
März 2019 – DHM: Europa und das Mittelmeer
Eine einzige brutale Durchsetzungsgeschichte des Kapitalismus. Erwähnt hier aber niemand direkt. Kann man alles schön ablesen, wie aus dem Lehrbuch: Kolonialismus, Rassismus, Nationalismus, Innovation, Missionierung, Modernisierung. Im Namen des Marktes, Amen. Ein einziger Rausch. Ein Siegeszug für die einen auf den Rücken der anderen.
März 2019 – Kurvendiskussion 2
Die Psychiaterin malt erneut die Achsen auf, den Zettel verkehrt herum, so dass ich sehen kann. Sie zeichnet die Parallele zur X-Achse – den gefühlten Normalzustand. Dann malt sie drei Kreise ein.
Psychot.
Zwangs
Neurot., A, Dep
Steht da drin.
Wenn der Boden nicht mehr hält, und wir einbrechen, und wir den Fuß vielleicht sogar mal eine Zeit lang nicht mehr rauskriegen, dann können wir auf diese drei Arten und Weisen reagieren. Das hier, sie tippt mit dem Kuli auf das Zwanghafte in der Mitte, ist vielleicht nicht oder am Wenigsten ihr`s, das hier, das kennen sie gut, sie deutet auf die Ängste und Depressionen, und das hier, der Kuli landet auf dem psychotischen P, das in dem Kreis ganz links sitzt, und mir Angst macht, das ist eine der drei Reaktionsmöglichkeiten. Sie hatten das Gefühl, dass etwas nicht stimmt, das bedeutet, sie haben ein Bewusstsein dafür, dass sie in diesen Bereich hineingeraten sind. Jemand der wirklich psychotisch ist, weiß das nicht mehr. Ich möchte, dass sie verstehen, dass das ihre Art ist, auf die Situation zu reagieren. Sie denken, dass die anderen, die, die für sie da sind, und da sein wollen, böse sind, sein könnten. Das ist angesichts dessen, was sie erlebt haben, kein Wunder.
Ich nicke und nicke, unter Tränen, während sie spricht, dankbar.
Witzig wie gut man mich auf dieser rationalen Ebene erreicht.
März 2019 – Rohes Stück Fleisch
Ich hetze über den Alexanderplatz und bin mir sicher, dass die Frau, die an mir vorbei läuft, meinen Namen sagt. Ich schaue sie an, beobachte sie, aber es war wohl doch etwas anderes. Die Musik ist sehr laut und die Lichter auch. Ich bekomme Angst. Hier stimmt was nicht. Ich schaue auf die Münder der anderen Leute. Viel Zeit hab ich nicht, ich muss über den Platz laufen wie eine Irre. Soeben habe ich C. am Telefon angeschrien. Ich kann mich nicht erinnern, sie jemals angeschrien zu haben. Aber sie hat mich verraten und ich bin verzweifelt und sie begreift nichts. Gar nichts. Sie begreift nicht, wie ungeschützt ich bin, dass ich ein rohes Stück Fleisch bin, das auf dem Tisch liegt, und sie mir noch das Laken wegzieht, mir das letzte bisschen Distanz raubt, das letzte Stück schützenden Raum, den es zwischen mir und der Psychiaterin gegeben hat, die ich so dringend brauche, und von der sie mir im Plauderton erzählt, dass sie gerade mit ihr Pizza isst und sie beim Vornamen nennt.
Ich bin in einem solchen Aufruhr, ich weiß nicht, wohin ich mich drehen und wenden soll, ich denke zwei Schritte, dann stoppe ich ab. Ich erreiche Ch. Bitte, sage ich zu ihm, sprich mit mir. Erzähl mir was, sage ich. Was du gegessen hast, was du heute gemacht hast, was du gerade siehst. Komm jetzt hierher, sagt er, es gibt Essen. Ich bin mir nicht sicher, ich tobe weiter, jage zurück nach Hause,
dann doch noch dorthin.
Man setzt mich an einen Tisch. Es gibt Essen. Irgendjemand redet was. Auch ich. Kamillentee.
März 2019 – böse
Nachts schrecke ich hoch. Ich sehe die Gesichter der Menschen aus meinem Umfeld.
Was, wenn alle, von denen ich denke, dass sie gut sind,
böse sind.
Am nächsten Tag gehe ich zur Psychiaterin.
März 2019 – Die Kapsel
Die Kapsel ist klein und schmal. In Größe und Form ähnelt sie einem Zäpfchen. Sie ist aus einem silbern glänzenden, futuristischen Material. Ihre Oberfläche ist glatt, sie selbst ist hart.
Ich werde die Kapsel zwischen Daumen und Zeigefinger nehmen und in meinem Schlund versenken, tief und tiefer, bis sie dort sitzt, wo sie sitzen soll, etwas oberhalb des Magens, in der Nähe des Zwerchfells. Dort wird sie liegen, die nächsten Jahre. Ich werde wissen, dass sie da ist. Ich werde oft an sie denken. Spüren werde ich sie nur manchmal, bei bestimmten Bewegungen: ein Stechen, ein Ziepen.
Wie sich das Material verhalten wird, das weiß ich nicht, niemand weiß das, dazu ist es zu futuristisch, eine neuartige High-Tech-Entwicklung aus dem Weltall. Vielleicht wird sie sich auflösen, die Kapsel, sich abtragen, sanft, Partikelchen für Partikelchen, bis nichts mehr übrig ist, rückständefrei. Vielleicht auch nicht. Vielleicht korrodiert sie auch oder verrutscht ungünstig und liegt dann quer oder ihre Außenhaut wird porös, und das Innere tritt aus, verteilt sich in die Umgebung. Möglicherweise bleibt sie genau so wie sie ist, bleibt dort, an Ort und Stelle. Auf ewig. Oder sie verbindet sich mit ihrer Umgebung, verwächst mit ihr, bis zur Unkenntlichkeit. Aber das weiß ich nicht. Das weiß niemand.
März 2019 – Zigarettenlänge
ZWieso sind Zigaretten eigentlich genau so lang wie sie lang sind?
Die Norm-Zigarette, wer hat sie erfunden, wer hat das entschieden, warum hat sich niemand dagegen gewehrt?
Ich rauche zu viel.
März 2019 – Kurvendiskussion 1
Die Psychiaterin malt mir eine Kurve auf.
Parallel zur x-Achse, ungefähr 10 Zentimeter oberhalb von ihr, läuft eine gerade Linie. Das, sagt sie, ist ihr gefühlter Normalzustand.
Sie zeichnet eine Kurve in den Bereich zwischen der Normallinie und der x-Achse. Die Kurve ist eng, geht hoch und runter und auch ganz weit runter, dann wird sie ganz langsam weiter, flacher.
Die Psychiaterin tippt mit dem Kuli auf das Ende der x-Achse ganz rechts: Gehen Sie hier von einem Zeitraum von zwei Jahren aus.
Und Sie, sagt sie, und kritzelt einen kleinen dicken Strich, ganz links, an den Anfang der x-Achse, kaum einen Zentimeter von der y-Achse entfernt,
sind gerade mal hier.
Zwei Jahre, sage ich.
Und denke: Wenns reicht.
Durch das Geheule hindurch schau ich sie an. Meinen Strohhalm, meinen Hoffnungsträger.
Das muss schneller gehen,
sage ich.
März 2019 – Schmerzen
Man sollte ja meinen, dass man toleranter wird, den Schmerzen gegenüber. Dass man weiß, die kommen und gehen, und gehen und kommen, und man kann sie vergessen oder betäuben oder über sie drüber leben oder sie bis zur Unkenntlichkeit ignorieren. Ich werde intoleranter, den Schmerzen gegenüber. Schon wenn sie sich nähern, wenn sie im Anflug sind, gerate ich in Panik. Ich will wegrennen, sie abschütteln, noch bevor sie da sind. Ich will nicht, dass sie mich einholen, mich berühren, sich niederlassen auf mir, sich ausbreiten in mir, denn ich halte sie nicht mehr aus.
Ich halte sie. Nicht mehr. Aus.
Ich habe genug von ihnen. Ich habe nicht um sie gebeten, ich habe sie nicht eingeladen, ich wollte sie nicht haben, man hat sie mir aufgezwungen, soll doch jemand anders sie nehmen, mir reicht‘s.
Das sind die Momente, in denen ich mir nicht mehr traue, über den Weg. Ich könnte einen Fuß auf die Straße setzen, jetzt, wo da vorne gerade der LKW kommt. Ich könnte ihm wehtun, dem Schmerz, ihm beikommen, mit den Dingen, die mich und meine Gedanken erschrecken, Messer, Zigaretten, Nagelscheren.
Dann hätte wenigstens ich ihn eingeladen und nicht jemand anderes.
März 2019 – Ticken
Ich ticke T. T. T. T. T. T. T.
Tag und Nacht, Stunde um Stunde: T. T. T. T. T. T. T.
Und meine scheiß Batterie geht nicht alle.
März 2019 – Liebe für dich
In mir ein kleines Tier.
Weich und warm und wollig. Manchmal ein bisschen zerzaust.
Und ich soll jetzt draufschlagen, damit es endlich tot geht.
Was macht das für einen Sinn.
März 2019 – P.
Wissen Sie, sagt die Psychiaterin, wir gehen immer davon aus, dass das nicht so schlimm ist, weil die Leute sich heute andauernd trennen. Aber man kann davon ausgehen, dass Trennungen dieselben traumatischen Auswirkungen auf Körper und Seele haben wie ein Trauerfall. Sie haben jemanden verloren. Mit dem sie zudem noch sehr lange zusammen waren. Sie dürfen traurig sein. Das ist eine Zäsur in ihrem Leben.
Ich weine vor Erleichterung.
März 2019 – Fieberkurve (Nachtrag)
Als hätte man mir den Arm amputiert.
Als hätte ich mein Zuhause verloren.
Auf und ab im Panikkäfig. Niemand ist da. Alle sind weg. C. nimmt ab, völlig überraschend. Holt mich zu sich. Packt mich ins Bett. Irgendwo muss ein Baum geschmückt werden.
TAVOR, der Tapir. Er legt sich zu mir, umarmt mich mit seinem glatten, nackten Körper, legt seinen weichen Rüssel um meinen Hals.
Als die Familie kommt, haue ich ab.
Ich laufe und laufe.
Wohin weiß ich nicht.
Dann komme ich wieder. Es gibt Kamillentee und Wärmflasche. Das bleibt so in den nächsten Wochen. Kartoffeln müssen geschält werden.
Nie wieder wird irgendetwas so sein wie es war.
Der Schlag ist zu hart ausgeführt. Warum Brandrodung, kann man nicht gemeinsam das Haus verlassen. Entwertung. Auslöschung – ein Versuch, T. Bernhard.
Wenn nur endlich der 1.Januar und diese verdammte Zwischenzeit vorbei wäre.
Oh, schon halb vier! Wieder zwei Stunden abgehakt auf der Knastliste. Ein Entlassungstermin ist nicht in Sicht.
Ich esse nichts. Nein, meine Suppe ess ich nicht.
Im Bauch ist Angst, da passt kein Blatt. (Salat).
Ein Fremder willst du sein. Mit aller Gewalt.
Bei dir: Freiheit, Perspektive, Abenteuer. Ich kratz mich vom Boden auf.
Ein Stück Dreck, ein Hund.
He dumped me.
Ch. schreit mich an. Lass endlich los. Der ist ne Krücke. Das ist nicht gut. Du hängst da an der Nadel. Du lässt den nicht vom Haken. Der will dich nicht mehr.
Alles zu früh.
Das Leiden so leid.
Du willst kein Du mehr sein.
G. sagt, zwei Sachen machen pro Tag. Egal was.
Die Nachtwäsche, die du nicht mehr sehen wirst. Die DVD, die wir nicht mehr schauen werden. Die Reise, die wir nicht mehr machen werden.
Allein ist plötzlich einsam.
Einsam ist was anderes als allein.
Allein war ich schon die ganze Zeit.
Ich atme, schlage, laufe, spreche, pumpe, rausche, schnell und schneller.
Ich hab irre viel zu tun.
Ausnahmezustand.
Ausstellungen, Verabredungen, Bars, Veranstaltungen, Sport, Bewerbungen.
Ich bin ein Zombie. Noch nicht tot. (Unsauber ausgeführter Tötungsakt.)
Deine Wohnung. Die Trainingshose. Deine Mutter.
Nie wieder ist so eine lange Zeit.
Der Zahn der Zeit.
Over and out.
Wie das ringt und klingt in mir.
Friss oder stirb. Kein Raum. Kein Abschied. Keine Umarmung. Keine zärtliche Geste gegenüber der Geschichte. Nicht mal im letzten Moment. Keine Erlaubnis. Nur eine Mail.
Du hast was Besseres verdient.
Wann hat ein Satz mich je so wütend gemacht.
Ich archiviere Mails, sms. Dann entferne ich sie aus meiner Sichtweite.
Ich schreibe Listen, von all den Dingen, die ich tun will.
Ich flirte mit einem Typ bei McDonalds.
Ich will weg. Ich will zum Bahnhof, zum Flughafen. Ich löse alles auf, ich lösche alle aus, ich erkläre alles für null und nichtig.
Ich klebe an meiner Scholle. Den kurzen Wegen, meinem Stück Treibholz aus Sport, Café, Freunden, Bibliothek. Ich kann nicht weg.
Ich kaufe Kondome.
Ich will den Wettbewerb gewinnen. Dann fällt mir ein: Der ist ja längst verloren.
Meine Wohnung hat Wände. Ich weiß nicht mehr, wem diese Wohnung gehört. Ich kenne diese Person nicht.
Deine Hand schiebt sich in meine, plötzlich, an der Ampel.
Abende. Wochenenden. Die plötzlich gefüllt werden müssen.
Eine. Milliarde. Erinnerungen
Ich kann nicht in die Badewanne.
Keine Ahnung, wem dieser Körper gehört. Mir jedenfalls nicht.
Ich könnte ihn verschicken, den Körper. In Teile zerlegt, in eine Kiste gepackt. Vermerk: Unbekannt verzogen.
Im Kindermodus der Angst. Ich hab meine Blase nicht im Griff.
Mittelmeer Ausstellung. Dann mach ich halt alleine, was der Plan war. Ich stehe vor den Stelen und lese. Ich lese nochmal. Und nochmal. Ich bin mir nicht sicher, ob ich verstanden hab, was darauf steht. Daneben gibt’s auch einen Text in einfacher Sprache. Was, wenn ich nicht mehr denken kann. Was, wenn ich nur denken konnte, weil er da war.
Der Schock macht mich dumm.
Schwimmen gehe ich nicht.
Mit wem schläfst du gerade? Auf welchen Hochzeiten tanzt du?
Der Bezugsrahmen ist weg. Der Bezugsrahmen ist nicht weg zu kriegen.
Alles gehört dir, alles ist besetzt, Straßen, Plätze, Wohnungen, Länder, Städte, Kontinente, Seen, Clubs, Cafes, Restaurants. Ich sitze im Knast, ich kann mich nicht bewegen, wo soll ich hin.
Wie soll ich das unbeschadet überstehen. Wie soll ich das beschadet überstehen und trotzdem weitermachen.
Ich schlafe 2 Stunden pro Nacht.
Nach 10 Tagen wache ich auf. Da ist er, der toxische Gedanke. Was, wenn es ein Fehler war. Was, wenn es doch nochmal geht. Was, wenn sie sich nicht bewährt hat, die Trennung.
Cold Turkey.
Craving.
Die Angst, ein Lindwurm in meinem Bauch. Der wächst, wird größer, wölbt sich, bäumt sich auf, schreit grässlich. Schreit an gegen die Tatsache. Die Ungeheuerlichkeit.
Ich bin so froh, dass ich keine Kinder habe.
Ihr reicht alle nicht. Ihr seid alle falsch, ihr seid die Falschen. Ihr nützt nichts.
Ihr seid kein Trost.
Ich liege auf dem Boden im Bad und schreie nach dem Trost.
Aber der kommt nicht.
Asocial Media. Als dein Foto auftaucht (obwohl ich es M. Zuckerberg ausdrücklich verboten habe), gehe ich in die Knie.
Ich bin verliebt in dich. Das gibt’s doch nicht.
How to fix a broken heart.
Ich schreibe eine Liste, was alles scheiße ist an dir. Aber das weiß ich doch. Das war doch nie der Punkt.
Der Strand. Unsere Schuhe. Mein Knie.
Duck and Hide: Die Wut. Wo ist die Wut? Sie hat Angst, versteckt sich vor mir.
Ich schau sie alle an. Die Männer. Alle.
Was, wenn ich darauf hängen bleibe. Ich habe das Potential dazu.
Wie soll irgendjemand je bestehen.
Mein Körper, was für eine Verschwendung. So unberührt.
Dann wird mir klar: Das wird der schlimmste Abschied von allen.
Irgendwo in einem Cafe. Quiero estar contigo, singt eine Frau.
Macht ihr jetzt bitte alle mal die Musik aus.
Ich muss mich ja immer nur krümmen unter ihr.
Dumme Popsongs in der Jukebox in meinem Kopf. My loneliness is killing me. I want to get away, I want to fly away. All the loney people.
Silvester. Den ganzen Tag bin ich gelaufen, hier hin und dorthin. Ich bleibe allein. Die eine Party ist zu klein, die andere zu groß, die dritte ist inmitten einer Kleinfamilie. I have to face this night alone. Ich gehe was trinken, in einer Bar, ich kaufe mir was zu essen, ich will einen Film sehen. Am Ende funktioniert der DVD Player nicht.
Jeder hat das Recht zu entscheiden, was er mit seinem Leben anfängt, mit wem er es teilt. Jeder, nur ich nicht.
Deine nächste Freundin wird dunkelhaarig sein.
Ich sehe sie, beim Einkaufen, auf der Straße, im Museum. Die würde dir gefallen. Die könnte es sein.
Was denkst du, was meinst du, wie findest du, Klamotten, Zeitungsartikel, Veranstaltungen, Filme, Freunde, Essen, Politik, Unterhosen, Jobs, Geburtstagseinladungen, Möbelkäufe, alles alles prallt gegen die Wand, kommt zurückgeschossen, trifft mich, hart wie Squashbälle. Die Wand will sie nicht haben, behalte deinen Dreck.
Im Gespräch zuhause. Jetzt: Zuhause im Selbstgespräch.
Ich brauche alle. Ständig.
Alle und alles sind falsch. Nichts und niemand ist richtig. Keiner reicht. Alle sind zu wenig.
Ich langweile mich. Ihr seid ja alle nett, aber ich langweile mich. Zu Tode.
Ich träume, du hast eine Verletzung am Arm, ein großes Loch in der Armbeuge. Wir stopfen es mit Silikon. Füllen alles auf, streichen es glatt.
Ich träume und träume und träume. Das ist Folter.
Ich wache auf. Das auch.
Kopf hoch, sagen die Männer. Einer davon ist Therapeut.
Wenn mir irgendjemand erklären kann, was daran gut sein soll, was sinnvoll oder toll, bitte, hier ist meine Nummer:
Manchmal sehe ich alte Männer, die dir ähnlich sind. Dass ich nicht bei dir sein werde, wenn du alt bist oder krank, das schmerzt mich. Jemand anderes wird dann bei dir sein.
Ich bin froh, dass es noch unter 50 passiert ist.
Ich erschrecke vor meinem Spiegelbild. Vor dem Alterungsschub. Vor dem Unglück, der Unaufhaltsamkeit, der Hässlichkeit, der Unausweichlichkeit. Dem Tod.
Alle erwarten jetzt Großes von mir. Ich soll mich frei fühlen, befreit. Ich soll mich freuen, dass etwas Neues kommt, ich soll selbst neu werden, offen, selbstbewusst, aus dem Schatten treten, ins Licht, zu mir selbst kommen, die ganze Energie nutzen, die jetzt frei geworden ist.
Ch. fragt mich, ob ich schon Urlaubspläne habe. Ich könnte ihn killen.
Ich habe non stop schlechte Laune. Üble Laune, übellaunige Übellaune. Übelnehmend, übelmeinend.
Statt dass es besser wird, gräbt es sich ein. Es sickert noch in jede freie Lücke meines Inneren, es verfängt sich in den Netzen, frisst sich in die Eingeweide. Die Erkenntnis. Die Enttäuschung. Die Verbitterung. Die Einsamkeit. Die Hoffnungslosigkeit. Und ich kann es nicht aufhalten.
Fruchtlos. Das ganze Lieben, Verzeihen, Hoffen, Kämpfen, Dran bleiben, Aushalten, Durchhalten, fruchtlos. Alles fruchtlos.
A. redet böse über ihn. C. auch. Ich halte das nicht aus.
Helene Fische und Florian Silbereisen haben sich auch getrennt. Wir kommen damit klar, wir hoffen, ihr auch. Was würd ich drum geben, wenn es so wär. Wir beschließen gemeinsam die Trennung. Es war schön, aber es ist vorbei, beidseitig. Wir werden Freunde sein, nicht gleich, aber bestimmt, und bald, wir wünschen einander das Beste.
N. hat ihn gesehen, sich mit ihm unterhalten. Ich halte es kaum aus, neben ihr zu sitzen. Sie riecht nach ihm.
Ich mache Witze.
Der T. war ihr Schicksal.
Harter Texit.
T.rump
T. will die Mauer, und Mexico soll zahlen.
T.: Lets build a wall. Muss nicht Beton sein, Stahl geht auch.
I got fired
Make Elli great again
Erstmal jemand finden zum Lachen.
Ich habe ständig Angst, dass noch was passiert. Ein Unfall, eine Erkrankung, ein Todesfall. Das geht jetzt nicht, bitte, das schaffe ich nicht. In Kliniken liegen, voller Angst, auf Beerdigungen stehen, voller Trauer, und T. ist nicht der, den ich anrufe.
Wo ich hinsehe, sind die Leute auf der Suche. Alle haben sie was zu meckern, der ist so, die macht immer das, wir haben keinen Sex , wir streiten uns, im Urlaub klappts nicht. Es ist so schwer, jemanden zu finden, den man aushält, der einen aushält. Und den man trotzdem immer wieder begehrt.
Man kann alles kaputt machen, entwerten, die Welt ist hart, scheiße ist normal, Sex ist Ausbeutung, Liebe ist Einbildung, Abhängigkeit, Fixierung Dummheit, was für Schwächlinge. Der Kapitalismus steckt überall noch in den zartesten Beziehungen, alles ist ein Deal, es gibt keine Romantik, keine Loyalität, keine Treue, keine Solidarität, alles ist auf Zeit, am Ende sterben wir allein.
Mein Wertesystem ist am Arsch.
Ich muss hier raus. Ich kann hier nicht raus. Wie komm ich hier raus. Ich will hier raus. Warum kann ich nicht raus.
Ich bin verflucht, besetzt, nur ein Exorzismus wird helfen.
Ich mache mit euch allen Schluss, ich streife euch ab. Ich werde euch los.
Ich trete auf die Straße.
März 2019 – A-Plot, B-Plot
Das ist doch nicht der A-Plot, sagt G. Das ist nur der B-Plot.
Hn, mache ich überrascht. (Auf den Gedanken bin ich nicht gekommen.)
(Was, wenn das nicht stimmt? Was, wenn es der A-Plot ist?)
Februar 2019 – ist Schweigen
Januar 2019 – Der Rest
Dezember 2018 – 23
Am 23.12.2018 wird der Satz „T. hat sich heute von mir getrennt“ zu einem eigenständig anklickbaren Textbaustein auf meinem Handy.
Dezember 2018 – sieht mans
Gestern auf der Frauentoilette in einer Bar. Ich komm rein, eine junge Frau dreht sich vom Waschbecken her zu mir um, wo sie in ihrem Kosmetikbeutel genestelt hat. Sieht man, dass ich geweint habe, fragt sie und streckt mir ihr Gesicht entgegen. Du hast geweint, sage ich, das tut mir leid. Ist nicht schlimm, sagt sie, nur: Sieht man es? Ich: Nein. (Man sieht es wirklich nicht.) Gut, sagt sie, und lächelt mich an, danke.
Und jeder geht seiner Wege.
Dezember 2018 – Cra-dar
Gestern in der U8. Ich steig ein, spotte einen freien Platz, setze mich schwungvoll neben einen Typ. Im selben Moment schreit er los: Geh weg! Weg! Weg!, reißt mit einer Hand seinen Rucksack hoch, der zwischen uns liegt, als hätte ich ihn kontaminiert, mit der anderen Hand holt er aus und schlägt nach mir. Ich weiche aus, er trifft nicht, Hey! blaffe ich ihn an, stehe auf, gehe den Gang hinunter, bringe Distanz zwischen ihn und mich. Noch die nächsten zwei Stationen bis ich aussteigen muss, höre ich ihn auf seinem Platz toben und schreien: Weg! Weg! Weg! Die U8-ler wie immer stoisch. Was soll man auch machen.
Komisch, dass mein Crazy-Radar versagt hat. Der ist ja eigentlich gut trainiert und hoch entwickelt. Der Typ saß übertrieben menspreading mäßig auf seinem Platz, links und rechts von ihm war frei, obwohl die restlichen Plätze in der Bahn gut gefüllt waren. Allein das hätte mir zu denken geben müssen. Dann noch der betont barrieremäßig hingelegte Rucksack. Aber ich war im Schwung, hab mich selbst überholt, hab mich hinreißen lassen, von meinem Bedürfnis zu sitzen, meiner Freude, einen Platz zu ergattern. Ich war nachlässig. Ich hab meinen Cra-dar nicht eingeschaltet.
Als ich aussteige und nach Hause gehe, zittern mir ein bisschen die Knie. Das ist, weil er versucht hat, mich zu schlagen. Das ist, weil ich wütend bin. Das ist, weil ich ihn in meinem Kopf zurückschlage, ihn fertig mache, ihm die Fresse poliere, bis er auf dem Boden liegt, ihm den Arm nach hinten drehe und ihn festhalte und die Bullen hole, die ihn mitnehmen und einsperren, damit ihm irgendein Arzt eine fette Ladung Haldol verpassen kann, und er endlich seine verdammte Schnauze hält: Geh du doch weg!
Weil ich immer alle aushalten muss, aber niemand mich.
Weil ich ihn aushalten muss, aber er mich nicht.
Weil ich ihn aushalte, aber er mich nicht.
Weil er mich aushält, aber ich ihn nicht.
Dezember 2018 – Gated Car
Autos so groß wie Ein-Zimmer-Wohnungen. Darin hängen Kleider in Schonbezügen, ordentlich am Haken. Es gibt Strom, Wasser, Heizung, Klimaanlage, Getränkehalter, Radio, Internet, Telefon. Die Aussicht ist gut, man ist schön weit oben. Die Scheiben sind getönt, die Wände dick wie Panzerglas. Das ganze Elend kann draußen bleiben. Da sitzt man drüber. Von innen kann man bequem einen Blick drauf werfen. Auf die Armen, die Idioten und Spinner. Der Security Standard ist hoch. Bei einem Angriff gehen die Airbags auf, man ist auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Zur Not kann man jemanden überfahren. Sobald sich die Türen hinter einem geschlossen haben, mit diesem satten, extra designten Sound, kann man alles überleben, den Atomkrieg, die Klimakatastrophe, die Zombie-Apokalypse. Der SUV ist die Gated Community unter den Autos.
November 2018 – America First
Gestern war es soweit. 26.11.2018, der Tag an dem zum ersten Mal einer der Giganten der fordistischen Autoindustrie massive Werksschließungen und Stellenabbau damit begründet hat, dass er sich auf die Entwicklung von E-Autos und Autonome Fahrzeugen konzentrieren will, um dem Silicon Valley etwas entgegensetzen zu können. Die Region Lordstown ist damit dem Untergang geweiht. An der Börse sind die General Motors-Aktien in die Höhe geschossen.
November 2018 – FYI
Ich sitze auf einen Kaffee im Fenster bei Balzac Coffee. Neben mir klettert eine junge Frau auf den Barhocker, Anfang 20, schätze ich. Höchstens, vielleicht auch erst 18. Sie ist zierlich, sehr blond und von oben bis unten in Berry-Tönen gekleidet: Hose, Turnschuhe, Pulli. Ihre langen Haare trägt sie offen, das Deckhaar in einem Knoten auf dem Kopf, wie man das gerade häufig sieht. Ihr Gesicht ist hübsch, weich und rund, ein bisschen baby face-mäßig. Sie telefoniert. Es ist voll, Mittagszeit, wir sitzen ziemlich dicht. Ich verstehe jedes Wort.
Sie kommt gerade vom Arzt. Hat sich testen lassen. Sie fände es besser, wenn es wie in den USA wäre, da gibt es zwei Institute, die von den Produzenten anerkannt werden und nicht wie hier, wo jeder Produzent einen anderen Test sehen will, in Budapest gilt was anderes als hier. Sie hat der und der schon Bescheid gesagt, dass sie sich auch testen lässt und dann auch den und den anruft. Das muss schon sein. Chlamydien, Syphilis, Tripper, rattere ich im Kopf durch, das Stichwort Hepatitis fällt, aber ich weiß nicht, ob sie deshalb heute beim Arzt war. Aber mal ehrlich, sagt sie, und wenn man irgendwann HIV kriegt, davon stirbt man heute auch nicht mehr. Dann schreib ich halt ein Buch, sagt sie: über Geschlechtskrankheiten in der Pornobranche. Sie lacht. (Ich bin mal wieder sauertöpfisch davon beeindruckt, wer es alles außer mir schafft, ein Buch zu schreiben.) Es ist besser mit Leuten zu drehen, die sehr viel drehen. Die sind dann ja ständig beim Test. Aber ganz ehrlich, man kann mich ja auch heute anstecken, dann weiß man das bei HIV aber trotzdem erst in acht Wochen oder so. (Blödsinn, denke ich, das geht doch viel schneller mit dem Ergebnis. Ohweia, vielleicht ist sie doch dööfer als ich dachte. Achso, sie meint, weil sie sich alle zwei Monate testen lässt. Ich bin die Doofe.)
Mit irgendeiner Kollegin gibt es Ärger, die ist bitchy, bestimmt, weil sie nicht so oft gebucht wird. Naja, vielleicht gibt sich das, wenn sie mal ihr girlfriend war. Der Produzent hat gefragt, ob sie schon naked attraction gemacht hat oder irgendwelche Tabuthemen hat. Also kein Problem, Naked attraction hat sie schon gemacht und Tabuthemen hat sie keine. – Ich bin irritiert, ist Naked Attraction nicht diese lahme Sendung in der Leute sich nackt daten? Vielleicht hab ichs falsch verstanden. Vielleicht verstehe ich überhaupt alles falsch. Auch den Namen eines Kollegen nennt sie, Ricky Jason, klingt ja erstmal glaubwürdig, aber als ich das später google, finde ich in der Kombination nichts. Rickys gibt’s aber auch eher bei gay porn. Vielleicht ist sie ja schwul oder ein Mann und ich hab auch das nicht kapiert. Haha.
Und die Liebe? Der Arzt ist süß, bei dem sie gerade war. Aber zu dem kommt sie ja immer nur wegen ihren Geschlechtskrankheiten, das wird also auch nichts mehr. Sie lacht.
Wegen der Steuer: Bis dahin hat sie dann eine Adresse in Panama. Von da aus überweist sie ja jetzt schon die Krankenkassenbeiträge. Und der Steuerberater weiß dann ja, wie das geht, dass sie hier keine Steuer bezahlen muss. Dann geht es noch um Mama und was die zu all den praktischen Orga-Dingen so sagt. Die weiß also Bescheid. Ist ja auch das wichtigste, dass man seine Tochter bei ihren Träumen unterstützt.
Ich kann nicht behaupten, dass ich sie mag oder verstehe, aber blöde ist sie nicht, jedenfalls nicht komplett. Sie ist fröhlich, bester Laune und stolz, weil alles so gut läuft. Eine ehrgeizige junge Frau, bereit, ihren Weg zu gehen. Germanys Next Topmodel auf der etwas expliziteren Ebene. Sie hatte keine Lust Bürokauffrau zu werden, wie ihre Mitschülerinnen, sie wollte was Besonderes sein, sie wollte ein aufregendes, ein künstlerisches Leben, sie wollte ins Filmbusiness. I respect that. A girl with a dream. Who am I to judge. Well. Do I respect that? Am I not judging? To be honest: I do. Wär`s mir lieber, sie wäre Bürokauffrau? Und überhaupt: Was geht’s mich an. Jeder kann machen was er will. Ihre Entscheidung. Selbst/bewusst gewählt. Stimmt das? Wählt irgendjemand irgendwas? Wenn ja, warum dann das? Es kümmert mich, weil sie eine Frau ist. Ich will, dass sie versucht, mit was anderem zu punkten als ihrem body sex girl -Ding. Würde es mich auch kümmern, wenn sie ein junger Mann wäre? Ja. Aber bei ihr als Frau kommt noch was dazu. Work your brain, sister. Sonst wird hier nie was anders. Aber vielleicht wird hier ja auch einfach nie was anders. Dann wieder: Eine selbstbewusste, zu ihrer Sexualität und ihrem Beruf stehende Frau. Da kann man doch aus feministischer Sicht nichts sagen. Ist ein Pornodreh Sexualität? Was labert sie großspurig von Panama. Das nervt mich am meisten. Überhaupt dieses big player raushängen lassen, das verstärkt in mir den Eindruck, sie sei Opfer irgendeines Rip-off. Und mal sehen, was sie sagt, wenn sie dann tatsächlich HIV hat, immer noch: daran stirbt man ja nicht? Vielleicht schreibt sie dann in ihrem Buch, dass sie, als sie noch jung und schön war, und voller Hoffnung auf eine große Karriere, und noch kein alter, verbitterter, gebrochener, kranker Ex-Pornostar, in einem Cafe saß, und eine Frau neben ihr saß, von der klar war, dass sie jedes Wort hört, sie aber so getan hat, als wär sie Luft.
November 2018 – Meckerfixierung 4
Maaaann, könnt ihr SZs und FAZs und Tagesspiegels und Zeit Onlines und Spiegel Onlines und wie ihr Qualitätsjournalismuspublikationen alle heißt, nicht mal besser auf eure Rechtschreibung achten? Was in euren Artikeln an Flüchtigkeitsfehlern, grammatikalischen Kuriositäten und falsch geschriebenen Fremdwörtern drin ist, das ist ja der Wahnsinn. Tendenz steigend, so mein Eindruck. Aber auf irgendjemand muss man sich doch rechtschreibmäßig verlassen können. Wenn nicht auf euch, auf wen denn dann? Ich will was Richtiges lesen, wenn ich euch lese. Und wenn ihr keine Lust habt, eure auf dem Handy zusammengehackten Beiträge zu korrigieren, dann jagt doch wenigstens mal eben kurz ne Software drüber, wozu ham wir denn das ganze digitale Zeugs!
November 2018 – Vanille
Ich sitze bei einer Tasse Filterkaffee mit Oma-Milch (Kondens) in der Bäckerei einer Kaufland-Filiale und tippe in meinen Rechner. (Ja, ich komm rum, mein Büro ist die Straße, ich fühl mich wohl im Trash). Ein Mann tritt an die Theke der Bäckerei, Mitte 50, ich sehe ihn zunächst nicht, höre ihn nur: Er schimpft. Dann begreife ich, das ist nur seine Art zu reden. Er stellt wütende, misstrauische Fragen bezüglich der belegten Brötchen und Kuchen. Die Verkäuferin verteidigt sich tapfer, eventuell hat er ne Meise und/oder ist sogar wirklich aggressiv. Man weiß es nicht. Dann verschwindet er. Aus Augen und Ohren. Plötzlich ist er wieder da. Durchquert, ein Tablett mit Kaffee und Kuchen in den Händen, den Cafébereich und setzt sich an den Tisch neben mich. Ich und mein Laptop, ab und zu guckt er ein bisschen rüber. Neugierig. Irgendwann schaue ich zurück, lächle ihn an, und frage: Und, schmeckt der Kuchen? Nä! schimpft er laut und knackig, als hätt er nur drauf gewartet. Oh, sage ich, das ist aber schade. Das ist nur so ein Streuselkuchen, sagt er und schiebt den Kuchen prüfend auf seinem Teller hin und her. Ich dachte, der wär mehr so mit Vanille. Verstehe, sage ich, und nicke. Wollen sie mal probieren?, fragt er. Nein danke, lache ich, aber das ist sehr nett.
Als ich gehe, wünsche ich ihm einen schönen Tag. Da sitzt er. Friedlich und entspannt. Danke, sagt er, für Sie auch, und zum ersten Mal hört es sich nicht an wie geschimpft.
Auf dem Heimweg hab ich das Gefühl, eine gute Tat getan zu haben. Eigentlich wollen doch alle immer nur das eine: Dass jemand nett zu ihnen ist.
Weil im Kuchen einfach nie Vanille ist.
November 2018 – Simulationsarbeit Arbeitssimulation
Es gibt doch unglaublich viele Menschen, die „zusammen mit Freunden eine Idee haben“, „regelmäßig an dieser oder jener Gruppe teilnehmen“, „da gerade so ein Projekt am Laufen haben“ oder „jetzt bei dieser oder jener Organisation mitmachen.“ Sie volunteeren hier, engagieren sich ehrenamtlich dort. Sie gehen in Seminare, Vorträge, Symposien, Workshops. Sie haben Lesegruppen, Diskussionsrunden, Websites, Vereine. Sie demonstrieren, organisieren, kommunizieren, präsentieren. Sie machen Kunst oder Flüchtlinge oder Stadtpolitik oder Lateinamerika oder Fahrrad oder Hausprojekt oder Umwelt oder Kinder. Sie verbringen Zeit damit, machen dabei oft Überstunden, sind in Kontakt miteinander, haben und entwickeln skills, die sie dabei gebrauchen können. Sie machen das, weil sie‘s gut finden. Weil sie das, was sie da machen, interessant, richtig und wichtig finden. Aber das ist nicht ihre Arbeit. Nein. Das ist überhaupt keine Arbeit. Ihre Arbeit ist die, mit der sie Geld verdienen. Diese Arbeit kann bescheuert, belastend, schädlich für uns alle sein oder selbstverwirklichend, identitätsstiftend, kreativ. Von beider Sorte Arbeit können immer mehr Leute nicht mehr leben. Dann beantragen sie Stipendien, Förderungen, Stiftungsgelder und Hartz IV. Ja, man muss schon ganz schön gucken, dass man sich das Arbeiten noch leisten kann. Arbeiten ist Luxus. Man muss sich ganz schön was absparen dafür. Am besten, man hat geerbt oder gewinnt im Lotto. Dann kann man endlich in Ruhe arbeiten.
Was, wenn die Trennung von Arbeit und Lohn in Wahrheit längst vollzogen ist?
Können wir dann nicht auch gleich noch Arbeit und Lohnarbeit voneinander trennen? Dann hätten wir den Quatsch endlich hinter uns. Wir würden Geld verdienen und arbeiten – aber das eine hätte mit dem anderen nichts mehr zu tun.
Aber nein. Die Simulation muss weitergehen.
November 2018 – ein Jahr
Heute ist es ein Jahr her, dass du gegangen bist, mit einer Unbedingtheit und Brutalität, die mich noch immer schockiert.
Die Toten vergessen einen schnell, hab ich neulich irgendwo gelesen. (Eribon, Zitat Genet, wir hätten uns darüber unterhalten). Unsere Körper sind warm, auch wenn du nichts davon abhaben möchtest. Die Kränkung ist noch immer da. Die Schuld, die Irritation, die Freundschaft für dich.
Du hast uns allein gelassen, hast dich getrennt von uns, einen Graben gezogen, der sich nicht überbrücken lässt. Und wir haben das zu akzeptieren.
Wir trinken einen auf dich.
Oktober 2018 – Ich lese
Seit langem mal wieder! Mit Genuss und von vorne bis hinten. Der Raum erscheint mir nicht zu still mit einem Buch in der Hand.
Ivan Krastev: Europadämmerung (Rechtsruck in Europa, wieso weshalb warum, kluges, angenehmes Essay)
Didier Eribon: Rückkehr nach Reims (mich überzeugende Mischung aus Biographie und Soziologie, ich staune – wie er – darüber, dass er nicht früher darauf gekommen ist, seine Klasse als Prägung zu thematisieren, ich lerne, dass sich die französischen anders als die deutschen Arbeiter als Klasse an und für sich begreifen, dass sie zu Rechtswählern geworden sind, was Eribon im (falschen, wie ich finde) Umkehrschluss dazu veranlasst, sie in eine Linke zurück wünschen und locken zu wollen, die es zurzeit nicht gibt, und die den Fehler macht, die Arbeit selbst nicht infrage zu stellen, geschweige denn den Arbeiter, aber das wird die KI-Entwicklung sowieso von alleine erledigen.
Virginie Despentes: Vernon Subutex (ich breche nach mehr als einem Drittel ab. Die Aneinanderreihung mieser Charaktere, mies ganz sicher nicht im Sinne der Erzählweise, mies in Bezug auf ihre Kälte und Ungerührtheit was Sex, Drogen und Beziehungen angeht, langweilt mich schnell. Was für eine verkommene Brut sie da zeichnet, ihren Freundeskreis womöglich, das glaubt doch kein Mensch, dass das Menschen sind. feministische Macho-Lektüre, wie schon bei ihren Filmen).
Annie Ernaux: Die Jahre. In großen Teilen wunderschönes Buch, das eine Form hat, die mich aufgrund ihrer Tagebuch-Qualitäten sehr anzieht, sowas würde ich auch gerne schreiben, sehr anregend also, trotzdem teilweise so harmonisch und wenig szenisch, dass ich eben doch auch finde, dass hier eine Lehrerin schreibt, damit meine ich, ganz böse, etwas brav geraten. Aber egal. Ich fands toll. Frauen ab 70, wo seid ihr, mehr von euch!
Oktober 2018 – Seinen Käse verdienen
Kürzlich in der U8 (wo sonst?).Ein Obdachloser schlurft durch den Gang, groß, gebeugt, schon etwas älter, mit lauter, schnarrender, dringlich-vorwurfsvoller Stimme bittet er um Geld, was zu essen oder zu trinken auch okay, aber. Leute. Echt jetzt mal. Kann doch nicht sein. Hat denn nicht einer?!
Eine Frau läuft hinter ihm her, tippt ihm auf die Schulter und reicht ihm, als er sich umdreht, eine durchsichtige Plastiktüte mit fünf Schrippen. Der Mann nimmt die Tüte, guckt darauf, reicht sie ihr brüsk zurück und schlurft weiter den Gang hinunter: Brötchen, ihr immer mit euern Brötchen, ich brauch keine Brötchen, was soll ich denn mit Brötchen, wenns wenigstens mal Käse wäre oder sowas, aber Brötchen, nee.
Oktober 2018 – einsam
Ich glaube nicht, dass ich mich einsamer fühlen könnte.
November 2018 – egal
Seltsam wie einem von einem Tag auf den anderen alles egal sein kann. Das Leben
September 2018 – Ferkelkastration
Und doch staune ich, als ich höre, dass man Ferkel ohne Betäubung kastrieren darf.
Oktober 2018 – Meckerfixierung 3
War das Farocki, der uns vor Augen geführt hat, dass im Supermarkt jeder unserer Schritte, jede unserer Hand-, ja, Augenbewegungen für Design und marketingstrategische Überlegungen, sprich System, Fetisch und Kapitalismus von Interesse sind? Klar war das Farocki.
Ich frage euch also, wenn schon so, dann WIESO
kriegen die es in den Supermärkten eigentlich nicht hin, das Kassenband so zu bauen, dass man den vollgestopften, schweren Korb nicht aufs Band hieven muss, als wärs ne Riesenhantel, und dann auch noch ein nerviges kleines Spielchen mit ihm anfangen muss, weil er mit dem Band abhaut, wegzuckelt, man ihn zurück zieht, Produkt raus, er weiter zuckelt, man mitzuckelt, er weiterrruckelt, usw., usf., ein Tanz für Deppen, bis man an der Kasse ist und den Korb dann, inzwischen leer, wieder ganz nach vorne, an den Anfang des Bandes stellen muss, vorbei an den anderen Leuten in der Schlange, Entschuldigung, ich müsste mal, könnten Sie, ach, danke.
Oder, andere Variante, WIESO muss man, wenn man den Korb unten auf den Boden vor das Band gestellt hat, sich zwanzigmal nicht rückengerecht runterbeugen, um ein Produkt nach dem anderen aus den Tiefen des Korbs zu holen, und es hoch aufs Band zu legen, eine Streckenüberwindung von jeweils ca. einem Meter von ganz unten, Bodenebene nach oben, Bandebene, das Spielbein tendenziell abgespreizt, wie bei der Fitness-Übung Der Stern – denn zwanzigmal in die Knie gehen und wieder hoch, geht ja irgendwie auch nicht.
Warum diese Kundendemütigung, gerade da, wo die Produkte bezahlt werden sollen. Warum muss man dem Kunden genau hier, an dieser Stelle, das Gefühl von Komfort entziehen. Weil es ein Privileg ist, zu zahlen? Weil man sich das hart erarbeiten muss? Weil man die durchdesignten Produkte dann noch mehr zu schätzen weiß, die man jetzt gleich bezahlen darf?
Bis die Idiotie der Kasse und oder der Kapitalismus abgeschafft sind, dauerts noch, wies aussieht.
Wieso also kann man nicht einfach auf durchschnittlicher Handhöhe eine Ablage vor dem Band anbringen, auf dem man den Korb bequem abstellen und seine Sachen ausladen kann? Auch das Band ließe sich nach vorne verlängern, sodass es weiter unten, auf komfortabler Abstellhöhe beginnt, um dann erst den Bogen auf Kassenhöhe zu machen. Ich meine, das jetzt mal nur so von jemand, der keine Ahnung hat,
schöne Grüße an die Supermarkt-Designer.
September 2018 – Populismus
Die Linke/Rosa-Luxemburg Stiftung beschäftigt sich gerade vermehrt mit Populismus. Wir brauchen einen von links, ist der Tenor.
Dass man überhaupt auf die Idee kommt, Populismus zu fordern, finde ich empörend. Populismus als politische und kommunikative Strategie in Betracht zu ziehen, bedeutet davon auszugehen, dass Leute dumm sind, dass man sie da abholen muss, wo sie dumm sind, und dafür sorgen muss, dass sie dumm bleiben. Populismus ist eine Absage an Aufklärung, Wissen und Wissenschaft, eine Absage an die Idee vom lernenden, denkenden Menschen. Seit wann ist einer solchen Haltung je etwas Gutes entsprungen?
Einmal mehr offenbart sich in dieser Forderung nach Populismus als politischer und kommunikativer Strategie der romantisierende Blick der Linken auf „den Arbeiter“, in den schon immer etwas Elitistisches bis Verächtliches eingeschrieben war. Die linken Eliten sehnen sich nach „dem Arbeiter“, sie wollen für ihn andockbar sein. Auch wenn der sie längst vergessen hat. Auch wenn der längst besser verdient und besser abgesichert ist als sie selbst. Vor allem aber: Auch wenn der ein Nazi ist. Sie wollen ihm aufs Maul schauen und nach dem Maul reden. Damit er sie wieder liebt. Schade, schade, nun sind sie alle bei der AfD, der Pegida, der Nachfolge-NSU, den Identitären, den Reichsbürgern, den Hooligans und singen dort ihre Lieder. Und die, die dort sind, sind oft gar keine Arbeiter, sondern satte Mittelschichtler mit Hochschulabschluss und Car-Port, einige von ihnen waren selbst mal linke Elite, sie verlegen Zeitungen, haben Verlage und sind international vernetzt. Aber das ist egal, die Linke will lieber mal besser über Populismus als Heilsstrategie nachdenken als über Ideen, Konzepte, Forderungen, die dem System an die Substanz gehen. Sie wollen lieber auf den Rechtsruck reagieren als agieren.
Auch hier spaltet die Linke sich feinsäuberlich auf. Die Populismus-Forderung vom „bösen“ Flügel, also dem rund um Wagenknecht/Aufstehen-Bewegung/Bernd Stegemann, der eher unverhohlen national argumentiert. Der deutsche Arbeiter, die deutsche Oma, das deutsche Kind zuerst. Und eine Populismus-Forderung vom „guten“ Flügel, also Kipping/Bartsch, die sich als innerparteiliche, rasche Antwort darauf mit Chantal Mouffe und ihrer akademisierten, korrekteren Variante der Populismus-Diskussion wappnet, die um Verständnis für die Bedürfnisse und Emotionen des kleinen Mannes ringt.
Das ist alles haarsträubend.
September 2018 – erstaunlich
wie schnell man aus dem Tritt gerät.
Da muss nur mal.
Der Himmel grau sein. Der Termin ausfallen.
Und schon steht alles in Frage.
September 2018 – Haut
Ausschläge wandern über meine Haut wie die Jahreszeiten über den Waldboden. Bläschen rotten sich zusammen, stehen in kleinen Herden herum, um Mundwinkel, Nasenwurzeln. Was wolln sie da. Knorrige Erhebungen bilden sich, flechtenartige Täler, Flecken in allen Pantone-Brauntönen, rötliche Unterspülungen, Schuppen wie felsiger Schiefer.
Sie alle kommen und gehen
und kommen,
um zu bleiben.
September 2018 – Die Gentrifizierung des Planeten
Nehmen wir an, jemand hätte zu Anbeginn der Menschheit eine Kamera auf den Planeten Erde gerichtet, und wir könnten im Zeitraffer sehen, was bisher geschah.
Da ist er, ein kleiner, schwarzer, sich bewegender Punkt: Der Homo Sapiens. Noch ist er einsam, vereinzelt, aber bald schon schließt er sich zusammen, mit anderen, sich bewegenden Punkten. Er wächst, der Punkt, nicht nur an Größe und Umfang, sondern vor allem an der Zahl. Ganze, in sich wimmelnde Punktgruppen bildet er, und lässt sich nieder. Kommt zur Ruhe, macht Fläche, Höhe. Dann wieder wandert er. Über den Planeten, durch die Wüste und übers Eis. Nur um sich an anderer Stelle erneut nieder zu lassen.
Die Punkte bauen Hütten, Häuser, Paläste und Hochhäuser. Sie siedeln in Form von Dörfern, Städten, Ballungsräumen und Mega-Cities. Sie bauen Straßen und Brücken, Fahrzeuge, die sie über Flüsse, Meere, über den Boden und durch die Luft bringen. Sie migrieren in Strömen und Wellen. Sie dezimieren sich von Zeit zu Zeit massenhaft. Und gegenseitig. Sie vermehren sich, trotz aller Rückschläge durch Naturkatastrophen und Hungersnöte, ins Hundertausend-, Millionen- und schließlich ins Milliardenfache. Dichte Ansammlungen schwirrender, schwarzer Punkte, wolkenartig überall auf dem Planeten. In ihrer Umgebung bleibt kein Auge trocken. Alles machen sie sich untertan, den Boden, die Erde, die Luft. Sie roden und ackern und fressen. Ihr Ausbreitungs- und Ausbeutungswille ist enorm. Sie lassen die Erde erblühen. Man kommt ihnen besser nicht in die Quere. Sie töten. Gezielt, organisiert. Tiere und sich gegenseitig. Nur um am Ende gestärkt daraus hervor zu gehen. Ein Wuseln und Wieseln ist das, wie von Läusen, Käfern, ausgestattet mit einer Begabung und einer Lust, die ihresgleichen sucht.
Am Ende wird nichts übrig sein. Was die schwarzen, wimmelnden Punktemassen noch fressen, trinken, atmen können. Die Erde wird sterben an dem Parasit, den sie hervorgebracht hat und der über sie hergefallen ist. Das ist es, was wir sehen werden, im Zeitraffer der Kamera.
September 2018 – Klamottenbiografie
Wenn man so alt ist wie ich, kann man schon auf eine beträchtliche Klamottenbiografie zurück schauen. Ab und an passiert es, da sitze ich irgendwo, sehe irgendwas oder irgendwen, und da fällt mir plötzlich siedend heiß irgendein Kleidungsstück ein, das ich früher mal getragen habe. Der graugrüne Mantel aus Cord im Trenchcoat-Stil. Die kurze kastenförmige Lederjacke ohne Bund. Das orange-weiß karierte (!), taillierte Wolljackett. Die schwarze Vintage-Anzugshose, die so gut saß. Das grüne, eng anliegende Samtkleid, bei dem nie klar war, ob die Schleife nun vorne oder hinten sitzt.
All diese Verflossenen lösen die unterschiedlichsten Gefühle aus: Wehmut, Belustigung, Kopfschütteln, Bedauern. Diese Jacke hab ich echt geliebt, sage ich zum Beispiel. Oder: Warum zur Hölle hab ich den Pulli weggeschmissen? Oder: Nicht zu fassen, wie oft ich diesen Mantel getragen habe. Oder: Warum hat mir keiner gesagt, dass diese Jeans ein echter Keeper ist?
Diese ganzen Kleidungsstücke haben mich in einer bestimmten Phase meines Lebens begleitet. Manche von ihnen habe ich nur zwei- dreimal angehabt, sie dann im Schrank gelassen, Ladenhüter draus gemacht, mit anderen war ich praktisch Tag und Nacht zusammen. Mit ein paar von ihnen sieht man mich auf Fotos posieren. Einige von ihnen waren geradezu charakteristisch für mich, jeder kannte mich darin, sie haben mir eine Form gegeben, haben mich geprägt. Sie haben nach mir gerochen und ich nach ihnen, sie standen mir, sie haben mir gepasst. Andere nicht. Andere waren zu groß, zu lang, oder das, was man unvorteilhaft nennt, und ich konnte es nicht sehen. Aber alle, absolut alle, habe ich eines Tages weggeschmissen. Ich bin nämlich, das muss man sagen, ein Wegschmeißer. Ein manchmal Zu-früh-Wegschmeißer, ein Radikal-Wegschmeißer, ein Brutal-Wegschmeißer. Ein Wegschmeißer ohne Rücksicht auf Verluste. Mitleidslos, undankbar, mit einer plötzlichen Gleichgültigkeit, den vormals geliebten Kleidern gegenüber, die schon manchen erstaunt hat. Ab in die Mülltüte, in den Container damit. Aus. Vorbei. Ich mag es nicht, wenn die Dinge in meiner Umgebung sich anhäufen, wenn sie anfangen, mir zu viel werden, mir auf die Pelle zu rücken, mir den Blick verstellen. Ich mag es auch nicht, wenn sie mir Arbeit machen, wenn ich sie ausbessern, zur Reinigung bringen, bügeln muss. Wenn sie fusseln, löchrig werden, speckig. Aber hinterher ist der Jammer manchmal groß. Noch Jahre später fällt mir dann plötzlich ein, wie schön Mantel, Schuhe, Kleid waren. Ich erinnere mich an Stoff, Farbe, Schnitt, und denke daran, wie es war als ich sie zum ersten Mal im Laden gesehen habe.
Doch die richtig schlimmen Verluste sind die, die man erleidet, wenn man Klamotten verliert, an denen man hängt. Eine Anzugsjacke im Nadelstreifen-Blau mit eingenähtem Kapuzenpulli: Aus dem Fahrradkorb gefallen. Ein Vintage-Pyjama: Im Nachtzug nach Wien liegen gelassen. Der schönste Pulli der Welt: Auf der Toilette vom Campingplatz vergessen. Am Schlimmsten aber, und das geht weit zurück in meine Kindheit: Ein Rock, den ich geliebt habe, den meine böse Mutter einfach hinter meinem Rücken meiner Cousine geschenkt hat.
September 2018 – Chemnitz 2
Wenns euch nicht passt, dann bleibt doch drüben.
September 2018 – Chemnitz 1
Es war eben doch ein antifaschistischer Schutzwall. Aber in die andere Richtung.
September 2018 – Flagge zeigen?
Kürzlich bin ich auf einer Anti-AfD-Demo. Eine Bekannte und Mitdemonstrantin, die aus Schweden kommt, fragt angesichts des Meers aus Deutschland-Fahnen auf der anderen Seite, ob wir die nicht eigentlich tragen müssten. In Schweden, meint sie, wäre das anders. Da würde sich das niemand gefallen lassen, sich die schwedische Fahne wegnehmen zu lassen.
Seitdem beschäftigt mich das.
Ist es womöglich an der Zeit, flashmobmäßig auf einer Anti-Nazi-Demo massenhaft die Deutschland-Fahne zu zücken? Um für einen Moment eine einzige, nicht unterscheidbare Masse zu werden, und dadurch ein für alle Mal zu sagen: Ihr seid das Volk, wir sind die Bevölkerung! Ihr bestimmt nicht, was hier ist und sein wird. Wäre das eine Möglichkeit, die Symbol-Politik zu sabotieren, das Symbol denen zu entreißen, die es sich aneignen, um sich damit ihre braunen Hintern abzuwischen?
Ich bin in meinen Grundfesten irritiert und erschüttert. Ich komme aus einer Nie-Wieder-Deutschland-Ecke und -Generation und habe das Gefühl, die deutsche Fahne hochhalten zu müssen? Eine Fahne, die sich auf Begriffe wie Nation, Volk und Vaterland bezieht, auf Blut und Boden, auf eine Fahne, unter der die grausamste aller Geschichten stattgefunden hat, eine gerade mal so eben bürgerlich gewordene Fahne, die Schland meint, und Europa, statt Deutschland?
So weit ist es gekommen.
August 2018 – Arktis
Heute lese ich, dass die Arktis seit neustem für den Schiffsverkehr freigegeben ist. Das Eis ist inzwischen einfach so weit geschmolzen, dass man getrost durchfahren kann. Mir fällt die Kinnlade runter. Darum ging es also die ganze Zeit! Deshalb passiert hier nichts!
Bilder von traurigen Eisbären, die vor Erschöpfung sterben, weil sie nur noch von Scholle zu Scholle springen können? Erderwärmung mit fürchterlichen Konsequenzen für Klima, Mensch und Tier? Das ist alles gar nicht schlimm. Das ist im Gegenteil total super. Da muss man keine Klima-Verträge unterschreiben oder gar umsetzen, nein, da muss man zusehen, dass man die Füße still hält, und das Eis schmelzen lässt, bzw. den Prozess sogar noch beschleunigt.
Denn wenn das blöde Eis endlich weggetaut ist, die lästigen Eisberge nicht mehr im Weg sind, dann kann man hier neue Handelswege erschließen. Dann kann man hier endlich schneller und auch im Winter fahren. Dann kann man die Bodenschätze heben, die dort reichlich vorhanden sind, und: Man kann Kreuzfahrten veranstalten. Die ölverschmierten Industrien reiben sich schon längst die Hände. Wie konnte ich bloß mal wieder so naiv sein und denken, die Welt hätte ein Interesse daran, die Welt zu retten? Ich fühle mich, als hätte ich meine Kapitalismus-Hausaufgaben nicht gemacht.
Seine Hausaufgaben gemacht, hat bspw. Russland. Schon im Jahr 2007 hat ein russischer Roboterarm im Rahmen einer U-Boot-Expedition eine Flagge in den Meeresboden am Nordpol gerammt. Militärflughäfen, Radarstationen, alles schon da. Damit’s da kein Vertun gibt. Die Anreiner- bzw. Anspruchs-Staaten der Arktis – Dänemark/Grönland, Norwegen, Russland, Kanada, USA – sind schon längst im Kalten Krieg miteinander, ha. Die Arktis Games haben begonnen.
August 2018 – Bayern
Die Bayern sind halt schon anders. Fremd. Sie sind aus einem anderen Land, haben eine andere Kultur, eine Religion und andere Vorstellungen – von Männer und Frauen, von wie man rumläuft und wie man lebt. Da wollen die ja auch nur ein bisschen Toleranz für. Ihre Kultur und Lebensweise. Kann man ja vielleicht auch mal akzeptieren. Als überheblicher Berliner. Der immer allen gegenüber tolerant sein will, nur auf keinen Fall den Bayern gegenüber.
August 2018 – schwimmen 5
Augen auf in der Salatschüssel.
Ich übe ohne Brille unter Wasser zu sein. Der Trick ist, nicht mit offenen Augen das Wasser zu in der Schüssel zu berühren, sondern sie erst aufzumachen, wenn man drin ist.
Trotzdem: I am not a fan. Brennt. Und ist ja nur klares Wasser bis jetzt. Und besonders viel sehen tut man ja wohl auch nicht. Alles blurry.
August 2018 – Toleranz
Ich steige am Görlitzer Bahnhof aus. Oben auf dem Gleis spricht mich der erste black guy an, Gemurmel, in gebrochenen Deutsch, ob ich Drogen will, auf der ersten Treppe nach unten der nächste mit dem gleichen Spruch, auf der zweiten Treppe der übernächste, unten, ebenerdig, dann nochmal einer. Nein danke, sage ich beim ersten, beim zweiten schüttele ich den Kopf, beim dritten sage ich gar nichts mehr, den vierten schau ich nicht mal mehr an. Ein paar Meter weiter vorne gibt es Streit, zwei von den Jungs schreien sich an. Um die Kurve des Gebäudes, auf dem Weg zur Ampel, sehe ich an der Wand Schlafsäcke, eine Matratze auf dem Boden, das bisschen Hab und Gut drum herum, den Müll, der bleibt, wenn der Mensch etwas isst.
Die Handhabe der Berliner, oder genauer, der Kreuzberger Politik, ist in solchen Situationen Toleranz. Was sollen die Leute machen. Sie sind ausgegrenzt, leben in prekären Verhältnissen, stehen unter Druck, müssen mit irgendwas Geld verdienen, müssen irgendwo schlafen. Sagen wir eben einfach höflich Nein, danke, wenn sie uns ansprechen, oder auch Ja, danke, und kaufen ihnen ein bisschen was ab. Lassen wir sie. Ist doch okay. Geben wir ihnen ein bisschen was. Nehmen wir sie mit, wir haben doch genug.
Was, wenn Toleranz hier nichts anderes ist als Indifferenz. Als Gleichgültigkeit, gegenüber dem Elend. Denn das ist es, was ich hier sehe: Elend. Was, wenn Toleranz hier einfach nur zynisch, feige und bequem ist? An diesem Ort bilden sich gerade höchstwahrscheinlich brutale, mafiöse Strukturen heraus, zwischen den Verkäufern von oben (Gleis) und denen von unten (Erdgeschoss), Strukturen mit eigenen ausbeuterischen Regeln, Gesetzen und Strafen, die wir nicht kennen und durchschauen, auf die wir keinen Zugriff haben. Diese Männer schlafen auf der Straße, leben im Dreck und im Lärm, essen auf Augenhöhe mit den Berliner Ratten, verkaufen und konsumieren schlechte Drogen, wissen nicht, wie es weitergehen soll, können nicht vor und nicht zurück, und was uns dazu einfällt, ist, tolerant zu sein. Aber hier geht es nicht um eine Lifestyle-Entscheidung, um sexuelle Orientierung oder kulturelle Vielfalt.
Is mir egal – so hat die BVG sich und die Berliner Toleranz in einem ihrer Werbespots gefeiert. Is mir egal heißt aber auch, du bist mir egal. Du kannst machen was du willst, es kann dir gehen, wie es will, das geht mich nichts an.
Was, wenn sich diese jungen Männer im Stich gelassen fühlen, eben weil man sie toleriert? Was, wenn sie sich jemanden wünschen, der vorbeikommt, und sagt: Das, was ihr hier macht, geht nicht. Es ist nicht erlaubt. Es ist nicht erlaubt, am U-Bahnhof Drogen zu verchecken, sich um unsichtbare Reviere zu streiten, an die Wand des Gebäudes zu pinkeln, Müll liegen zu lassen, hier zu schlafen und Leute zu belästigen. Ist das ausgrenzend, ist das intolerant? Oder ist es das Gegenteil? Erkennt es an, dass hier Menschen in Umständen leben, die menschenunwürdig sind? Erkennt es vielleicht auch an, dass Menschen im Rahmen ihrer Umstände Entscheidungen treffen, für die sie verantwortlich sind? Für die Umstände sind wir zuständig. Zum Beispiel mit einer fehlenden regulierten Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik, mit einer Politik, die, nach Jahrzehnten der Ignoranz, in einer Alarmsituation plötzlich endlich sagt: Refugees welcome und die Migranten dann in Aufnahmeeinrichtungen und, wie gehabt, ohne Arbeitserlaubnis im Duldungsstatus verhungern lässt.
Bei diesen Jungs am Bahnhof geht es nicht um eine Lifestyle-Entscheidung, um sexuelle Orientierung oder kulturelle Vielfalt.
Regeln legen fest, was richtig ist und was falsch. Auweia. Man muss sie diskutieren, sich an sie halten, sie durchsetzen. Das ist alles äußerst unangenehm, uncool und aufwändig, aber Regeln überlassen das soziale Feld und den beteiligten Menschen darin nicht einfach sich selbst.
August 2018 – Urlaub
Hotel 4 Jahreszeiten in Berchtesgaden: Bisschen oll und on the nose bayrisch, Rezeptionistin mit Dirndl, aber ein Hammerblick auf den Watzmann! Sogar beim Frühstück, hübsche Fensterfront. (Nur Autos und Straßen übrigens, wenn man ins Tal schaut, Stau, Lärm, verbaut, Rewe/dm-Parkplatz, diese Bayern, als wenn nix wär. Die Altstadt dann für die Touris.)
Ausflug an den Königssee. Wir fahren mit dem Schiff eine halbe Stunde über den See. Ein Wahnsinnspanorama, das kann fast nicht wahr sein. Die gesamte Watzmannfamilie (hat Frau und vier Kinder) und die liegende Hexe neben, über und hinter uns. Der See ist grün grün grün. Das Boot innen mit Holz, wunderschön. Der Kapitän hält das Schiff unterm Berg an, der Lotse spielt für uns Flügelhorn, wir hören das Echo. Mir kommen die Tränen als der Berg antwortet. Alle sind mucksmäuschenstill.
Wir wandern bis zum Wasserfall, der ist ausgetrocknet. So heiß, dieser Sommer. Felsen, Wiesenblumen. Kuhfladen. Kuhglocken. Kuh.
Dann einkehren auf der Alm, es gibt Milch, Buttermilch und Brot mit Speck oder Käse. Eine Katze, natürlich. Meine Heidi-Prägung rastet voll ein. Der Blick auf den Obersee ist unglaublich. Wir baden darin, das Wasser ist klar, so klar. Man sieht bis auf den Grund. Ich will nicht raus. Das ist der schönste Badeort meines Lebens.
Am gleichen Tag noch schnell der Obersalzberg – Dokuzentrum. Gut gemacht. Toll der O-Ton über Hitler, der sich darin gefiel, abendlich seine Entourage mit seinen Monologen zu langweilen bis sich kaum mehr jemand wach halten konnte. Außerdem Bernile, ein Mädchen, mit dem er sich regelmäßig hat ablichten lassen, Postkarten-Motiv, sie hatte am selben Tag Geburtstag wie er und war so allerliebst deutsch anzusehen. Briefverkehr bis 1938, dem lieben Onkel Hitler. Lächerliche Poser-Fotos von Hitti, sieht immer so gay aus, wenn er da am Baum lehnt oder seinen Hund neben sich hat (Gemein: Jemand hat dem Hitler seinen Hund vergiftet!).
Weiter nach Salzburg. Auf der Bahnfahrt zwei crazy Tussi-Japanerinnen, die eingekauft haben ohne Ende, Koffein-Shampoo und jede Menge Ajona-Zahnpasta, warum auch immer. Sie kruschdeln und verstauen an und um ihre Koffer und ihre Tischchen herum, bis es nervt. Dann sind sie fertig und gucken schmollmundig minirockig ratlos zwischen Koffer und Ablage hin und her, bis der Mann gegenüber ihnen die Dinger hochwuchtet. Als er sie nach oben verschafft hat, klatschen sie, die beiden. Ohmann. Augenverdreher Smiley. Ungebrochenes gender-Rollenverständnis auf höchstem Konsum-Niveau. Nix in der Birne außer Geld ausgeben und einen Mann heiraten, der welches hat. Dazu muss man ihn beklatschen, dann macht er das schon. Der Depp. In Salzburg dann wunderschönes Draußensitzen im Kiosk des Cafe Tomaselli. Ein sich überschlagender Kellner in gebügeltem schwarz weiß.
Weiter – wunderschöne Zugfahrt – nach Triest. Triest sehr schön, Mischung aus österreichisch ungarisch italienisch slowenisch spanisch, alles erinnert an alles Mögliche. Hotel super, mit Mikrowelle und Spüle, aber sehr laut. In der ersten Nacht schlafe ich mit Matratze im Bad. In der zweiten mit Ohrstöpsel. Werde ich geräuschempfindlicher?
Besichtigung des KZs in Triest. Vernichtungslager. Folterungen. Partisanen, Juden. Am Ende, in den 70er Jahren, gab es finally einen Prozess gegen zwei maßgeblich Beteiligte. Der eine starb während des Verfahrens, der andere wurde von Deutschland nicht ausgeliefert und konnte nur in Abwesenheit verurteilt werden. Ist doch schön, wenn man seinen Kindern erklären kann, dass am Ende immer die Gerechtigkeit siegt und ins Gefängnis kommt, wer Böses tut. Tapfer erklärt die Schautafel, dass der Prozess sich trotzdem gelohnt hat, weil er u.a. allen (Neo-)Faschisten zeige, dass sich dieser Quatsch auf Dauer nicht auszahlt.
Sehr besonders hier: Die Badegewohnheiten der Triester. Sie liegen auf ihrer Beton-Promenade (bei uns würde man sagen aufm Gehweg) die ganze Küste am Meer entlang. Wie die Robben. Ab und zu eine Limonata oder ein capu en bi in einem der hübschen Kioske. Sehr sehr sehr entspannt, die Triester. Es wird viel gelesen, fällt mir auf.
Sehr leckere Bäckerei. Die besten Mini-Pizzen ever.
Ausflug nach Muggia. Fast noch schöner. Sehr idyllisch, Fischerdörfchenmäßig. Wir fahren bis ans Ende der Küste, wo ein Sandstrand sein soll, da ist da plötzlich Slowenien. Mit EU-Schild.
Überall mal Plakate von amnesty: Verita per Giulio Regeni. Er wurde aller Wahrscheinlichkeit nach von den ägyptischen Geheimdiensten gefoltert und ermordet. Student, der seine Doktorarbeit über ägyptische Politik schrieb, kritische Artikel zur Regierung in Il Manifesto veröffentlichte. Hat zu ernsthaften Spannungen zwischen Italien und Ägypten geführt. Na sowas. Haben wir beide nie von gehört.
Sehr leckere Törtchen in der Pasticcheria. Die Kaffeehäuser sind gar nicht sooo doll wie überall behauptet, eher langweilig eingerichtet, San Marco ist ganz hübsch mit Buchladen, und Stella Polare schon wegen des Namens. Capu en bi ist, was man hier trinkt: Espresso macciato im Glas.
Wir gehen essen in einer kleinen Seitenstraße, sehr schick, sehr lecker. Beef Salad, Sepia Salat. Abends laufen wir auf der Piazza mal an ein paar Opernarien vorbei.
Ljubljana. Sehr nett, bisschen zu viel Rotenburg ob der Altstadt, laut T., ich finds okay. Eher Studi-mäßig. Überraschend wenig Real-Soz, sehr westlich. Rooftop Bar auf dem Wolkenkratzer von 1933 (means: 13 Stockwerke). Auch der architektonisch eher New York als Platte. Im Schwimmbad wenig los. Lange Reihen mit Umkleidekabinen, schöne alte Fotos aus den 70ern, 6 Euro Eintritt, holla. Abends fantastisches Essen im Slovenska Hisa, slowenisches Haus. Wein aus dem Karst, sehr lecker.
Toller Urlaub! Ab nach Hause. Und Angst.
August 2018 – Schwimmen 4
Neuste Nachrichten aus dem Schwimmbad (Ljubljana):
Jetzt geht auch Toter Mann rückwärts und ohne Hilfestellung.
August 2018 – Neues vom Körper
Bauch.
Ich hatte nie einen Bauch. Jetzt ist er da. Ich weiß nicht, warum. Laktose, Fruktose, Essen im Allgemeinem oder im Besonderen. Ich schwemme auf. Vielleicht die Hormone, der Stoffwechsel? Ich konnte nie essen. Jetzt fresse ich. In großer Unruhe tanze ich um den Verzicht. Vergeblich. Die Qualle reicht schon über die Hüftknochen, lässt sich greifen wie ein Teig.
Das ganze Morphing. Ist mir neu. Ich staune über die Verformungen. Alles drückt und schiebt sich. Nach unten weg, nach vorne oben. Wirbelsäule, Organe, alle in Aufruhr, alle wollen woanders hin, drängen nach neuem Platz. Unaufhaltsam verwandele ich mich, langsam aber stetig werde ich zu der taillenlosen Flach-Po-Frau, die zu sein ich bestimmt bin, mit vereinzelten störrischen Oberlippen-Barthaaren, denen man nur mit Ausreißen beikommt. Nackenhügel, Cellulite, Rillen in den Nägeln. Das ist die Zukunft.
Kannste nix machen, wie meine M. zu sagen pflegt.
August 2018 – Wetteraufzeichnung 2
Alexander Gerst schickt erschrockene Bilder von Europa: Alles braun und vertrocknet.
Waldbrände übelster und infernalischer Sorte in Schweden, Griechenland, Brandenburg.
Forscher sagen eine Heißzeit voraus.
Der Diesel bleibt.
Der Hambacher Forst muss gehen.
August 2018 – Wetteraufzeichnung 1
Best! summer! ever!
Mir gehts großartig.
August 2018 – Vau We
T. und ich machen eine Werksbesichtigung bei VW in Wolfsburg.
Das Augenfälligste: Menschen braucht hier kein Mensch mehr. Auch unser Guide von der Presse-und Öffentlichkeitsarbeit macht da keinen Hehl draus (hat er vielleicht noch vor ein paar Jahren, aber jetzt, nach D-Skandal und mitten in der Umstellung auf E-Auto, muss man auch hier kein Blatt mehr vor den Mund nehmen). Man kann bei VW schon mit 57 in Rente, es gibt Konzepte für schon mit 55, erklärt er stolz. Da kommt man dann mit einer schönen Abfindung raus.
Wir schauen den Robotern bei ihrem Ballett zu. Wunderschön. Hand in Hand geht das, jeder an seinem Platz, jeder mit seiner Aufgabe, unbeirrt, auch von uns Zuschauern, fügen sie zusammen, kleben, schieben, legen, hieven. Es gibt die orangenen Roboter von Kuka. Und neue, japanische, in gelb, die sind leichter und wirken insgesamt zarter und noch geschickter.
Ein paar Leute noch in der Montage. Die kriegt man aber auch noch weg. Im Moment arbeiten sie schon so ergonomisch, dass sie selbst schon aussehen als wären sie Teil einer Maschine: Fahrbarer Sitz unterm Hintern, maschinelle Unterstützung bei der Überkopfarbeit usw. Also Stress haben die nicht, aus der Perspektive der Roboter wirken sie wie seltsame Tiere, die Lambada hören und sich langweilen. T. fragt nach Exo-Skeletten, der Guide sagt, nee, unser Ziel ist ja Industrie 4 Punkt Null. Da wollen wir hin. Ich weiß nicht, ob er weiß, was 4 Punkt Null eigentlich ist, ob das überhaupt irgendjemand weiß, aber die Null klingt nach dem, was er sagen will: Wir arbeiten daran, dass hier keine Menschen mehr gebraucht werden. Gar keine mehr. Die Vier-Punkt-Nullifizierung der menschlichen Arbeitskraft. Solange daran gearbeitet wird: Fine with me. Ich hab da kein Problem mit. Und die VW-Arbeiter auch nicht, die sind so abgesichert und gut verdienend, davon können die Leute, die ich kenne, allesamt nur träumen.
Am Ende der Produktionsstraße gibt es noch ein paar Leute, die gucken, ob die Maschine alles richtig gemacht hat. Prüfung. Überwachung. Das wird bleiben. Die einzige und hochqualifizierte Arbeit, die hier, in dieser gigantischen Halle (die ich mir höher vorgestellt habe und die noch Einschusslöcher nicht aus dem Nationalsozialismus, nein „aus dem Krieg“ zieren, als hier „keine Autos, sondern Rüstung produziert wurde, ehrlich gesagt“, so unser Guide) vorhanden ist, ist in den Robotern versteckt. Eine Arbeit, die woanders stattgefunden hat, in einem Büro mit flachen Hierarchien, gesunden Snacks und Tischtennisplatte wahrscheinlich, in einem anderen Land, auf einem anderen Kontinent (Japan), bei den Software-Ingenieuren und Maschinenbauern. Eine Arbeit, die einmal getan wurde, um sie seitdem nur noch upgraden zu müssen. Und im Produkt selbst, im Auto, da kann man sie auch noch finden, bei den Designern und Marketing-Leuten zum Beispiel. Die trumpfen auch in der ans Werk angrenzenden „Autostadt“ so richtig auf: Ein riesiges Disney-World-Gelände rund um die Marke VW und ihre Töchter. 15 Euro Eintritt, um sich in spektakulär designten Gebäuden Image-Kampagnen ansehen und sich eine überteuerte Curry-Wurst und VW-Schlüsselanhänger kaufen zu dürfen. Wow. Baudrillard fällt mir ein, Simulacrum.
Außerhalb des Werksgeländes sieht man Aufkleber: 30 Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Warum nicht für alle, denke ich. Warum nur für VW-Arbeiter? Ist doch viel besser als das Grundeinkommen.
August 2018 – Kotze
Ich gehe im Café aufs Klo. Vor mir kommt eine junge Frau aus der Kabine. Groß, schlank, aufrecht, etwas strenger Typ, Asiatin. Ich gehe rein, es stinkt nach Kotze. Bulimie, denke ich.
(Immer diese leise Abfälligkeit gegenüber den Krankheiten der Frau.)
August 2018 – So
Es gibt, das ist bekannt, tolle Wörter im Deutschen. Wonneproppen zum Beispiel. Oder: Augenblick. Herzeleid, Sehnsucht, Heimweh, terrassenförmige Stahlmuffen – alles großartig. Aber das beste Wort von allen ist
So.
Schon allein ästhetisch macht es was her. Das große geschwungene S zusammen mit dem kleinen runden o – ein austariertes Team, die Freude eines jeden Typografen, was soll man diesen beiden noch hinzufügen, da muss man nicht mehr viel machen, die funktionieren fast von allein, hat man die, hat man alle.
So, das sind zwei, die zusammengehören, Kumpels, buddies, Don Qichotte und Sancho Panza, Freundinnen auf Lebenszeit: Die große S, mit ihrer perfekten Figur, ihrem freundlichen, in sich ausbalancierten Schwung und ihrem Hang zur Skoliose, und o, klein, immer nach vorne, eindeutig, dennoch Fragen aufwerfend, mit einer Neigung zum Adipösen. Auch wenn es klein daherkommt, hat so Ernst-Jandl-Potential. Und im Gesprochenen erst! Was für eine Schönheit es da entfaltet. Schlappe zwei Buchstaben – ungewöhnlich wenig für ein Wort der deutschen Sprache – und ein Feuerwerk an Möglichkeiten. So ist praktisch chinesisch. Das chinesischste Wort, das wir haben. Je nach Intonation verändert es seine Bedeutung. Ob kurz oder lang gesprochen, pfeilspitz oder im Bogen, so hat immer was zu sagen. So ist Anfang und Ende. So ist Übergang. Abgrenzung und Annäherung. So ist Aggression und Liebe.
So (dann wollen wir mal).
So (das wär geschafft).
So (geht das).
So (jetzt hab ich dich da wo du hingehörst).
So (da hast du’s).
So (oder gar nicht).
So (dann schaun wir mal).
So (jetzt reichts mir aber).
So lässt sich rufen, seufzen, dehnen. So reicht vom Spöttischen bis ins Verächtliche. So kann eine Frage sein oder eine Anordnung. Mit so kann man auf den Tisch hauen, die Arbeit beginnen, ein Gespräch beenden oder Sex haben. Mit so kann man Kinder erziehen, die Welt erklären, das Umfeld verärgern. Mit so lässt sich anmoderieren, abmoderieren, kommentieren, nachhaken. Mit einem so kann man sein Leben ändern, jemandem Suppe bringen, eine Spritze verabreichen. So strukturiert Zeit, Raum und Bewegung. So begleitet uns durch den Tag. So ist ein offenes Wort. So ist ein Beziehungswort. So ist das einzige, gesellschaftlich anerkannte Wort, das man zu sich selbst sagen kann. So verbindet sich gerne mit anderen sos. Zum Beispiel zu Soso. Solala. Sosososo. Oder Achso.
Ich liebe so so sehr.
Laut Duden ist so übrigens ein Adverb oder eine Konjunktion. Das wird der Sache ja wohl nicht ansatzweise gerecht.
August 2018 – Schwimmen 3
Ich trete mein Hirn. In Pfade.
Ich verknüpfe, stelle Verbindungen her, setze Knoten.
Ich lege und lagere und schichte übereinander: die Erfahrung des Körpers im Wasser. Der Nase, des Munds, der Ohren, der Augen. Ich überzeuge mein widerspenstiges, widerstrebendes, ständig Lebensgefahr witterndes (Ersticken, Fallen, Ertrinken), sich in höchster Alarmbereitschaft, im Panik-Modus befindendes Gehirn. Davon. Dass es gut ist. Unter Wasser zu sein. Dass es Luft geben kann, ohne an der Luft zu sein. Dass es Versorgung geben kann, in einer unwirtlichen Umgebung. Dass das Wasser kein Abgrund ist. Dass es Bewegungen geben kann, die Kontrolle bedeuten.
Immer wieder. Fange ich von vorne an.
Aber so langsam.
Wird’s.
Und ich sehe das pinke Kaugummi, das eines der Kinder an den Boden des Beckens geklebt hat.
Raufholen könnt ichs aber immer noch nicht.
(Kein Seepferdchen.)
Juli 2018 – Schwimmen 2
Um mich herum. Spritzt und schreit und kreischt es. Es plumpst und platscht und juchzt. Es zieht unbeirrte ehrgeizige Bahnen oder raddampfert rücklings, die Nase gen Sonne gereckt.
Man springt und hüpft und wirft sich. Man flundert am Boden entlang oder pfeilt den Kopf, die Beine hochzus. Man rutscht und flatscht und flutscht. Man taucht auf und ab, dreht sich und schmeißt sich. Man ist scheu und zart oder laut und kraftvoll. Man rangelt und gruppt. Man dümpelt und spricht. Man friert und bleibt trotzdem drin.
Ich stehe und sehe. Ich staune. Und frage mich: Wie – verdammt nochmal zur Hölle – macht ihr das? Woher! Wisst ihr, wie das geht?
Juli 2018 – Jawoll, Mama
Möglicherweise kriegen die Leute ja auch Kinder, weil sie dann endlich mal der Chef von jemand sein können. Beziehungsweise der Oberbefehlshaber.
Heute im Buchladen, Mutter zu Sohn: Schnürsenkel! Nicht anfassen! Du kannst da hingehen, aber wenn ich dich rufe, kommst du zurück. Hast du mich gehört? Schau mich an. Ich hab gesagt: Lass es!
Ach, was für ein herrliches Gefühl. Besonders für Frauen.
Juli 2018 – annehmen
Gestern bei Galeria Kaufhof oben im Cafe. (dreckig, teuer, hässlichste Einrichtung der Welt. Trotzdem, aus irgendeinem mysteriösen Feng-Shui-Grund kann ich hier gerade gut schreiben.)
Eine Frau, ca. 70, lebhaft, hübsch frisiert, kommt zu mir, und fragt: Wollen Sie mein Bändchen haben? – Whaat? – Is ja wie aufm Festival hier!
Sie hat ein Bändchen aus Papier am Handgelenk, das bekommt man hier, wenn man sich ein FrühstücksBufett für 10 Euro kauft und da darf man mit dem Bändchen nochmal Nachschub holen, erklärt sie mir. Ich freu mich total und sage ja klar, gerne, und: das ist aber nett, und sie zieht das Bändchen ab, und wir probieren, obs mir passt und es passt, na klar, hab ich mir gedacht, sagt sie, sie ham ja auch so schlanke Arme, auch deswegen hat sie mich gespottet, ein bisschen, denke ich. Sie freut sich riesig, dass sie „der netten, jungen Frau, die hier so fleißig arbeitet“, eine Freude machen kann (nett, jung, fleißig, wenn die wüsste…). Aber das tut sie wirklich. Ich lasse es einfach laufen, lasse es zu, lasse diese mütterliche Freundlichkeit auf mich einregnen. Auch weil sie sich so freut. I made her day, das kann sie heute jemandem erzählen: Und dann hab ich gedacht, ich brauch das ja nicht mehr, ist ja eigentlich schade drum, das wär doch auch Verschwendung, und die junge Frau sah nett aus und hat sich so gefreut.
Ich hole mir dann doch nichts mehr. Hatte gestern den ganzen Tag Durchfall.
Juli 2018 – Spermaneid
T. erzählt mir von einer Werbung, die er kürzlich in der U-Bahn gesehen hat. Man kann Geld verdienen – „mit Samenspenden“, ergänze ich prompt. Die Werbung hab ich nämlich auch gesehen und aus irgendeinem seltsamen Grund weiß ich sofort, was er meint.
80 Euro pro Sperma, jubelt er. 80 Euro pro Spende, korrigiere ich. Wenn es pro Sperma wäre, wärst du ja nach einmal schon Millionär. Oder Milliardär? Genau!, lacht er fröhlich. Klar, sage ich, warum nicht etwas so absolut Großartiges und Kostbares wie das männliche Sperma, das sonst einfach immer nur so lapidar an- und abfällt und von niemandem weiter beachtet wird, endlich mal wieder mit Respekt, Achtung und Wertschätzung behandeln – und damit stilvoll Geld verdienen? Wird doch eh jeden Tag ein-, zweimal was von diesem Glibber-Zeug an die Luft transportiert, das sind dann 80 bis 160 Euro täglich für etwas, was sonst einfach in der Bettdecke aufgesaugt, mit dem Taschentuch weggewischt oder im Dusch-Abfluss runtergespült wird. Klar! Make Sperma great again!
T. ist still geworden. Ich werde lauter. Ich erkläre T. deutlich, dass er nicht glauben muss, dass bei diesen Datenbanken jedes dahergelaufene Sperma genommen wird. Knallharte Auswahlkriterien gibt es da! Männer im fortgeschrittenen Lebensalter zum Beispiel oder mit Hang zur Glatze, sind nicht besonders gefragt. T. sagt jetzt gar nichts mehr. Ich rede umso mehr weiter. Außerdem, sage ich, stell dir vor, ich käme an und würde dir erzählen, ich verdiene jetzt Geld mit meinem Menstruationsblut. Oder mit meinen Eiern. Beides übrigens – typisch mal wieder – bei Produktion bzw. Entnahme für die Frau mit Schmerzen bzw. Eingriff verbunden. Und im Fall von Menstruationsblut wird es wirklich von nichts und niemandem gebraucht. Während der Mann also schmerzfrei mit seinen Ergüssen Geld verdient, ja, sogar Spaß dabei hat, sie abzusondern – die Frau natürlich wieder: eine einzige Leidensgeschichte, na, danke, sage ich, und: Dass das ganz reale Konsequenzen hat, darüber denkt natürlich auch keiner nach. Am Ende ist das ein Kind, ein menschliches Wesen! Das steht dann eines Tages vor deiner Tür, mit seinem Hang zur Glatze und seinem fortgeschrittenem Alter, und sagt: Hallo, ich bin dein Sperma. Willst du das wirklich? Aber so ist das, wenn man Leuten in der U-Bahn erzählt, sie können mit Nichtstun Geld verdienen.
Ich schaue T. an, der jetzt traurig aussieht. Es tut mir leid, sage ich, und muss beinahe weinen. Weil ich so gemein war. Ich beteure, dass sein Sperma das beste ist, dass er so viele Kinder machen kann, wie er möchte, weil die alle großartig sein und die Welt verbessern werden, und dass ich, wenn ich mir ein Sperma aus der Datenbank aussuchen müsste, seins nehmen würde, aus tausend anderen, weil ich seine Fortgeschrittenheit als Erfahrung schätze und seinen Hang zur Glatze attraktiv finde, und dass ich wirklich für jedes einzelne seiner Spermien 80 Euro hinblättern würde, nicht nur für die gesamte Spende.
Okay, sagt er, und wir umarmen und küssen uns. Dann fällt ihm ein, dass er gar keine Spermien mehr hat. Die sind ja bei der Vasektomie ein für alle Mal drauf gegangen.
Juni 2018 – schwimmen 1
Die überdimensionale Schwimmbrille im Gesicht beunruhige ich das Aufsichtspersonal des Prinzenbads und irritiere die Mitbadenden mit meinen kläglichen Schwimmübungen, meinem angstverzerrtem Gesicht, abruptem Auftauchen, panischen Bewegungen, mit meinem Kampf um Luft, Koordination und Ruhe, mit meinem Kampf gegen die ANGST. Aber das ist mir egal. Ich mach mich hier zum Affen. Und zwar so lange bis ich endlich im Wasser sein kann, wie andere Leut‘ auch. Bis ich geschafft habe, was mir verwehrt wurde, danke, liebe Arschloch-Eltern, dann mach ichs eben selber, wie immer, mühsam und zur Unzeit.
Ich lerne schwimmen.
Juni 2018 – happy chicken oder Religion und Fleisch
1 Im Kiosk im Prinzenbad ein junger Mann, seine Frau hält sich hinter ihm, er hat das kleine Kind an der Hand. Er bestellt zweimal Pommes bei dem Typ hinterm Tresen. Fragt, aus was für Fleisch die Buletten sind. Schwein, sagt der Mann. Kurze flüsternde Rücksprache auf Deutsch mit der Frau hinter ihm. Dann dreimal Pommes bitte, sagt der Mann.
2 Muslime essen kein Schweinefleisch, ist voll haram, die Hindus kein Rind, die Kuh ist heilig. Das einzige Tier, das überall auf der Welt gegessen wird, ist das Hühnchen. Es ist niemandem heilig und gilt niemandem als haram, es hat das große Los gezogen und wird von allen Religionen gefressen. Ah, warte, auch Lamm, Ziege, Fisch – haben alle Glück.
Juni 2018 – alt
Kürzlich bei Mango. Ich stromer so rum, da kommt eine junge Frau rein, vielleicht 19, zusammen mit ihrem Freund. Ihr Blick streift kurz über Kleiderständer und Kundinnen, trifft auf mich – Nee, komm, gleich wieder raus, sagt sie zu ihm, hier gibt’s eher so Sachen für meine Mutter.
Ich bin verblüfft. Sie hat recht, ich könnte ihre Mutter sein. Ich bin schon lange alt genug, um eine 19jährige Tochter zu haben. Trotzdem versetzen mich solche Situationen immer in Erstaunen. Denn ich vergesse, dass ich alt bin. Ich vergesse, dass mir etwas ins Gesicht geschrieben steht. Dass Menschen etwas sehen, was ich nicht sehe. Innen ist anders als außen. Außen macht etwas sichtbar, was sich Innen oft anders anfühlt. Da ist ein Missverhältnis.
Ich fühle mich auf Du und Du mit z.B. Baristas oder Studierenden in der Bibliothek, oder flüggen Kinder von jemandem, und dann stelle ich fest, dass die sich ganz weit weg fühlen von mir. Dass die mich siezen, weil sie allen Grund dazu haben. Wie die junge Frau bei Mango eben. Ihr Leben hat nichts mit mir zu tun und will es auch gar nicht. Ich bin darin höchstens so etwas wie eine Institution: Eine Erwachsene. Ich lebe in einer anderen Welt als sie, und diese Welt ist dumm, bescheuert und interessiert sie nicht.
Ich schäme mich dann. Mir ist das peinlich. Als hätte ich einen blinden Fleck. Als könne jeder es sehen, nur ich nicht.
Kürzlich in einem kleinen Club. Alle Anwesenden sind in ihren Zwanzigern. Bis auf mich, ein paar Freunde und die DJs. Als T. mich küsst, ist mir das ein bisschen peinlich.
Als ich die Freunde frage, ob es ihnen nichts ausmacht, dass alle hier so jung sind, sagen sie, wieso, die können froh sein, dass so ein paar alte Leute da sind. Da fühlen sie sich sicher und es gibt ihnen das Gefühl in einem coolen Club zu sein. Ich hingegen denke, die denken, wenn ich meine Mutter sehen will und hässliche alte Leute, die eklig rumknutschen, kann ich auch zu Hause bleiben.
Juni 2018 – Süddeutschland
Die Leute haben Kinder, Bäuche, Wohnungen, Autos, Festanstellungen, Vereine, Familien, Terrassen, Hobbys, Gärten, Versicherungen, Urlaube.
Ich habe nichts davon. Ich fange an, mich schlecht zu fühlen. Dabei bin ich weder gerne gekommen noch fahre ich ungern wieder weg. Trotzdem. Hängen sie mir nach, diese Leben, selbst gebaut und gut eingerichtet wie die Häuser.
Mein Leben ist kein Haus. Mein Leben ist ne Hängebrücke, über die ich mich entschieden habe zu gehen.
Juni 2018 – M.
Die Slipeinlage kommt in den Schuh.
Die Fernbedienung gehört in das Mittelfach der Handtasche.
Das Geschirrspüler-Tab muss aus dem Plastik gewickelt werden. Dann kann man es dem Kind reichen das freut sich.
Das goldene Spiegelchen wird aufgeklappt und hingestellt. So dass der andere es sehen kann.
Das Taschentuch wird ins Quadrat gebracht. Dann wird es rüber geschoben, zweimal darauf getippt, wie auf ein Geschenk, das kannst du nehmen, das kannst du ruhig haben, für dich.
Die Seiten im Album müssen geblättert werden. Auf die Personen auf den Fotos muss gezeigt werden. Dazu muss gesprochen werden. Auch am Telefon muss gesprochen werden. Oder wenn man jemanden trifft, auf der Straße. Oder Besuch kommt. Freundlich, hell, voller Begeisterung muss etwas erzählt werden. Es muss geschimpft werden, oder sogar getreten. Weil es nicht klappt. Weil er es nicht kann oder weiß oder richtig macht. Oder es wieder so macht. Weil er unmöglich ist.
Was muss ich jetzt?
Es muss Geld mitgenommen werden. Es muss sich beeilt werden. Es muss in die Bahn gestiegen werden. Achso. Ja. Nein. Nur du steigst in die Bahn.
Mai 2018 – drüber rutschen
Ich bin mit ein paar Leuten in einem Park. Es ist warm, sonnig, es gibt Musik.
Eine Freundin, die Online Dating macht, sieht von weitem einen Typen, mit dem sie demnächst ein Treffen hat. Praktisch, lacht sie, kann sie vorher schon mal checken, wie der so ist. Er hat sein T-Shirt ausgezogen, rennt oben ohne rum. Ist eh so einer, sagt sie, so ein cooler DJ, postet immer gerne Fotos von sich, so beide Hände an den Plattentellern. Ohne Shirt jedenfalls noch praktischer, sagt sie. Sieht man gleich, was drunter ist. Was man so geboten kriegen würde. Und? sage ich, genügt er den Ansprüchen? Wenn er höflich ist, sagt sie, und sich was anzieht, wenn er sich benehmen kann, dann spricht nichts dagegen. Dann gibt es keinen Grund, da nicht mal drüber zu rutschen, sagt sie, und lacht.
Sie meint es witzig, sie meint es ein bisschen wie ein Zitat, etwas was Männer sagen würden.
Ich finde es trotzdem unangenehm.
Ich finde es traurig. Und wenn ich der einzige Mensch auf der Welt bin, den es traurig macht, dass man sich lieblos und objektivierend begegnet, dann ist es eben so. Ich weigere mich, das normal oder okay zu finden.
(Und dass das jetzt auch für Frauen gilt, macht die Sache nicht besser. Ist ja schön, dass die jetzt auch alle gleich scheiße sein und daherreden dürfen, dass es auch für Frauen um geile Ärsche gehen darf, aber vielleicht hat ja auch einfach nur das männliche Prinzip gesiegt. Wir haben jetzt Zugang zu unseren Bedürfnisse und Vorstellungen und bedienen uns selbstbewusst an der Auswahl im Regal, wir entscheiden mit Shopping-Blick, mit Was bringts mir-Blick, mit wem wir uns abgeben wollen, formulieren, ganz verbrauchergeschützte Kundin, unsere Kaufentscheidung und bekommen, was wir wollen – sofern wir selbst etwas Adäquates anzubieten haben.)
Aber statt das zu sagen, lache ich mit. Warum bloß? Ich bin älter als sie, ich kenne das dumme, hilflose Gerede, das Versteckspiel des Zynismus, den zur Schau getragenen Durchblick. Ich sehe, dass sie eigentlich auch traurig ist. Dass sie es vergräbt unter witzigen Sprüchen und Machogehabe. Dass sie sich eigentlich was anderes wünscht. Ich nehme mir das tagelang übel, dass ich nichts gesagt habe. Dass ich mitgemacht, sie noch befeuert habe, statt zu sagen,
du weißt schon, dass das auch ein Mensch ist.
Aber was soll sie auch machen. Sie hat keine Beziehung. Sie wünscht sich eine. Also tindert sie durch die Welt, nimmt Kontakt auf mit dem Markt und den Möglichkeiten, einer rechts, einer links, einen fallen lassen. Nimmt sich selbst wahr als etwas, was auf diesem Markt bestehen muss. Und am Ende kommt vielleicht wenigstens Sex rum. Und ist der nicht eh viel besser, wenn er lieblos und objektivierend ist? Berührt der einen nicht manchmal mehr als alles andere, zumindest für den Moment? Ist eine Beziehung mit ihren Mustern wirklich toller als einfach nur geil und begehrenswert gefunden zu werden? Kann man überhaupt noch eine Beziehung führen, wenn man sie eingekauft, ausprobiert und abschließend beurteilt hat? Oder funktioniert es womöglich eh nur so? Ist das Prinzip Beziehungs-Deal nicht ehrlicher als dieses Gerede von der Liebe? Ist es nicht immer so, dass es darum geht, ob der der andere etwas ist, kann, macht, liefert, damit man mit ihm zusammen bleibt, damit es sich lohnt? Sind begehrt werden, Sex haben und Beziehung nicht sowieso zwei Sachen, die man endlich mal als getrennte akzeptieren sollte? Ist meine Haltung vielleicht einfach nur moralinsauer und diese Idee von Liebe, die rettet, die trifft, die sich uns entzieht, einfach nur idiotisch esoterisch?
Make love great again, suckers.
Mai 2018 – youtoo
T. gewinnt einen mit 10.000 Euro dotierten Preis. Eine Freundin, der er es in meiner Anwesenheit erzählt, sagt spontan zu mir: Jetzt hast du da einen Millionär.
Bei der Verleihung des Preises, wiederum eine andere gemeinsame Freundin. Fragt mich: Und, bist du stolz? Ich sage, ja, klar, du nicht? Sie: Wenn er dir jetzt Schuhe kauft.
Ladies – was ist los mit euch? Schuhe, Millionär? 2018, really?
Was schlüpft da raus, für einen Moment? Denn beide Frauen sind weder doof, noch unreflektiert, noch komplett hinterm feministischen Mond. Was für eine Sehnsucht wird da offenbar? Was für eine Grundannahme? Dass es doch das ist, was wir Frauen alle wollen, wovon wir träumen: von einem Mann, der reich ist und uns versorgt, und zwar mit Schuhen? Der uns auf Händen trägt, weil wir in den Schuhen nicht laufen können?
Diese unangenehme Annahme von Gleichheit auch, diese augenzwinkernde Eingemeindung in eine Schwesternschaft, dieses Pendant zum männerbündischen Kneipengespräch, das mir hier aufgedrückt wird, so von Frau zu Frau, vorbei am Mann auch, der mit am Tisch sitzt, zuhört, seine Objekthaftigkeit miterlebt.
Sexismus unter Frauen ist das. Youtoo, fasst euch mal an die eigene Nase.
Mai 2018 – Kentucky Fried Dove
Gestern vorm Kentucky Fried Chicken am Alex: Eine Taube pickt an einem herumliegenden Hühnerknochen herum.
Erstens. Fressen die jetzt auch schon Fleisch?!
Zweitens. Ist das nicht Kannibalismus?! Hühner sind doch auch Vögel!
Ekelhaft.
Mai 2018 – Transaktionsanalyse
Die Transaktionsanalyse, so lerne ich, spricht vom Eltern-, Kind- und Erwachsenen-Ich. Die Ichs teilen sich wiederum auf in Unteraspekte. Das Eltern-Ich beispielsweise teilt sich auf in einen strengen Teil und einen fürsorglichen Teil.
Überall auf dem Papier sind Kreise. Ich schreibe rein. Sätze, die gefallen sind, bzw. sich in meinem Kopf als Wahrheiten gebildet haben, Handlungen, die getätigt wurden, bzw. mir in Fleisch und Blut übergegangen sind.
Am Ende ist alles vollgeschrieben, nur ein Feld bleibt leer. Da, wo der fürsorgliche Aspekt des Eltern-Ichs gefüllt werden soll, bleibt eine hartnäckige Lücke. Es will mir partout nichts einfallen.
Das geht vielen Menschen so, sagt die Therapeutin.
Mai 2018 – Biene
Ich sitze in meinem Liegestuhl auf meinem Balkon und lese. Eine Biene kommt und fliegt zielgerichtet – im Nachhinein denke ich: war sie schon öfter hier? – in ein Loch in meinem Fensterrahmen.
Ich bin überrascht.
Das Loch hat einen Durchmesser von knapp 2 Zentimetern und ist vielleicht drei Zentimeter tief, so tief wie mein Fensterrahmen eben. Ist mir noch nie aufgefallen, das Loch, keine Ahnung wozu es gut ist. Noch weniger aber verstehe ich, was die Biene da drin will. Ich bin alarmiert. Legt sie da drin Eier? Kann eine Biene sich in einem so winzigen Loch vermehren, ein Königinnenreich aus Bienen errichten, mir den Sommer verderben mit ihrem Summen und Brummen und Stechen? Ich müsste das wissen, so viele Artikel und Bücher wie über Bienen erschienen sind, ich müsste die Biene und ihr Königinnenreich auf meinem Balkon nicht nur tolerieren, nein appreciaten müsste ich sie, so vom Aussterben bedroht und wichtigwichtig für uns alle und die Umwelt sie ist. Aber ich bin ein Arschloch und will meinen Balkon für mich alleine haben. Was also tun? Ich schaue vorsichtig ins Loch. Sie ist immer noch drin. Der Länge nach, Po zu mir, Kopf nach vorne, sie kann sich da drin nicht mal umdrehen. Sie verharrt, ich sehe, wie ihre Fühler vorne ein bisschen tasten. Gibts in diesem sinnlosen Dreckloch irgendwas was ihr schmeckt?
Ich lese weiter. Drei Minuten später, sie ist immer noch drin. Was will sie denn da? Ich ärgere mich. Ich traue ihr nicht. Tiere habe doch immer was zu tun. Sie sind die getriebensten Streber auf dem ganzen Planeten, Ich-AGs, rund um die Uhr unterwegs, im Auftrag von Leben und Sterben inc., ganz besonders die Bienen. Ich nehme ein Streichholz und zünde es an. Ich halte es vor das Loch, puste es aus, es qualmt, stinkt nach Schwefel. Ausräuchern nennt man das. Ich bin so ein Arschloch. Hastig werfe ich das Streichholz weg.
Ich halte meinen E-reader vor das Loch, drücke ihr die Luft ab. Nur ganz kurz. Sauerstoff-Entzug. Weg, das Buch. Sie kommt nicht raus. Ich zünde ein Teelicht in einem Glas an, stelle es direkt vor das Loch, vielleicht verdirbt ihr das Licht den Aufenthaltsort. Bisschen Abstand zwischen Glas und Loch ist noch, aber nicht genug für sie, um rauszukommen. Ich lasse das Licht etwas eine Minute brennen, dann nehme ich das Glas weg.
Sie fliegt raus.
Ich fühle mich schlecht.
All das Biene Maja gucken. Nichts genützt.
Vielleicht wollte sie einfach nur ihre Ruhe, wie ich. Vielleicht wollte sie einfach nur mal weg vom summenden brummenden Bienenstab, in dem die Anforderungen hoch sind, der Arbeitstag lang, das Regiment straff, das Überleben schwer, wollte ein paar Minuten ausruhen, an einem ruhigen, kühlen Zufluchtsort, um einen Moment durchzuatmen, nachzuspüren, was das ist, das Leben. Ein Ort, an dem sie einfach nur mal ein paar Minuten lang eine sinnlose Biene sein kann.
Ich bin so ein korrumpiertes Arschloch. Warum konnte ich sie nicht einfach in Ruhe lassen.
Mai 2018 – Plazenta
Ich gehe mit einem Freund im Park spazieren. Er bleibt stehen, deutet auf eine kleine Baumgruppe. Hier, sagt er, liegt die Plazenta meines Sohnes begraben. Iiiih, schreie ich, und es tut mir im selben Moment furchtbar leid, aber ich kann nicht anders.
Ich frage ihn, wie eine Plazenta aussieht (wie eine Leber aber nicht so glatt, viel knubbligere Oberfläche), ob man die im Krankenhaus einfach so ausgehändigt bekommt, ob er sie im Kühlschrank aufbewahrt hat, in Plastik gewickelt hat (ja, ja und ja). Bei Nacht und Nebel hat er sie vergraben, während daheim Frau und Kind im Wochenbett lagen, getrieben von der Angst, nicht tief genug zu buddeln, so dass ein Hund sie finden und fressen könnte.
Seitdem gehe ich nicht mehr entspannt durch Parks. Hinter jeder Baumgruppe lauert eine Plazenta.
Mai 2018 – M.
B. reicht M. das Telefon: Hier, willst du mal telefonieren, Elli ist dran.
Elli?, sagt M. was für eine Elli, ich kenn keine Elli.
Convenient. Komme ich nicht umhin zu denken.
Später denke ich: Für wen.
Mai 2018 – Tod durch Tod
T. erzählt von einem Freund, dessen Mutter gestorben ist.
Echt, sage ich, warum?
Tod, antwortet T.
April 2018 – wer wen. und warum
Eigentlich ist es so:
Ich finanziere meinen Job,
nicht mein Job mich.
April 2018 – refugee trumps woman trumps refugee
T. und ich fahren mit der S-Bahn. Es ist sehr voll, die Leute stehen dicht gedrängt. Am Alex steigen wir aus, auf dem Bahnsteig ist es eng. Plötzlich schlägt eine Frau, vielleicht 27, blond, lange Haare, sportlich-prollig gekleidet, direkt neben uns einem jungen Typen ins Gesicht, einem Refugee. Er ist mit drei anderen Jungs im Schlepptau unterwegs. Sie schreit ihn an, beschimpft ihn, haut nochmal, Oberkörper, Gesicht, er hebt den Arm zum Schutz, protestiert zuerst nicht, dann in gebrochenem Deutsch.
Ich hebe beschwichtigend die Hände, ist ja gut jetzt, sage ich zu beiden. Auch T. versucht, zu beruhigen. Die Menge im Fluss, zwei Meter bis zur Rolltreppe, alles in Bruchteilen von Sekunden, der Typ labert irgendwas in Richtung der Frau, von wegen ich spreche deine Sprache nicht, da schwappt ihre Wut nochmal hoch, sie beugt sich rüber, klatscht ihm nochmal eine ins Gesicht. Hey, ist gut, jetzt, sage ich nochmal, diesmal nur zu ihr. T. sagt: Die wehrt sich wenigstens.
Okay. Wow. Analyse, bitte.
Eine Frau und ein Refugee in einer dicht gedrängten Menge. Sie fängt an, ihn zu schlagen und zu beschimpfen. Ihr Schimpfen gibt keinen Hinweis darauf, ob und was passiert ist, welchen Inhalt die Auseinandersetzung hat. Die erste Annahme, die sowohl T. als auch ich sofort in unseren jeweiligen Hinterköpfen treffen, ist: Er hat das Gedränge genutzt, um sie zu belästigen.
Meine Reaktion auf die Situation: Ich beschwichtige. In beide Richtungen. Denn was ich wahrnehme, allem anderen vorgelagert, ist: Jemand wird direkt vor meiner Nase geschlagen. Ich sehe Gewalt. Ich will vermeiden, dass die Situation eskaliert, dass er (!) ein Messer zückt.
Was ich auch sehe, ist: Eine etwas prollige junge Frau schlägt einen Refugee. Und in meinem Hinterkopf gesellt sich eine zweite mögliche Interpretation zur ersten: Nazi-Braut haut Refugee.
T.s. Reaktion auf die Situation: Auch er beschwichtigt in beide Richtungen. Er sieht, genau wie ich, die Gewalt, und will keine Eskalation. Er nimmt die Reaktion des Mannes wahr, der die Hände zum Schutz vors Gesicht hebt und eher hilflos protestiert. T. interpretiert das als Schuldeingeständnis. (So wie der reagiert hat, sagt er später. Kannste dir denken, was passiert ist). Und er sieht in der Gewalt, die die Frau ausübt, etwas Wehrhaftes. Und darin wiederum etwas Unterstützenswertes. Die erste Annahme also bestimmt hier sein Verhalten viel stärker als meins: Wir haben es hier aller Wahrscheinlichkeit nach mit einem Täter (Mann) und einem Opfer (Frau) zu tun. Als ich bei ihrem erneuten Ausbruch, nur zu ihr sage: Es ist gut jetzt, sagt T. nichts mehr, sondern lässt sie machen. Formuliert laut: Die wehrt sich wenigstens.
Die Rollenverteilung in unseren Verhaltensweisen ist klassisch – ich, die Frau, richte mich sofort gegen die Gewalt. Er, der Mann, findet, wenn eine Tat vorausgegangen ist, wie die anzunehmende, dann darf und soll sie sich wehren und der Typ ruhig was einstecken. Frau: konfliktscheu. Mann: Siehts sportlich-gerecht. Habe ich also mit meiner Angst vor dem Konflikt, vor der Gewalt, die ich sofort versucht habe, aus der Welt zu schaffen, die Situation zu befrieden, der Frau geschadet, dem Opfer, das sich gewehrt hat?
Sie hat nicht gesagt: „Nimm deine Pfoten weg“. Oder, nach außen gerichtet: „Dieses Arschloch hat mich begrapscht.“ (Muss sie auch nicht, kein Opfer macht irgendwas falsch oder richtig, not my point here). Sie hat auch nicht gesagt: „Hau ab in dein scheiß Afghanistan oder wo immer du herkommst“. Alle getroffenen Annahmen kann man hinterfragen – von der Annahme es handle sich um einen Refugee über die Annahme, dass die Frau Opfer einer sexuellen Belästigung wurde, bis zu der Annahme, dass sie eine Nazi-lady sein könnte, ja sogar die Annahme, dass es sich bei ihr um eine Frau handelt. Wie sind wir zu diesen Annahmen gekommen? Was, wenn alles ganz anders ist? Jedoch: Wir leben in einer WELT. Mit Kontexten, Vorurteilen, Erfahrungen, Mustern, und wir kommen in einer solchen Sekunden-Situation zu Schlüssen und handeln. Impulsiv, aus dem Bauch heraus.
Ich habe nicht das Gefühl, mich ihr gegenüber richtig verhalten zu haben. Habe ich so ein Problem mit schlagenden Frauen, dass ich mich lieber auf die Seite des Mannes begebe, der geschlagen wird, obwohl er mit recht hoher Wahrscheinlichkeit ein Täter ist, gegen den sie sich tapfer wehrt? Kann ich Frauen mit langen blonden Haaren im Proll-Look weniger leiden als Refugee-Männer? Wie hätte ich mich verhalten, wenn sie den Übergriff formuliert hätte? Anders oder genauso?
Warum war T. auf ihrer Seite und ich nicht?
Das beschäftigt mich.
April 2018 – Ego-Salat
Ego-Salat
Ego-Salat
Ego Ego Ego-Salat
An der Ampel
Im Cafe
Ego-Salat wo ich geh und steh
Ego-Salat
Ego-Salat
Ego Ego Ego-Salat
Mach isch mir Dressing
für mein Ego-Salat.
Geh isch Therapie
wegen Ego-Salat.
Ess isch kein Fleisch
lieber Ego-Salat.
Ego-Salat
Ego Ego Ego-Salat
Krieg ich kein Job
ohne Ego-Salat
Geh ich ins Bett
mit Ego-Salat
Wach ich nachts auf:
Ego-Salat
Ego Ego Ego-Salat
Liebe ist möglich,
Ego-Salat.
April 2018 – Bizarro World
Kürzlich lese ich im Vorbeigehen auf einem Plakat was über einen Frauenmarsch. Ich bin überrascht, hab ich gar nix von mitgekriegt, womöglich muss ich da ja hin?
Als ich recherchiere, sind das die Rechten.
Ich stoße auf Leyla Bilge und staune. Sie ist AfD-Mitglied und hat den Frauenmarsch ins Leben gerufen. Sie ist Tochter kurdischer Eltern, 2017 zum Christentum übergetreten, alleinerziehend, hat einen fast erwachsenen Sohn. Sie macht sich für ein Burka-Verbot stark. Vor einiger Zeit hatte sie einen Auftritt im Reichstag, bei dem sie in eine Burka gehüllt ans Rednerpult getreten ist. Dann hat sie sich vor den „Altparteien“ – so der AfD-Jargon – die Burka ausgezogen und drunter war ein Minikleid in Deutschlandfarben. So oder so ähnlich hat sich’s zugetragen, was genau davon behauptet und was tatsächlich passiert ist, lässt sich nicht mehr verifizieren. Versatzstücke davon, z.B. das Deutschland-Minikleid und auch die Burka-Enthüllung finde ich noch auf Fotos/Videos ihrer Auftritte.
Bei der Demo geht es um Frauenrechte. Das heißt bei Bilge/der AfD: Frauen sollen sich wieder sicher fühlen können auf der Straße und wenn sie nachts nach Hause gehen. Geschützt werden müssen sie vor den machistischen islamischen Männern, die Frauen nicht respektieren. „Als wir noch Deo statt Pfefferspray in der Handtasche trugen“ ist einer der Claims, den ich finde. Bei der Demo, so wird später gelästert, waren nur ein Drittel Frauen anwesend.
Bei der Demo ist die Antifa am Start, macht eine Gegendemo. Also mainly male und links demonstriert gegen migrantische, kurdische, alleinerziehende Frau, rechts. Wie schräg das alles ist! Was für Überlagerungen da gerade stattfinden! Weird and wild.
Auf eine Frauendemo gehen, heißt also dank AfD nicht mehr automatisch, für was Sinnvolles einzutreten, es heißt unter Umständen auf ein verkapptes rechtsradikales, islamfeindliches, rassistisches, deutschfrauentümelndes Anti-Flüchtlings-Event zu gehen. Die drehen uns das Wort im Mund um. Frauenrechte, my ass. Diese ganzen Pegisten und AfDler, die so unlogisch wie problemlos Gauland, Lesben und kurdische Migrantinnen in sich vereinen, haben uns die Themen längst unterm Arsch weg gezogen. Weil wir sie nicht klug genug besetzt haben, nicht schnell genug, nicht genau genug, nicht klar genug.
Muss ich jetzt immer für das sein, wogegen die AfD ist?
Muss ich eine liberale Muslima wie Seyran Ates, die von anderen Muslimen mit dem Tod bedroht wird, weil sie die Burka (und die Haltung der Linken und der Grünen zur Burka) problematisiert, weil sie ein Problem mit den Kinderehen, dem gepredigten Konservatismus und Chauvinismus des Islam hat und als Frau eine Moschee eröffnet hat, jetzt für ne Rechtsradikale halten?
Muss ich jemanden wie den Journalist Constantin Schreiber, der in Syrien gelebt, im Libanon und in Somalia gearbeitet hat,der arabisch spricht und die deutsch-arabische Sendung Ankommen in Deutschland produziert hat, als islamophob bezeichnen, weil er sich im Rahmen einer Reportage die Predigten in Moscheen angehört hat und feststellen musste, dass dort gegen Christen und Ungläubigen gepredigt wird und dass Frauen, Homosexuelle und Juden dort gar nicht gut wegkommen?
Gestern war ich auf einer Veranstaltung bei der es um Filmförderung ging. Also was völlig anderes, Lapidares. Sagt einer der Podiumsgäste, man müsse aufpassen, mit der Kritik an der Filmförderung, weil man sich da mit AfD-Positionen gemein mache.
So kann, so wird es nicht funktionieren.
Wenn die AfD morgen ein Gesetz zur Rettung der deutschen Gewässer fordert oder zum Erhalt des bedrohten deutschen Eichhörnchens, muss ich dann sagen: ich bin gegen Gewässerschutz und das Eichhörnchen ist mir egal? Nee, ich muss sagen: Bin ich dafür, aber ob das Gewässer und das Eichhörnchen deutsch sind, das ist mir egal.
Auf die Argumente kommt es an. Liebe Kinder, gute Nacht.
April 2018 – Berlin
heute in der Zeitung:
Berlins Bezirke jetzt schuldenfrei!
Schluss also mit arm, aber sexy. Berlin jetzt reich, aber ideenlos.
März 2018 – nich immer nur negativ
14 Tage Sonne, Wärme, das schönste Apartment der Stadt, mit Blick auf Sonnenauf- und untergänge, Segelboote und Kreuzfahrtschiffe, ein Calatrava-Gebäude, Fisch, Muscheln, Fisch, Gambas, Fisch, jeden Tag, alles vom Mercado direkt in die Pfanne, eine Bibliothek, 24 Stunden offen, so klug und herrlich gebaut, dass ich konzentriert und effektiv jeden Tag ein paar Stunden arbeite, an einem Hörspiel, das ich schon lange schreiben möchte, Tapas, fast keine Rückenschmerzen, ein Observatorium über den Wolken in dem man Weltraumschrott, Exo-Planeten und den Puls der Sonne beobachtet, Kakteen und andere Pflanzen, die man noch nie gesehen hat, keine Kakerlaken, Menu del dia, Schnee auf der Spitze des Teide, Schwimmübungen im Meerwasser-Pool, Kaffee Bombom für einen Euro.
Als wir das Apartment verlassen, um nach Berlin zurück zu fahren, kommen mir die Tränen.
März 2018 – nichts an außer
S-Bahn Friedrichstraße, Rush-Hour zum Feierabend. Es hat um die Null Grad. Mitten zwischen den vielen Leuten auf dem Gleis steht ein Mann, barfuß, nichts an, außer einem Krankenhaushemd, und hält sich mit der linken Hand an seinem Infusionsständer fest. Er sieht aus wie ein Indianer mit Speer, der auf die U-Bahn wartet. Stolz und beiläufig. Der Infusionsbeutel fehlt, ein Zugangskanüle steckt ohne Verbindungsschnur in seiner Armbeuge. Er steht da so selbstverständlich, wie alle anderen, die von der Arbeit von zu Hause kommen, dass ich zuerst nur denke, ach. Dann denke ich, um Gottes Willen. Und dann: Geht ja gar nicht und wo ist der denn ausgebüchst und der holt sich hier noch den Tod! Niemand nimmt weiter Notiz von ihm, keiner spricht ihn an, die Szene ist absurd.
Aber jeder wie er mag, das ist die Devise hier, in dieser Stadt, nicht wahr, und, wer hingeht, hat die Arschkarte gezogen, wird Probleme haben, haben aber alle schon genug. Keinen Bock, sich nach Feierabend auch noch um die ganzen weirdos zu kümmern, die in dieser Stadt aus dem Boden sprießen.
Was mach ich, denke ich, geh ich hin, sprech ich ihn an, was soll ich sagen: Sie sehen krank aus oder Wo sind sie denn abgehauen oder Sie haben ja gar nichts an oder Brauchen Sie Hilfe oder wie gehts oder Toller Look, aber Sie erfrieren wenn sie so weitermachen? Soll ich die Polizei anrufen, das kostet mich eine Stunde mindestens, das Theater, Theater!, vielleicht Straßentheater, ein Filmdreh, ich sehe mich um, ein Test, versteckte Kamera? Derweil füllt sich das Gleis.
Ich schaffe es nicht, hinzugehen, blockiere mich selber, dann kommen zwei S-Bahn-Uniformträger das Gleis hinunter. Ich gehe auf sie zu und sage: Vielleicht sollte sie mal nach dem Mann dort schauen. Die beiden gucken hin und ich sehe sofort: Die haben auch keinen Bock. Aber sie gehen hin, ich wüsste zu gerne was Sie sagen. Die Autoritäten übernehmen, die Institution nimmt ihren Lauf.
März 2018 – Internationaler Frauentag
Die ganze Straße ist voll. Alle sind da, alle Frauen. Sie singen und pfeifen und jubeln und trillern und trommeln. Der Zug geht durch die ganze Stadt, stundenlang, er hört nicht auf, es gibt keine Lücken, die Reihen sind geschlossen. Unglaublich. Die Frauen singen ein altes Lied, ein Gewerkschaftslied. In mir stößt das Seiten an. So viele Menschen, die etwas wollen, etwas Gutes, etwas Besseres. Die eine Stimme haben. Helle Stimmen, nur die hellen Stimmen. Wann hört man das schon.
Ich bin in Spanien. Genauer gesagt: In Santa Cruz de Teneriffe.
Hier wird nicht einfach demonstriert, hier wird gestreikt, am Internationalen Frauentag.
In Deutschland hingegen: Nichts. Oder wenn dann unsichtbar. Den Zeitungen ist der Frauentag kaum ein Artikelchen wert. Aber ich bekomme Mails von Other Stories, Topshop, man gratuliert mir, empfiehlt Kleider, Schuhe, Rossmann heißt diese Woche Rossfrau und McDonalds hat seine M umgedreht und daraus ein W gemacht, also einen Busen.
Ni una menos heißt es in Mexico, in Argentinien. Auch dort ist die Bewegung sehr politisch, gewerkschaftsnah (was dort noch immer links ist), und verblüffend allumfassend: Queer, pay gap, Arbeitsbedingungen, Altersarmut, häusliche Gewalt, sexuelle Gewalt, alles unter einem Dach.
Ich lese: In Spanien sind im letzten Jahr 49 Frauen von ihren Partnern oder Ex-partnern ermordet worden. Ich finde das krass viel. 49 Frauen tot, weil irgendwelche Typen ausgetickt sind? Was für ein body count für ein Jahr. Und von anderen Übergriffen ist hier noch gar nicht die Rede.
Ich recherchiere: In Deutschland sind im letzten Jahr 149 Frauen von ihren Partnern oder Ex-Partnern ermordet worden. – ?! Auch wenn man das in Relation zur höheren Einwohnerzahl setzt (Spanien 46 Mill, BRD 82 Mill), ist das ungefähr dreimal so viel. Kein Thema hier. Oder hab ich was verpasst? Schlimm schlimm, aber nicht politisch. In Deutschland spricht man in solchen Fällen gerne von Beziehungstat. Mord klingt ja auch ein bisschen hart. Wenn Männer ihre Frauen und Kinder umbringen, handelt es sich um ein Familiendrama. Ein Familienvater hat seine Frau und seine Kinder getötet. Was zur Hölle ist eigentlich ein Familienvater? Einer der sich hartnäckig hält, seit Jahrhunderten, einer dem alle gehören, Frau, Kind, einer, der Verantwortung trägt für die, die er geschaffen und in Beziehung zu sich gesetzt hat, die hilflos wären ohne ihn, einer der, wenn er die Nerven verliert, weil die Verantwortung ihm über den Kopf wächst, oder die Frau und das Kind nicht so wollen wie er, oder gar allein zurechtkommen, Frau und Kind umbringen darf, ja, muss! Eine Familienmutter gibt es jedenfalls nicht.
An eben diesem Tag telefoniere ich mit einem neuen potentiellen Auftraggeber. Im Team bisher: Nur Männer. Einer aus dem Team hat angeregt, eine Frau dazu zu holen. Wär doch vielleicht mal ganz gut. Zweimal betont der Chef mir gegenüber, dass er das auch gut findet, wenn eine Frau dazu kommt. (Er ist stolz darauf, dass er so progressiv ist). Denn: Es geht ja auch um eine weibliche Hauptfigur. (Heißt: wenn es mal um was Emotionales geht oder um Klamotten oder so, dann ist es ja vielleicht ganz gut, jemand mit Expertise in diesem Bereich im Team zu haben.) Und, auch das betont der Chef: Die weibliche Hauptfigur haben sie gegen alle Empfehlung des Geldgebers durchgesetzt, der für Jungs-Geschichten, denn um eine solche handelt es sich, eigentlich Jungs-Hauptfiguren haben möchte. Was soll ich sagen? Bei so viel revolutionärem Engagement für eine förderbedürftige Minderheit wie mich, bleibt mir natürlich nur, Danke zu sagen. Danke und wow.
Aber ich bin ja auch selbst schuld. Ich kommuniziere weiblich, stelle mein Licht unter den Scheffel und zeige mich bei Absprachen und in Verhandlungen nicht selbstbewusst genug.
März 2018 – Weg Ziel
Das Ziel ist das Ziel, Leute. Lasst mich in Ruhe mit euerm Weg.
Februar 2018 – Quote
Eine befreundete Regisseurin bekommt zur Berlinale eine Einladung zu einem Kennenlern-Speeddating mit Redakteurinnen des Öffentlich-Rechtlichen Fernsehens. Aufgrund der frisch eingeführten Frauenquote sind dort alle in Aufruhr: Sie kennen ja gar keine Frauen! Woher sollen sie denn jetzt plötzlich die ganzen Frauen nehmen? Die gibts doch gar nicht! Jahrelang haben sie sich nicht für sie interessiert, jetzt sollen sie plötzlich welche beauftragen. Hilfe! Schon organisiert die degeto ein Speed-Dating. Macht sich auf die Suche, macht die Augen auf, guckt rum, fragt rum. Und dann sitzen da plötzlich welche, am Speed-Dating-Kennenlerntisch. Regisseurinnen! Es gibt sie, sie sind echt. Sie haben Ideen, sie kommen von Filmhochschulen und haben hier und da schon mal einen Film gemacht. Der Wahnsinn! Man staunt.
Quotierung ist Quatsch? In die Fresse.
Es gibt Redakteurinnen wie Sand am Meer, aber das hat nichts genutzt. Wer es schafft, in der Männerwelt mitzuspielen, fördert womöglich keine Frauen. Sondern hat das Gefühl: Sollen die doch selber gucken wo sie bleiben, mir hat ja auch keiner was geschenkt. Ich bin endlich da, wo Männer sind, wär ja schräg, wenn da jetzt Frauen wären. Männer hingegen haben ja manchmal das Gefühl, Frau fördern ist was Schönes. Das hat ja auch was Paternalistisches, ist ein Muster, mit dem man leben, sich auch gefallen kann – solange die Frau im Förderstadium ist jedenfalls. Vielleicht wäre auch dort eine Quote angebracht, eine umgekehrte, 50 Prozent Redakteure. Dann kann man die Spiele ja spielen, die Muster haben, aber nach einer Weile wird der ganze Kram mit der strukturellen Genderproblematik obsolet und die Menschen sind einfach nur individuell verschieden, und wer mit wem klar kommt, muss man mal gucken.
Februar 2018 – skipped
skipped growing up,
went directly to growing old.
Februar 2018 – Jobcoaching
Ich lerne Folgendes:
1
Wer jemandem Blumen vor die Tür stellt, und nicht sagt, dass er Blumen vor die Tür gestellt hat, darf sich nicht wundern, wenn man sich nicht bei ihm bedankt.
2
Transaktionsanalyse. In Kommunikationen sind 3 Ebenen am Werk, die immer mit kommunizieren. 1: Das Eltern-Ich. Eine strenge, aber auch fürsorgliche innere Stimme. 2: Das Erwachsenen-Ich. Das eigentlich kommunizieren sollte, direkt, klar und einfach. 3: Das Kind-Ich. Verspielt, kreativ, trotzig, launisch. 1 und 3 schießen 2 immer in die Quere. Wenn man das weiß, kann man die drei besser unterscheiden, und gucken, wen man da gerade reden lässt oder reden lassen sollte.
3
Antwortet jemand nicht auf deine Mail, bedeutet es nicht, dass du eine kleine Kröte bist. Es hat erstmal gar nichts mit dir zu tun, sondern bedeutet nur, dass die andere Person Mails nicht beantwortet.
4
Menschen neigen dazu, einander in der Kommunikation zu imitieren. Schiebst du ein Zettelchen beiläufig in Richtung einer anderen Person, und sagst, da hab ich mal was versucht, kannste ja mal draufschauen, wenns grade reinpasst, dann wird die andere Person das Zettelchen genauso behandeln: Sie wird beiläufig auf dein Zettelchen schauen, ihn als Versuch registrieren, wenns grade passt.
Februar 2018 – Burnout
Kann man eigentlich auch einen Burnout bekommen, wenn man arbeitslos ist?
Februar 2018 – Leer vom Kämpfen
Februar 2018 – Kämpfen 2
Ich kämpfe.
Um Jobs, um Geld, um Anerkennung.
Um einen Platz im Cafe, um ein Ticket für die Berlinale, um einen Tisch im Restaurant, um einen Drink an der Bar, um den Einlass in einen Club.
Ich kämpfe um Liebe, um Sex, um Zärtlichkeit.
Im Cafe sind alle Plätze besetzt. Im Restaurant hätte man reservieren müssen. Für die Berlinale hätte man früher aufstehen müssen. Für einen Drink an der Bar hätte man besser aussehen müssen. Für Liebe hätte man anders sein müssen. Für die Wohnung hätte man einen Job haben müssen.
Du musst laut sein. Du musst sichtbar sein. Du musst besser sein. Du musst schneller sein. Du musst Geld haben. Du musst gut aussehen. Du musst schon mal was gemacht haben. Du musst andere Sachen gemacht haben. Du musst reserviert haben. Du musst früher aufstehen. Du musst jemanden kennen. Du musst anders sein.
Verlassen oder Bleiben
fragt mich WordPress. Das frag ich mich auch.
Februar 2018 – Kämpfen 1
Wenn du was willst, musst du kämpfen. Es gibt nichts umsonst. Wenn du aufhörst zu kämpfen, dann stirbst du. Ganz leise, still und heimlich. Keiner kriegts mit. Du wirst unsichtbar, ganz langsam löst du dich auf. Du fliegst aus deiner Wohnung, auf die Straße, in die Ubahn, in die Kanalisation und dann saugt das Erdinnere dich auf und es ist, als wärst du nie gewesen, denn du hast ja aufgehört, zu kämpfen. Selber schuld.
Januar 2018 – wow
Kürzlich beim Edeka an der Kasse. Vor mir ist ein Junge dran, etwa 11. Er fragt den jungen Mann hinter der Kasse: Wie viel verdient man eigentlich so als Verkäufer? Der zögert einen Moment, ob und wie er sich dazu jetzt äußern soll, dann sagt er:
So ungefähr 1500 im Monat kriegt man raus.
Wow. Denke ich. Wow. Mehr als ich.
Dazu Krankengeld, wenn die Grippe kommt, Urlaubsgeld, wenn der Urlaub kommt, und KrankenRentenPflegeversicherung sind auch bezahlt. Gehen nicht davon ab. Sind einfach mit drin. Wow. Jeden Monat.
Wie arm ich bin.
Piep, piep, 24,83 bitte.
Piep piep.
8 Stunden täglich. 40 Stunden die Woche.
Piep, piep.
Dezember 2017 – M. am Telefon
_Ist furchtbar. Das Wetter, ja, und ist auf dem Boden, alles! So dass die Leute an den Füßen. Also: scheusslich! Wirklich wahr. Es ist gar nicht schön. Morgen? Nein, das weiß sie nicht. Wer? Ja, das kann sein. Da müsste man B. fragen. Aber das ist jetzt schön, dass wir telefonieren.
_Nein, sie ist richtig sauer. Richtig, also es ist manchmal wirklich schlimm. Der B. ist furchtbar. Sie will nach Hause. Also nach oben. Sie hält es nicht mehr aus. Immer wieder. Sie weiß auch nicht, wie das weitergehen soll. Aber da kannste nix machen. Es lässt sich nicht ändern. Sie begreift es nicht.
_Ach, du glaubst es nicht! Ja, da ist unser Babylein. Was macht es jetzt? Ah, es hat ein, ja, da kann es fahren. Wir haben ein Bübchen. Hoppla -ohje. Jetzt kommt die Mama, seine Mama, ach ja. Aber so goldig. Mit goldenen Löckchen. du, der ist so süß, wirklich. Was der schon kann. Und der Vater ist nicht da. Manchmal geht es nicht anders. Aber der hat es mir erklärt. Der ist woanders. Aber das ist so toll, wirklich, das ist so schön, guck mal.
Oktober 2017 – Kamera
Ich lese was über den Eklat auf der Buchmesse rund um Höcke. Ich will was sehen, also gehe ich auf Youtube. Gleich die ersten Treffer zeigen mir ausführlich Videos von der Sache. Alle diese Videos sind von den Rechten. Also nicht, dass da drunter steht: schöne Grüße die Rechten, oder filmed by AfD, oder NSU News. Nee, dazu sind die viel zu clever. Das sind irgendwelche Seiten, die RT Deutsch oder Opposition 24 oder besonders schön: newsleak heißen.
Rechts werden sie durch ihre Positionierung, ihre Perspektive, ihren Blick auf die Sache, rechts werden sie buchstäblich durch ihre Kamera. Immer wieder interessant zu sehen, wie das funktioniert. Sie filmen Höcke vom Podium aus, auf dem er steht. Sie filmen die Claqueure, die Begeisterung. Sie zeigen die Bedrängnis in die er gerät durch die „Linksextremen“ – ein Stichwort, das dann auch im Titel des Videos auftaucht. Sie nehmen eine einzelne Protestlerin in den Blick, als würden sie sagen, guckt euch das Gesockse an, das hier rumrennt, guck durch mein Visier, Shooter, die kannste dir merken, die Alte, dieses Zecken-Face hier, das ist das Target. Da muss gar nichts weiter geredet werden. Da kann sich ja jeder selber ein Bild machen.
Wie gesagt, die ersten 5 Treffer bei Youtube.
Oktober 2017 – Ein Lehrer
Ein Lehrer ist gestorben.
Ich mochte Lehrer nicht, aber ihn, ihn mochte ich.
Sehr.
Er hat was hinterlassen in mir. Er hat mir Erfahrungen und Gedanken und Erkenntnisse geschenkt. Nein, ermöglicht. Er hat mich, zumindest ein bisschen, gesehen. Das ist mir vorher und hinterher nicht passiert. Nicht ein einziges Mal. Bei keinem anderen Lehrer.
Ich lese einen Text von ihm. Ich erkenne ihn wieder. Höre seine Stimme, erlebe noch einmal seinen feinen, melancholischen Humor. Ein zarter Mensch, einsam und verbunden, wütend und verzweifelt, manchmal eingesperrt, in seine Anständigkeit, das wiederum, wegen der Anständigkeit, ertragend.
Nach langer Krankheit. Krebs, denke ich.
Dann erfahre ich: Suizid.
Er hatte schwere Depressionen.
Oktober 2017 – M.
Wir holen M. von der Tagespflege ab, in die sie jetzt nachmittags öfter geht.
Guck mal, wer da ist, sagt B., mein Stiefvater, ihr Mann.
M. sieht mich, freut sich wahnsinnig, und ruft den Betreuerinnen zu: Meine Schwester, schaun Sie, meine Schwester ist gekommen!
März 2018 – Eric
Manchmal frage ich mich, was wäre, wenn ich einen Männernamen hätte. Nehmen wir an, ich hieße Tillmann Saale oder Matthias Lehmann oder Eric Raue. Wäre dann alles einfacher? Bekäme ich Antworten, Chancen, Jobs? Würde man alles, was ich sage und tue von vorneherein ernst nehmen, hätte meine Stimme Gewicht? Würde man mir was zutrauen, auf mich hören? Wäre ich im Gegenzug selbstbewusster, konfrontierender, erfolgreicher? Lauter, dominanter, ehrgeiziger?
Eric Raue ohne h.
Wir könnten Eric anrufen. Lass uns doch Eric noch ins Team holen. Ja, super Idee. Wenn er nicht gerade in anderen Projekten feststeckt. Eric bekäme Gehaltserhöhungen, und die Möglichkeit, aufzusteigen. Okay, Herr Raue, dann wollen wir mal. Einen Stromvertrag abschließen, einen Tisch für vier reservieren, einen Arzttermin ausmachen, einen günstigeren Telefontarif aushandeln. Selbstverständlich. Ein Auto kaufen, eine Wohnung mieten, einen Kredit aushandeln? Wie war der Name? Raue, ohne h.
Vielleicht wäre aber auch alles gleich. Eric wäre beim Therapeuten. Er hätte einen Burn-Out gehabt, bei Männern heißt das ja nicht Depression. Er käme nur schwer klar mit seiner Rolle als moderner, sensibler Mann mit Pflegeprodukten, der irgendwo zwischen ficken wollen und ficken müssen an Beziehungen scheitert, weil die Frauen am Ende ja doch immer nur eins wollen, nämlich einen, der ihnen den Mann macht. Und dann auch wieder nicht. Und Eric ist leider einfach ne Lusche. Einer, der sich schnell verunsichern lässt, der nicht weiß, was er will, der vom Abhauen träumt, seinen Vater hasst, der gerne treu wäre, aber auch sexuell außergewöhnlich aktiv. Der gerne mutiger wäre, es aber nicht ist.
Mann, Eric.
Jetzt hatte ich mich schon gefreut. Aber so, kann ich ja gleich Elli bleiben.
Januar 2018 – Fikkefuchs
Es geht um den Mann und seine Fixierung auf die Frau als fickbares Material. Ein junger Mann sucht seinen Vater auf, der nichts von ihm wusste. Da der Vater mal der Stecher von Kleindeinbach oder sowas war, will der Sohn sich bei ihm Rat holen, er hat nämlich noch nie einen Stich gemacht bei irgendeiner real existierenden Frau, kann aber Tag und Nacht an nichts anderes denken und seinen Freund hassen, der dauernd Frauen flachlegt oder ihm das zumindest dauernd per Videobotschaft reinbehauptet.
Der Vater, ein womöglich mal ganz charmanter, inzwischen aber vor allem abgehalfterter Mitt-50er, hat auch schon lange keine (frische, junge, geile, denn nur um die kann es gehen) Fotzenmöse aus der Nähe gesehen und verbirgt seine Inkompetenz beim Thema gegenüber dem Sohn hinter pseudo-intellektuellen Weisheiten über Kunst und Kultur der Verführung. Vor allem aber: hinter Abwertung., denn das fickbare Material will ja auch einfach nie, was es soll, egal wie sehr man sich ins Zeug legt.
Was bei der Heldenreise der beiden herauskommt, ist die tour de force zweier obsessierender Narzisten, die ein großes Leiden zeigt: das Leiden der Männer an ihrer Sexualität. Bzw. an ihrer Triebhaftigkeit, die sie rund um die Uhr beschäftigt, unter deren Knute sie stehen und sie zu erbärmlichen, ausbeutbaren Würstchen macht (die Coaching Lady, die die beiden aufsuchen, zieht ihnen das Geld aus der Tasche, indem sie ihnen eine Frau zum Üben vor die Nase setzt, auf die die männlichen Kursteilnehmer reagieren wie ein Pavlovscher Hund aufs Futtersignal), die sie wie ferngesteuert und nur mit Hilfe aller möglicher Verarbeitungs-, Verdrängungs- und Abwehrmechanismen wie Größenwahn, Überhöhung, Verachtung, Wettbewerb und Aggression durchs Leben laufen lassen. Zu einer menschlichen Beziehung sind sie nicht fähig, ihr Schwanz verstellt den Blick. Auf die Frau als Person. Aber auch auf sie selbst als Person.
Irgendwo im Zentrum des Films gibt es eine großartige improvisierte Szene im Auto, in der der Sohn schließlich entnervt doch noch mit einer Prostituierten schläft. Hier, bei diesen beiden sich abmühenden Fleischbergen, findet sich alles, was man braucht, um das Leid zu verstehen: Die Mühsal, die Demütigung, die Würdelosigkeit, die Verzweiflung, die der Mann durchmacht, die Sisyphosarbeit, die er leisten muss, immer wieder aufs Neue, weil er gar nicht anders kann. Noch nicht mal hier, in der Situation der bezahlten Sexualität lässt sich zu einem Einklang finden, zu einer Befriedigung, sogar hier driften Bedürfnis und Realität so weit auseinander, dass die Impotenz schon wieder um die Ecke lauert.
Ist es so? fragt man sich am Ende. Ist es wirklich so? Sind Männer so? Und wenn das stimmt, sollten wir es nicht einfach alle ein für alle Mal lassen? Ich jedenfalls fühle mich leer und traurig und naiv und fremd in dieser Welt, in der ich womöglich nur leben kann, weil ich die ganze Zeit die Augen vor den Realitäten verschließe.
Aber es ist ja nur ein Film, nicht wahr?
– Drei Minuten bevor der Film losgeht. Alle sitzen schon (Hackesche Höfe, kleinstes Kino), unterhalten sich dezent murmelnd über ihrem Popcorn, sehen aus, als hätten sie eine interessante Rezension in der Zeit oder SZ über den Film gelesen – da kommt eine Horde von knapp 20 Jungmännern rein, schleppt Bier herein, pöbelt, prollt, und setzt sich lauthals in die ersten beiden Reihen vor die Leinwand. Für ein paar Minuten frage ich mich, ob die gecastet sind, eine witzige Werbemaßnahme für den Film, aber nein, die sind leider echt, so echt, dass man es kaum fassen kann. Jedem im Kino ist in diesem Moment klar, dass die nächsten anderthalb Stunden die Hölle werden. Werden sie auch. Rassistische, sexistische, und keine Ahnung wie das Fachwort heißt, behindertendiskriminerende (der Sohn im Film nuschelt, weil er eine Hasenscharte hat) Dummsprüche am Fließband, die Dynamik der Gruppe ist so klischeehaft, ihre Insiderwitzchen, ihr abgekartetes hochgeschaukeltes Ping-Pong so absehbar, dass man die meiste Zeit darüber staunt, dass es so etwas wirklich wirklich wirklich gibt. Dachten sie, sie gehen in einen Porno? Verstehen sie auch nur ansatzweise, worum es geht? Dass es um Typen wie sie geht? Um ein Verhalten wie ihres? Sehen sie nicht den doppelten Boden? Die Erbärmlichkeit, um die es geht. Wirklich, keiner von ihnen? Wow.
Das Publikum wehrt sich nach Kräften, aber es nützt nichts. Die Gruppe hat alle im Griff. Schlimmer noch, sie hat die Macht.
Mit Abstand eine der bizarrsten Kinoerfahrungen meines Lebens.
Januar 2017 – Kinder und Erziehung
L. und ich reden über Kindererziehung. Sie hat einen kleinen Sohn, also beschäftigt sie das. Und mich beschäftigt sowieso alles.
Sie berichtet, dass man Kinder heute nicht mehr erzieht. Dahin geht der Trend. Man gibt Kindern nichts vor, sie finden ihren Weg alleine. Kürzlich zum Beispiel saß sie mit ihrem Sohn am Tisch und hat mit ihm gemalt. Das war schön, sie beide so parallel. Sie hat irgendwelche Sachen gemalt, er hat so vor sich hin gekrakelt. Sie würde ihm da nie reinpfuschen, sie lässt ihn machen.
Dann kam L.s Mutter zu Besuch und hat sich dazu gesetzt. Guck mal, hat sie zu ihrem Enkelkind gesagt, so hält man den Stift. Das Kind hat den Stift so gehalten, wie die Oma es ihm beigebracht hat, und war danach total begeistert, dass es heute gelernt hat, wie man einen Stift hält.
L. war verunsichert.
Ich erzähle L., dass mir solche Geschichten körperliche Schmerzen bereiten. Wenn ich sowas höre, könnte ich mich krümmen, vor Wut und Hilflosigkeit. Ich will sofort alle Kinder retten. Und zwar vor ihren bescheuerten, ignoranten, indifferenten Eltern, die ihren Kindern das Wichtigste, was man braucht, nämlich WELTZUGÄNGE, nicht mit auf den Weg geben, weil sie es für brutal und die zarte Kinderseele schädigend halten, ihnen was „vorzugeben“.
Eine andere Freundin erzählt mir von ihrer Nichte, sieben Jahre alt, ein Schulkind also, die den Stift immer in der Faust hält, Stiftspitze geradeaus nach unten. Weder Papa noch Mama noch Lehrer noch sonst jemand hat es je gewagt, dem Mädchen den Stift aus der Hand zu nehmen und zu sagen: Nee, so macht man das nicht. Das macht man so, versuch’s mal. Nein, eine solche Form von Aggression hat dieser hochsensiblen, zart suchenden Kinderseele noch niemand antun wollen, keiner wollte das Kind mit dieser Art von verbaler und performativer Gewalt auf ewig all seiner Kreativität berauben und es damit an seiner ganz eigenständigen Eroberung der Welt und des Selbst hindern. Das Kind malt wie ein Affe, Leute! Und das ist nichts Gutes! Auch wenn Affen schützenswerte Tiere sind, deren Hirne wir nicht auslöffeln sollten! Und wenn es eines Tages kapiert, dass es malt, wie ein Affe, dann seid ihr am Ende doch die Bösen und das Kind beklagt sich beim Therapeuten über euch! Wä, wä, meine Eltern haben mir nicht mal beigebracht, wie man den Stift hält. Wollt ihr das? Hm? Kinder haben heißt, ab und zu richtig scheiße sein und sich öfter mal so richtig scheiße finden zu lassen. Wer dafür nicht das Rückgrat hat, kann gleich zuhause bleiben. Und: Jedes einigermaßen wache, intelligente Kind will doch nichts anderes als raus aus der Ohnmacht, und verstehen, wie die Welt funktioniert und hofft dringend auf jemanden, der ihm zeigt, wie man alles machen muss, was man hier so machen muss. Und dabei will es ganz sicher nicht aussehen wie ein Vollhonk! Und von wegen Hierarchie: Wer ist in diesem Szenario der Mächtige, wer der Untergebene? Wer macht hier was er will?
Wiederum eine andere Freundin. Ich bin bei ihr im Büro auf ein Glas Champagner eingeladen, wir haben was zu feiern, es hat Wochen gedauert, den Termin zu finden, ihr Kalender ist mit Arbeit und zwei Kindern logischerweise einfach super voll. Nach 20 Minuten steht sie auf und sagt, sie muss gehen. Ihre Tochter braucht zurzeit 45 Minuten bis sie sie aus der Kita rausgelöst hat. Excuse me? Ich steh da, mit meinem angenippten Champagner und denke, ey, also das würde ich mir nicht gefallen lassen. Diese miesen kleinen Biester. Sie malen mit der Faust und versklaven ihre Eltern. Und deren Freunde! Also wer ist hier brutal?
L. erzählt weiter. Eine Bekannte von ihr, ebenfalls Mutter eines kleinen Jungen, kam zu Besuch. Sie war unruhig, weil das Kind im Rahmen einer Bewerbung für einen Kindergarten, in den sie es schicken möchte, einen Aufnahmetest machen muss. Dafür muss er unter anderem in der Lage sein, einen Kopffüßler malen. Ob L.s Kind sowas schon mache, hat die Bekannte im Flüsterton gefragt. L. hat, nun ebenfalls beunruhigt, den Kopf geschüttelt. Die Bekannte erzählt, verschämt lachend, denn sie weiß, dass sowas eigentlich GAR NICHT geht, dass sie ihn in letzter Zeit immer mal beim Malen fragt, ob er denn auch einen Mensch malen könne. Das tut er dann auch bereitwillig. Sehr schön!, jubelt sie ihm dann zu. Und hat das Männchen denn auch Arme? Und Beine? Und Hände? Und Ohren? Irgendwann reicht‘s ihm dann und er hört auf zu malen.
Seine Männchen, gesteht sie, haben eckige Köpfe. Sie denkt, das liegt daran, dass er immer Lego-Männchen-Filme guckt. Was für ein kluges Kind, denke ich. Wahrscheinlich hat sie nicht Mensch gesagt, sondern Männchen, kannst du auch ein Männchen malen? Weil sie denkt, ein Kopffüßler ist ein Männchen, dabei ist es doch ein Mensch, gemalt von einem Dreijährigen. Missverständnisse zwischen Kindern und Erwachsenen. Lego-Menschchen. Lego-Männschen. Quadratschädel in Gelb.
Ja, so ist das. Ganz frei und ohne Druck sollen sie sein, die Kinder, ganz individuell sollen sie sich entfalten. Gleichzeitig sollen sie Aufnahmeprüfungen in der Kita bestehen, in der man mit drei schon Chinesisch lernt. Im Prinzip ist das Leben der Kinder immer ein Abbild des Lebens der Erwachsenen.
Deshalb sind die Kinder in Neukölln auch so anders.
Dezember 2017 – alt
In der Sauna sehe ich einen nackten alten Mann.
Ich würde mit ihm schlafen. Und er mit mir, das weiß ich.
Wäre ich so alt wie er, würde ich immer noch mit ihm schlafen.
Aber er nicht mehr mit mir.
Dezember 2017 – erst oder schon
Sechs Wochen ist es her.
C. sagt, was ihn verrückt macht, ist, dass es nicht weitergeht. Dass die Entwicklung gestoppt ist. Dass du für immer dieser irgendwie noch nicht ganz erwachsene junge Mann sein wirst. In Studentenkleidung. Eingefroren, die Bilder. Zum Stillstand gebracht.
Was mich verrückt macht, ist, dass die Welt nie stehen bleibt. Die arrogante, brutale, die nichts kümmert. Die einfach weiter rauscht, die nichts interessiert, der alles egal ist, Hauptsache der Laden läuft, ein, aus, Tag, Nacht, für die es keinen Unterschied macht. Das große universelle Achselzucken, das ich so gute kenne, aus meinen Träumen.
Manchmal habe ich Angst, du könntest mich angesteckt haben. Dann wieder denke ich, so klar wie nie: Das will ich nicht.
Dezember 2017 – Stare
Vor ein paar Monaten warte ich am Alex auf die Tram. Vor mir auf dem Asphalt läuft ein kleiner Vogel auf und ab. Er ist sehr hübsch. Schlank, glänzendes, braunes Gefieder, übersät mit vielen kleinen goldfarbenen Punkten. Er erregt nicht nur meine Aufmerksamkeit, auch andere gucken: Was ist das denn für einer? Spatzen, Tauben, Krähen, klar, die üblichen Alexanderplatz-Verdächtigen, vielleicht mal ne Möwe drüben vom Kanal her, auf der Suche nach einem Fischburger, aber der hier, nee. Der ist neu. Er fiepst und trillert vor sich hin, immer so chaka-chaka mit dem Kopf, läuft vor den Wartenden auf und ab, ein bisschen aufgeregt, wie die meisten kleinen Vögel, und guckt irgendwie sehr auffordernd.
Ein älterer Herr sagt: Das ist ein Star. (Ältere Menschen wissen sowas.) Na, endlich.
Ein Star also.
Zwei Wochen später. Stare jetzt nicht nur an der Tram-Haltestelle, sondern auch dahinter locker über den Platz vor dem Fernsehturm verteilt, der erste Tourist knipst. Ihr heller Fiepsi-Sound mischt sich gleichberechtigt unter den üblichen Vogelsound, nur die Krähen sind noch immer pointierter und lauter.
Zwei Monate später. Stare latschen an der Tram-Haltestelle auf und ab wie auf einem Cat-Walk. Auf einem echten hätten sie keine Chance, sie sind alle doppelt so dick wie beim letzten Mal. Stare allein, Stare in Gruppen. Stare laufen, picken, rennen. Leute reden, spekulieren. Mir fällt ein. In der Serie Ozark erzählt der kleine Junge zum Entsetzen seiner liberalen Eltern, dass er schießen lernen möchte. Als sie ihn fragen, warum, erklärt er, er wolle Stare töten. Er hat sich mit diesen Tieren beschäftigt, Bücher über sie gelesen, Dokus angesehen. Stare sind für die Landwirtschaft ein Graus, erzählt er. Sie vermehren sich rasend schnell, und fallen in riesigen Schwärmen über Felder und Weiden her und Mensch und Tier können sich kaum gegen sie wehren.
Vier Monate seit der ersten Star-Sichtung. Diesmal S-Bahnhaltestelle Alexanderplatz. Ich fahre die Rolltreppe hoch aufs Gleis und denke, was ist das denn? Ein Lärm an der hohen Decke der Halle, ein schwärender Sound wie in einer Voliere. Die ganze Kuppel des Bahnhofs ist voller Stare!
Google. Ich gebe Star ein. Füge Vogel hinzu. Erster Treffer: NABU. „Der Star ist Vogel des Jahres 2018 und vom Aussterben bedroht.“
Leute, die übernehmen hier gerade die Weltherrschaft!
Dezember 2017 – Au Supermarché
Im französischen Supermarkt im Untergeschoss bei Galerie Lafayette.
Ich stehe versonnen vor den Kühlschränken und schaue mir leckere Sachen an. Wie immer hier muss ich an Houellebecq denken und sein letztes Buch (Unterwerfung), in dem seine Hauptfigur Blinis mit Tarama isst. Das gibt’s hier nämlich.
Ein Mitarbeiter mit Schürze spricht mich von der Seite an: Entschuldigung, sprechen Sie französisch? Neben ihm steht ein Junge, etwa acht. Offenbar hat ihn auf Französisch nach etwas gefragt. Nein, nicht wirklich, sage ich. Der Junge steht reaktionslos, wartet ab, was die zwei Erwachsenen jetzt unternehmen. Ich krame in meinem Hirn, irgendwo muss noch ein bisschen Französisch drin sein. Quest-ce que tu cherche? frage ich ihn. Eine grüne Flasche, sagt er. Akzentfrei. Na, das klappt doch prima hier mit uns auf Deutsch, sage ich, und lache. Der Mitarbeiter und ich gucken uns leise irritiert an, warum hat er nicht gleich Deutsch gesprochen? Das Gesicht des Jungen bleibt weiter seltsam reaktionslos. Wo sind denn bloß die Eltern? In ihrer verglasten Penthouse-Wohnung, schätze ich, der Junge sieht nach Geld aus, angezogen wie ein kleiner Erwachsener, man hat ihn mal rasch ins Galerie Lafayette geschickt als wärs der Späti um die Ecke, aber welche Eltern in dieser Preisklasse, im Allgemeinen eher als Helikopter-Eltern bekannt, schicken ihren Achtjährigen alleine zum Einkaufen? Eine grüne Flasche, sage ich. Und was ist da drin, Limonade, oder Wasser? Ich und der Schürzenmitarbeiter gucken auf den Jungen hinunter, der überlegt. So richtig schnell im Kopf kommt er mir nicht vor.
Ich deute auf eine kleine Flasche Perrier in der unteren Etage des Kühlschranks links von uns. Guck mal, meinst du so eine Flasche?, frage ich. Mit Wasser, das piekt, sagt er, ohne meinem Zeigefinger gefolgt zu sein, und als habe er lange und konzentriert darüber gebrütet. Wasser, das piekt, sage ich, sehr gut, wir kommen der Sache näher. Ich deute erneut auf die kleinen Flaschen. Sieht die grüne Flasche ungefähr so aus? Diesmal schaut er hin. Ja, sagt er, und nickt. Aber in groß. Ich und die Schürze sind erleichtert. Die Schürze geht, mit einem klaren Suchauftrag. Ich und der Junge bleiben vor dem Kühlschrank stehen. Ich mag ihn noch nicht alleine lassen. Ich habe eine Waffe dabei, sagt er zu mir. Ah, ja? sage ich. Er nickt. Ein Schießgewehr. Soll ich es dir zeigen? Nein, jetzt gerade nicht, sage ich. Es ist sehr groß, sagt er, und schaut mich an.
Du lieber Himmel.
Jungs, denke ich. Und ihr ewiges Missverständnis über Waffen und Frauen. Franzosen, denke ich. Und sehe es plötzlich: Der Junge sieht aus wie eine Miniaturausgabe von Houellebecq. Vor mir steht Young Michel!
Die Schürze ist noch immer nicht zurück. Du könntest einfach zwei davon nehmen, schlage ich vor, das ist ungefähr wie eine große. Jetzt kommt Bewegung in die Sache. Er nickt, tritt vor, nimmt zwei kleine Flaschen aus dem Kühlschrank, die Schürze kehrt bedauernd zurück: Nein, große gibt es nicht, der Junge geht Richtung Kasse, und ist verschwunden.
Ich sehe ihm nach und bin ein bisschen traurig, weil er mich schon vergessen hat. Ich wünsche ihm alles erdenklich Gute. Möge das Leben gnädig mit dir sein, mein Junge.
Ich kaufe noch einen winzig kleinen, sehr leckeren, französischen Importkuchen, dann lasse ich Wärme und Licht des Kaufhauses hinter mir und kehre zurück in die kalte Luft der dunkel gewordenen Stadt.
Juni 2016 – Junge in der Ubahn
Dezember 2017 – Autonom gefahren
Wir sitzen in einem Zug. Falls wir an einer BEDARFSHALTESTELLE aussteigen wollen, müssen wir uns beim TRIEBFAHRZEUGFÜHRER melden. Wer will sich schon bei so jemand melden.
Wir steigen in Bad Birnbach aus. Der Bahnhof sieht, wie alle anderen Bahnhöfe, an denen wir seit Passau vorbeigefahren sind, aus, als wäre er ziemlich günstig zu erwerben. Auf der einen Seite hat man Schienen, auf der anderen eine Schnellstraße. Und wo ist jetzt Bad Birnbach? Hier ist jedenfalls nichts. Theoretisch gibt es einen Bus nach Bad Birnbach rein. Theoretisch könnten wir auch 2,5 Kilometer mit unseren Koffern die Schnellstraße entlang laufen, bis wir bei der Kirche im Dorf sind. Das Hotel seufzt am Telefon und schickt den Naivlingen aus der Großstadt ein Taxi. (Familienbetrieb. Die fahren hier alle und alles in dritter Generation).
Wir machen uns auf die Suche nach dem autonom fahrenden Bus und folgen der Spur aus Warn-Gelb, die krasse 800 Meter lang ist und von „Achtung! Autonom fahrendes Fahrzeug“-Schildern gesäumt wird. Überhaupt ist man sehr sehr vorsichtig mit diesem unberechenbaren, gefährlichen, neuen Ding. Man wirbt um Akzeptanz, und 15 Stundenkilometer sind das höchste der Gefühle für den kleinen Bus, eine echt süße, quadratische Kiste. (Der würde bestimmt gerne schneller fahren).
Da vorne ist er! Wir haben ihn, 15 km/h, eingeholt.
Wir steigen ein, da geht er kaputt.
Die Begleitperson – die ihr „audonomes Bussle“ jetzt schon liebt, jetzt schon so viel emotionale Affinität zur Maschine aufgebaut hat wie zu einem Haustier, so viel Pflege, Sorge, Ärger braucht und macht es – ist unglücklich. Sie versucht es mit: Did you turn it off and on again, tippst auf dem Bildschirm rum, aber es ist nichts zu machen, das Bussle ist durcheinander, Fachausdruck: Abgestürzt.
Am nächsten Tag versuchen wir es nochmal. „Wegen Systemprogrammierung heute keine Fahrten“, steht an der Haltestelle. Ich weine fast. So kurz vor autonom gefahren! Damn.
Aber die Rottal-Therme und der Igel auf dem Rasen waren auch okay.
November 2017 – Sarg
Heute liegst du im Sarg. In einem Raum, den man extra dafür anmieten kann. Es kommen Menschen und die Situation ist absurd. Denn du liegst da drin, in diesem Sarg. Da vorne drin, in dieser Kiste. Deckel drauf. Wir wissen was drin ist, und wir wissen es auch nicht. Andere haben gesehen, wie du jetzt aussiehst. Andere haben sich beschäftigt mit dir und deinem Körper, der gezeichnet ist von deiner Tat. Du siehst nicht mehr aus wie du. Aber trotzdem bist du es, der da drin liegt, hier so vor uns, in dieser für dich doch viel zu schmalen Kiste. Es muss eng sein da drin. Wir stellen uns vor deinen Sarg, der jetzt irgendwie dir gehört, der du bist, und sagen etwas zu dir, innerlich, äußerlich, wir legen Sachen auf dich drauf, geben dir etwas mit, und wir weinen. Wir sehen die anderen weinen, und weinen, weil sie weinen. Weil wir nicht verstehen, warum du unbedingt von uns weg wolltest. Warum es nicht gereicht hat, nicht genug war. Es kommt Musik und es wird viel geschwiegen und nicht immer weiß man genau, was jetzt zu tun ist und man schaut die Menschen an, die man nicht kennt, und deine Familie sind, und ist beklommen, aber vielleicht wissen sie auch nicht so ganz genau, was man tun muss. Ich hab dir keine Blumen mitgebracht. Ich glaube eigentlich nicht, dass du Blumen mochtest. Oder zumindest waren sie dir egal.
Ich hab deinen Sarg berührt, irgendwo dort, wo ich deinen Kopf vermutet habe. Ich wollte eine Verbindung aufnehmen, zu dir. Ein bisschen Wärme schicken oder spüren, Energie, durch die Wand durch, hinter der du bist. Lebewohl sagen, so absurd das ist, mich entschuldigen, so sinnlos es ist. Dich trösten. Es muss so schlimm und so kalt gewesen sein. Ich vergesse dein Gesicht, und auf Fotos bist du oft wie ein Geist, nicht zu greifen, nicht frontal, abgewandt, verdeckt, verwaschen. Dann wieder sehe ich dich oft, von hinten, auf der Straße, aber das bist nicht du, nur eine Statur, die dir ähnlich ist.
Ich bin den ganzen Tag zutiefst erschöpft.
November 2017 – Black Box
Es wird eine Weile her sein. Wir werden tanzen, und uns anschauen, und wir werden wissen, dass wir an ihn denken, und wir werden weinen, und über was anderes reden, und lachen, und wieder auf ihn zurückkommen, immer wieder auf ihn zurück kommen,
wie in Ebbe
und in Flut,
und uns fragen, gegenseitig, wie geht es dir. Damit.
Aber noch sind die Tränen heiß. Die Traurigkeit, der Ärger, die Wut, die Schuld, die als Erste da war. Das Entsetzen über die Tat, das Tun. Die Aggression darin, die sich gegen uns, das Leben, die Welt richtet. Die Brutalität, die Gewalt, die darin liegt, und zu der er in der Lage war, die in ihm verborgen war, wie sie in uns allen verborgen ist, mal mehr mal weniger, irgendwo da drin. In unserer Black Box. Mit der wir einander fremd sind und bleiben, wie sehr wir uns auch zugetan sind, uns womöglich kümmern oder gar lieben. Das Hinwerfen. Alles, das Handtuch. Sich hinwerfen. Sich entgegen werfen, wegwerfen, unterwerfen, überwerfen. Und uns verwerfen. Begraben
wird er bald sein.
Wir werden gesprochen haben. Gefragt, erzählt, geschildert, wir werden uns wiederholt haben, in Schleifen umkreist und eingekreist haben, was es noch zu sagen gibt, um die Erzählungen zwischen uns zu schieben, zwischen uns und uns, zwischen uns und ihn, Wahrheitswolken aus Watte. Ich hab mal jemanden gekannt, werden wir eines Tages sagen, der
In meinem Kopf führe ich Gespräche mit ihm. Ich sehe, wie es dir geht, ich verstehe wie es dir geht, ich kenne, wie es dir geht. Ich kann mir vorstellen, was dich umtreibt.
Ich bringe dich jetzt.
In die Klinik, zum Krisendienst, zum Arzt. Denn zu dem geht man, wenn es einem so geht wie dir. Der Arzt wird dort sein und mit dir sprechen und dir Medikamente geben. Du wirst schlafen, lange, so lange und so gut wie du lange nicht geschlafen hast, du wirst ohne Angst sein, und ohne Dunkelheit, und wenn du aufwachst, sieht die Welt anders aus. Dann wird es dauern. Es wird nicht lustig sein. Es wird keinen Spaß machen, es kommt Arbeit, es kommen Rückfälle. Aber in ein paar Monaten, ist das Licht am Himmel schön, der Kaffee schmeckt, und es kommt ein anderes Lied im Radio. Und du wirst denken, gut, dass ich das noch erlebe.
Meine Rettungsfantasien.
Als hätte ich die Augen auf gehabt und doch nichts gesehen. Als wäre der Weg vom Fühlen zum Handeln zu weit gewesen. Als hätten meine Synapsen nicht funktioniert. Hürden, die ich gebaut habe, Hürden, die er gebaut hat. Auf die es gegolten hätte, keine Rücksicht zu nehmen. Ich war nicht überrascht. Nicht eine Sekunde, hat mein Gehirn gezögert die Information anzuerkennen. Also warum! Haben die Synapsen nicht funktioniert.
Das geht nicht, hätte ich gesagt. Das ist keine Option. Hörst du? Es gibt Dinge, die du liebst, das weiß ich. Lass dich nicht faszinieren, verführen, lass dich nicht rüber ziehen, auf die dunkle Seite der Macht. Hör auf, damit zu flirten, dich zu gewöhnen, an den tödlichen Gedanken, ihn durchzuspielen und erträglich zu machen, ihn zu etablieren. Hör auf, ein Dann zu fantasieren. Kein Dann. Ein Nichts. Kein Trost, keine Erleichterung. Nichts.
Heute bist du zwei Tage tot.
Finalität.
Der Schmerz setzt ein. Die Trauer kommt.
Oktober 2017 – Elstern
Kürzlich lese ich, dass auf einem Bauernhof Kühe von Elstern verletzt wurden. Die Elstern haben die Kühe an besonders empfindlichen Stellen gepickt, After und Euter, immer wieder und wieder. Eine Kuh war so schwer verletzt, dass sie getötet werden musste. Elstern gelten als intelligent. Jetzt noch mehr.
Oktober 2017 – Provinz
Was ich an der Provinz mag, ist, dass ich mir plötzlich so attraktiv vorkomme.
Oktober 2017 – chill the fuck out
Ein warmer Spätsommertag. Ein Typ auf der Brücke am Maybachufer. Hat ein Keyboard mitgebracht, und sich. Er ist entweder auf Droge oder schlecht eingestellt oder schlicht in der manischen Phase. Er singt, haut in die Tasten, die Drummachine klingt als wär 1986. In Nullkommanix hat er ein begeistertes Publikum. Jeder Song wild und selfmade. Also Hut ab, bzw. was rein in den Hut. Dann kommt sein und ab sofort auch mein Lieblingssong. Wie ein Berserker schüttelt er seinen langen Halbpony von links nach rechts, drückt seinen schlaksigen Körper in ekstatische Höhen und brüllt mit sich überschlagender Stimme:
Chill the fuck out!
Chill the fuck out!
Chill!! the Fuck!! out!!!!
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Oktober 2017 – Ausgeschlossen
In meinem Kopf bin ich längst draußen. Ich gehöre nicht mehr dazu.
Es rast davon der Weltenzug.
Ich bin ausgeliefert seiner Fliehkraft. Die mich nach hinten drängt.
Ich bin am Bahnhof zurück geblieben. Alle anderen sind miteinander. Schwatzen und baden wie eine Horde Spatzen. Ich stehe daneben und wundere mich. Wie können sie wissen, wie das geht. Ein Spatz sein.
Oktober 2017 – Aus dem Café heraus
Folgende Szene. Der Mann. Hat das Auto. Da verstaut er Sachen, im Kofferraum. Die die Frau gepackt hat. Taschen, voll mit Windeln und Ersatzklamotten und Fruchtmus und Feuchttüchern. Die Frau. Hat das Kind. Das klebt an ihr dran. Die kommt jetzt dazu. Der Mann klappt und faltet: Der Kinderwagen, er hievt und bugsiert, er holt wieder raus und stopft woanders rein, er baut an seinem Kofferraum, seiner Tetris-Skulptur, seiner Taschen-Kinderwagen-Kofferraum-Architektur. Die Frau währenddessen. Pult das Kind aus irgendwas raus und hebt es und schiebt es hinein, ins Auto, und zieht ihm irgendwas ab und stopft ihm noch irgendwas um, und beugt sich rüber und drüber und ruckelt es nochmal zurecht. Dann schnallt sie es an. Und erst am Ende sich. Neben dem Kind. Auf dem Rücksitz. Der Mann klappt den Deckel vom Kofferraum zu, und sie fragt noch, ob er irgendwas hat oder macht oder gemacht hat, und er sagt, natürlich hat er das, und dann steigt er ein, auf den Sitz hinterm Steuer, und fährt los.
Wirklich, so will man leben?
September 2017 – Die Wahl
Einen Moment lang fühle ich mich erhaben. Ich komme aus der Grundschule, in die man mich disponiert hat und habe an etwas teilgenommen. An einem größeren Ganzen. Ich wurde wahrgenommen. Man hat mich gefragt. Ich hab den Termin eingebaut, in meinen Tag, drumrumgewickelt die anderen Sachen. Jetzt weiß ich, meine Stimme wird gezählt.
Ich verfolge den ganzen Abend die Ergebnisse. Alle haben sich über den langweiligen Wahlkampf beklagt. Jetzt ist nichts mehr langweilig. SPD abgestiegen, CDU abgestiegen, Seehofer raus aus der CSU?, Frauke Petry raus aus der AfD (Drama Queen, neue Partei?!) Mit Jamaika hab ich gerechnet. Mit der Ansage der SPD nicht mehr regieren zu wollen, nicht. Bisschen Respekt. Ich dachte, die schleimen sich ein und Merkel will eh lieber mit den anderen. AfD – Jetzt ist es Realität. Sichtbare, verhandelbare, mehrheitenfähige Tatsache. Der Osten, die Männer, Enttäuschungswähler – alle vier Jahre bin ich verliebt in Jörg Schönenborn, niemand präsentiert Statistiken so herrlich öffentlich rechtlich wie er. Und immer mit der neusten No-Touch-Screen-Technik. Wie haben eigentlich die Deutschtürken gewählt? Finde ich nicht raus, auch die nächsten Tage nicht. Wär doch interessant (aber das Profiling ist vielleicht problematisch).
Ich treffe mich mit H., wir beide begierig darauf, die Sache zu diskutieren, AfD-Ursachenforschung zu betreiben. H., in der DDR aufgewachsen, den Mauerfall als Teenager erlebt, ist mein persönlicher Ost-Experte: Also sag doch mal. Warum? (der Arme). Der große Bruch in den Biografien? – Wir haben die nächste Generation. Die so gar nicht blühenden Landschaften? – Stimmt doch so nicht mehr. (Den Leuten in Neukölln geht’s schlechter). Flüchtlinge in kaum integrierbarer Zahl? – Keine Flüchtlinge in den AfD-Ländern weit und breit. Männer, die sich abgehängt fühlen, an verlotterten Orten rumsitzen und deshalb saufen? (Geht den Leuten in Neukölln genauso). Die Kolonisierung durch den Westen und die daraus resultierende Kränkung? Nachvollziehbar. Seh ich als Problem. Andererseits. Sie wollten ihn doch unbedingt, ihren Bananen-Kapitalismus. Haben sie doch vorher alle im Fernsehen gesehen, was das bedeutet. Haben sie in der Schule nicht aufgepasst, haben sie ihrer antifaschistischen DDR nicht zugehört, wie es hier zugeht, haben sie nichts kapiert? Wieso überholen ausgerechnet die rechts? Ich bin wütend. Seit Jahrzehnten Solidaritätsbeitrag und das ist der Dank?
Was war eigentlich mit Ausländern in der DDR? Hatten die keine? Da gab es doch auch human traffic, Austausch mit den sozialistischen Bruderstaaten, Kuba, Vietnam. Ich erzähle H. dass ich vor zwei Jahren an der Kasse bei Galeria Kaufhof stand, und der Kassierer auf die Frage der Kundin vor mir, wo man hier irgendwo Blumen kaufen kann, sagte: Unten am Alex ist ein Fidschi. Ein Fidschi. Mir ist der Mund offenstehen geblieben. Er fand nichts dabei. Er hat es nicht böse gemeint. Es war für ihn kein Schimpfwort, es war das normale Wort für Vietnamese in der DDR. So wie für meinen Vater das Wort Neger nie ein Schimpfwort war, wieso denn auch, er fand die doch immer alle ganz sympathisch und toll und war voll auf ihrer Seite.
H. erzählt eine interessante Geschichte. Direkt neben ihnen, im Haus nebenan, haben Vietnamesen gewohnt. Sie kamen, um in der DDR eine dreijährige Ausbildung zu machen. Danach gingen sie zurück. Sie bekamen alle – ein großes Thema für H.s ältere Brüder – eine Simson Maschine gestellt. Sowas war normalerweise gar nicht zu bekommen. Gehörte anscheinend zum sozialistischen-Bruder-Paket. H. war noch klein, aber seine Brüder waren neidisch.
Zwischen ihnen, also H., seinen älteren Brüdern und den Vietnamessen gab es keinen Kontakt. Nie. Obwohl sie direkt nebendran waren. Müssen die nicht Deutsch gesprochen haben, wenn sie in der DDR eine Ausbildung gemacht haben? H. weiß es nicht. Aber die Vietnamesen wollten den Kontakt vielleicht auch nicht so, sie wollten unter sich bleiben, in dieser temporären Internatssituation, in die man sie gebracht hatte. Ausbildung machen und ab nach Hause. Aber wer weiß das schon, hat ja keiner mit ihnen geredet.
Am Ende ihres Aufenthalts bauten sie riesige Kisten aus Holz. Sie hämmerten und sägten und palaverten vor der Haustür herum, ein ziemliches Spektakel jedes Mal. In die Kiste kam die Simson. Damit sie sie mitnehmen konnten, nach Hause, auf dem großen Schiff.
Ein Filmbild, das.
September 2017 – Vor der Wahl
Samstag, später Nachmittag, einen Tag vor der Wahl.
Eine Gruppe Nazis zieht durch die Wandelhalle am Bahnhof Alexanderplatz. Laut, selbstbewusst, Raum nehmend.
Die denken, ab morgen gehört ihnen die Welt. Ab morgen regieren endlich wieder sie.
Stimmt wahrscheinlich auch.
September 2017 – O.fest versus B.hain
Schon klar. Das Oktoberfest ist CSU, Heteronormativität, Dummheit (Alkohol, B-Promis), Filz (Politiker, Fußball-Bosse, A-Promis), Sexismus (Busen-Fräulein, sexuelle Übergriffe, Vergewaltigung), Traditionalismus und Konservatismus kurz vor der AfD. Da gehen nur Deppen hin, gerne in Horden, proben den Einmaljährlich-Exzess, spielen Ausbruch aus dem konservativen Normcore-Alltag, nur um hinterher umso angepasster dahin zurückkehren zu können. So und ähnlich weiß es der Berliner, der noch nie da war.
Hier jetzt aber mal die ketzerische Frage: Ist das Berghain so viel anders? Dresscode, Drogen, Sex? Temporärer Exzess zur Stabilisierung des Systems? Gehn wirs doch mal durch.
Dirndl versus Schwarz in Schwarz. Show your boobs und Wadeln versus show your ass and naked chest. Alkohol in Kruglitergröße versus peaciges MDMA in diskreter Mikroform. Hetero-Norm versus Homo-Vielfalt. Ich recherchiere. Gays auf dem Oktoberfest, das geht doch bestimmt gar nicht, oder? Eine kurze Recherche ergibt: voll gay friendly, das Oktoberfest, die haben sogar ein rosa Zelt, out in the open. Verstecken sich nicht im Darkroom – ha!
Sex. Sex. Sex. Überall auf allen Seiten. Glaub ich persönlich eh schon lange nicht mehr dran, an die behaupteten Exzesse. Auf dem Oktoberfest? Ganz ehrlich, wo und wie soll das gehen? Hinterm Zelt ist vorm Zelt, alle sind besoffen und schnallen eh nicht mehr was wohin gesteckt werden muss. Im Bhain alle eher erfüllt von Zärtlichkeit, Bärchenmänner im Lokomotiv-Modus, najagut, aber der Darkroom, der Darkroom, da gehts ja richtig hart und koksig zur Sache, das ist klar! Und die Toilette erst, der Wahnsinn, na klar was da abgeht! War schon mal jemand auf Toilette im B.hain? Wer da Sex macht ist echt selber schuld.
So und hier noch zwei handfeste Pros für die Bayern-Variante: Das Oktoberfest hat keinen Türsteher und kostet keinen Eintritt. Gut, bei den Preisen trennt sich dann die Spreu vom Weizen, aber immerhin, wer rein will, geht rein. Und 11 Euro für eine Maß oder 5 Euro für ein Butterbrot geht zur Feier des Hartz-IV-Tages auch mal. Im Berghain ein Butterbrot wär auch mal nicht schlecht.
Musik. Schunkel-Schlager-Disco versus Techno-House. Sparen wir uns jetzt die Rede von der Stampfmusik und gehen wir am Sonntag…
ins Berghain!
smiley.
September 2017 – Frau und Manni
Ich lese was über Geldanlage für Frauen. Die interessieren sich nämlich nicht dafür, und überlassen das (ihren) Männern. Das geht dann bei Scheidung und Alter nach hinten los und ist ein Jammer, weil Frauen inzwischen aj auch Geld haben. Frauen, die sich in diesem Geldanlage-Bereich auskennen, wollen das ändern. Sie sagen, Frauen haben andere Bedürfnisse beim Geldanlegen als Männer. Nach Sicherheit zum Beispiel, unkomplizierter Bedienbarkeit, und individueller Beratung. Und wenn sie schon investieren, dann wollen Frauen in was Gutes investieren, und nicht in Korruption, Atomkraft oder Textilausbeutung.
Kann ich erstmal alles Hundertprozent nachvollziehen. Wenn ich sowas mache, dann will ich nicht am Ende weniger Geld als vorher haben, ich will mich nur einmal und nicht andauernd damit beschäftigen müssen, und außerdem coole Energie, gute Digitalisierung und irgendwelchen Sozialkram unterstützen.
(Als ich T. von der ganzen Sache erzähle, schreit er gleich los: Aber genau das will ich auch!)
Auf einer dieser Beratungsseiten von Frauen für Frauen finde ich eine Typisierung nach Lebensphasen:
Die wilden Zwanziger – 20plus, In anderen Umständen – 30plus, Midlife ohne Krise – 40plus, Späte Familie – 50plus, Mit 66 Jahren… – 60plus.
(Sind Männerleben in andere Phasen einteilbar oder sind das mehr oder weniger die gleichen? Wie wären da die Texte? Die Farben? Auf den Bildern kämen wahrscheinlich auch Telefone vor, aber mehr Surfboards, Freundinnen, Kumpels, Autos, Häuser, in denen Frau und Kinder wohnen. Ich krieg gleich Lust, die Seite zu gestalten und im Klischee zu baden.)
Ich hab hier Spaß, auf dieser Seite, man beschäftigt sich mit mir, bzw. dem, was man annimmt, was ich sei, auf die Tamponfarben bin ich sowieso konditioniert und die Texte klingen original wie Horoskope. In meinem steht: „Jetzt ist die ideale Zeit, ihr Leben zu optimieren – auch finanziell. Nutzen Sie dafür selbst unerfreuliche Ereignisse. Veränderungen sind manchmal schmerzhaft. Bleiben Sie trotzdem am Ball! Beharrlichkeit und gute Taktik zahlen sich aus. Im wahrsten Sinne des Wortes.“
Dann wird mir gesagt, was ich jetzt tun muss (noch ist Zeit): „Sie sollten zunächst Ihre existentiellen Risiken absichern, und sich dann mit dem Thema Altersvorsorge und Geldanlage auseinandersetzen.“
Nach kurzem Aufenthalt auf dieser und ein paar anderen Beratungsseiten habe ich folgenden Eindruck:
-Wer über Geldanlage redet, redet über viel Geld. Unter 20.000 macht wenig Sinn. Die sollten dann am besten auch noch auf 10 Jahre vergessen werden können.
-Bei wenig Geld fällt allen nur Riester ein, und das ist der letzte Nepp. Wird aber nach wie vor gerne verkauft, lohnt sich anscheinend für die Anbieter, danke Deutschland, gut gefördert.
-Wer sich seine netten, nachhaltigsozialen Firmen selbst zusammenstellen und nicht in einen vorgefertigten Fonds investieren will – in dem immer mindestens ein Klima- oder Sozialsünder drinhängt – hat erstens einen hohen Beratungs- und Organisationsaufwand und zweitens ein hohes Risiko. Geht also de facto nicht.
Ach, was für ein herrliches Planspiel für jemanden, der nicht weiß, wie er bis zum Ende des Jahres durchkommen soll.
„Hüten Sie sich vor zu viel Romantik! Paare und Familien, die ein Leben lang füreinander einstehen, sind ein hehres Ideal, aber keineswegs die Regel. Pflegen Sie sich einen gesunden Egoismus und behalten sie die Hoheit über Ihre Finanzen – egal, für welches Familienmodell Sie sich entscheiden.“
September 2017 – hübsch
Wer hübsch ist oder gar schön, der hat lange was davon. Wer noch nie hübsch war oder noch nie schön, der auch.
September 2017 – Doormat
Artikel im Tagesspiegel: Junge männliche Flüchtlinge aus Afghanistan gehen im Tiergarten auf den Strich. Eine ganz neue Szene hat sich da entwickelt.
Man lädt nicht Leute zu sich nach Hause ein, und lässt sie dann jahrelang auf der Türmatte stehen, Aufschrift: Refugees Welcome. Am Ende prostituieren sie sich im Stadtpark und ganz am Ende fahren sie mit dem Lieferwagen in eine Menschenmenge.
September 2017 – PW
Meine Passwörter sind so cool, dass es mir schwer fällt, sie für mich zu behalten.
September 2017 – Tiere und Gewalt
Ich träume sehr viel von Tieren. Und von Gewalt. Das war früher nicht so. In letzter Zeit wird oft geschossen, es geht blutig zu. Kürzlich verfolgt mich ein aggressiver Fuchs, der eigentlich einen bedrohlichen Schäferhund verfolgt, der mir am Ende von hinten auf den Rücken springt. Sich an mir festhält, ganz fest, die Pfoten über meiner Schulter, sein heiserer Atem in meinem Ohr. Er versucht gar nicht, mich anzugreifen, er sucht Schutz bei mir! Vor dem Fuchs. Klar, was Sexuelles ist das auch.
September 2017 – loslassen dranbleiben loslassen dranbleiben
Ich gebe auf. Ich lasse los. Ihr habt gewonnen.
Ich falle.
Was unten kommt, weiß kein Mensch.
Ich bleibe dran.
September 2017 – Bußgeld
Meldung heute, eine Frau und zwei Männer laufen unabhängig voneinander im Vorraum eines Bankautomaten an einem gestürzten, bewusstlosen Rentner vorbei, ohne ihm zu helfen. Die Begründung: Sie dachten, der Mann sei ein schlafender Obdachloser. Der Richter verurteilt sie wegen unterlassener Hilfeleistung. Der mich beunruhigende Gedanke: Das hätte ich sein können. Und ich meine nicht den Rentner.
Die Frau gibt an, vor den Geldautomaten lägen öfter Obdachlose, sie gehe da einfach immer rein, und mache ihre Erledigungen, ohne links und rechts zu schauen. Einer der Männer sagt, er habe in solchen Situationen schon gefragt, ob Hilfe benötigt werde, und sei dann angepöbelt worden. Kenn ich. Bin ich.
Kürzlich kommt nachts auf dem Nachhauseweg eine junge Frau mit riesigem Rucksack die U-Bahn-Treppe hinunter, läuft heulend an mir vorbei, fragt, ob ich einen Euro habe oder zwei, ich, wie immer im Eilschritt unterwegs, bin schon 5 Schritte weiter bis sie ihren Satz beendet hat, scanne im Vorbeilaufen die Situation wie ein Terminator:
– Frau, Ende zwanzig, Fertigfaktor 2 auf einer Skala von 1 bis 10 (also noch recht frisch), Verrücktheitsfaktor 1 (also zu vernachlässigen), Obdachlosigkeitsfaktor 3 (also keine eingefleischte Obdachlose, eher ein Frischling, möglicherweise sogar Backpacker mäßig unterwegs gewesen und akut an irgendeinem Typen gescheitert, irgendeiner Situation zum Opfer gefallen) –
antworte wie immer prompt, routiniert, und wegen nachts und müde zusätzlich noch auf Schutzwall programmiert: Nee sorry – und bin weg.
Warum, denke ich, nochmal 5 Schritte weiter, bist du nicht stehen geblieben, hast einen kleinen Moment inne gehalten? Warum hast du nicht die Routine durchbrochen und sie gefragt: Was ist denn los? Warum heulst du? Hätte ich mir einen Zacken aus der Krone gebrochen, einmal den Schritt zu verlangsamen, nicht schnell, und auf Street Credibility gepolt, sondern aufmerksam zu reagieren, mich von dem kleinen Impuls leiten zu lassen, den es noch gibt, da drinnen, der sagt, Stopp, Mitleid, Verantwortung, vorurteilsfreie statt algorhitmische Beurteilung des Ganzen, dem Impuls also, den ich unterdrücke, um keinen Stress zu haben, nicht in Schwierigkeiten zu geraten, mir den immer gleichen Sermon anzuhören, der am Ende höchstwahrscheinlich wie immer auf eins rausläuft, auf was auch sonst, nämlich: Gib ma Kohle. Und die Schwelle war niedrig, in diesem Fall: Frau, jung, womöglich einfach blöd Pech gehabt. Aber ich war zu schnell, zu abgebrüht.
Was macht diese Stadt mit mir? Is she fucking me up? Oder trifft die Stadt keine Schuld und ich bin einfach nur ein Arschloch? Ist die unterlassene Hilfeleistung woanders zu suchen, liegt sie in der Alltäglichkeit der (augenscheinlich) vorgefundenen Situation.
Jedenfalls, merke: Wenn du schon umkippst, mach das nicht in Bankfilialvorräumen.
Und: Ich nehme mir vor, in den nächsten Wochen und Monaten stehen zu bleiben und Euros raus zu hauen wie geht, bis ich das richterlich verhängte Bußgeld in Höhe von 2500 Euro abgegolten habe.
September 2017 – zurück
Eigentlich bin ich nur noch im Urlaub glücklich. Dann bin ich weg, es ist warm, und ich hab was zu tun. Hier bin ich hier, es ist kalt, und ich weiß nichts mit mir anzufangen.
September 2017 – Marketing
Eine Bekannte (groß, blond, schön) erzählt, dass sie mal den Job angeboten bekommen hat, gegen Geld an einem Speed Dating teilzunehmen. Offenbar hübschen solche Veranstalter ihre Speed Datings mit attraktiven Menschen auf. Ein paar Hotties druntermischeln, schon werden die Bewertungen besser: Bei denen kannste echt geile Frauen kennen lernen, da sitzt gutes Zeug rum, nicht nur der Ausschuss.
Man denkt immer, man hats kapiert, dann kommt die nächste Bombe, so „Mann, wie naiv bist du?“
August 2017 – Luxuskarosse
Eine Freundin erzählt mir von ihrem Peru-Aufenthalt. Sie war dort in einem kleinen Ort mit ihrer zweijährigen Tochter, die sie im Buggy herum gefahren hat. Die Kinder haben interessiert das fremde Kind im Buggy angeguckt und meine Freundin gefragt: Kann sie nicht laufen?
Sie dachten, der Buggy sei ein Rollstuhl.
August 2017 – Style Style Polizei
1
S. findet, alte Frauen sollten sich so anziehen, dass sie niemanden mit ihren Hässlichkeiten belästigen. Dellen, Krampfadern, Besenreißer, rote Flecken, braune Flecken, das ganze Gehänge hier und dort, die sackartige Haut über dem weichen Fleisch, das, findet sie, ist alles eine derartige ästhetisch Zumutung, dass man sie den anderen ersparen sollte. Kurze Röcke, ärmellose Oberteile – nicht, wenn es nach S. geht. Nein, auch nicht am Strand oder wenn es ganz heiß ist. Da besteht sie drauf. Bedeckende Kleidung muss her.
Was, frage ich mich, machen wir bloß mit unseren Gesichtern? Burka für alle ab 40?
Die französische Präsidentengattin Brigitte Macron, 64, sieht sich immer wieder mit abfälligen Kommentaren konfrontiert: In ihrem Alter könne man so nicht rumlaufen. Vor allem die Kürze ihrer Röcke, sprich die Sichtbarkeit ihrer Beine, ist immer wieder Grund zur Empörung. Die Kommentare stammen ausschließlich von Frauen. Und Brigitte Macron hat Beine wie ein Topmodel. Was wär erst los, wenn dem nicht so wäre.
Ich frage eine Freundin, ob sie sich schon mal irgendein Kleidungsstück nicht gekauft hat, weil sie sich gedacht hat: Nee, also das kann ich jetzt echt nicht mehr anziehen. Kürzlich, erzählt sie, war es mal so weit. Da hat sie sich bei einem kurzen Ärmel gefragt, ob das noch geht. Ja, ja, die Oberarme. Winkelemente! Pelikan-Problemzonen! Madonna, Michelle Obama, zu dick, zu stark, zu schwabbelig – und trotzdem ein ärmelloses Kleid!
2
Als ich nochmal bei S. nachhake, korrigiert sie: Sie meint nicht nur alte Frauen. Niemand, der hässliche Körperteile vorzuweisen hat, egal welchen Alters, sollte die zeigen, auch keine Zwanzigjährigen! Diese dicken deutschen Mädchen (S. ist Spanierin) mit ihren Hotpants aus denen die weiße Orangenhaut quillt, das will sie einfach nicht sehen.
Man könnte es sich jetzt leicht machen und S. verunglimpfen. Das ist Ageismus und dann auch noch Sexismus in Reinstform (von Männer redet sie nicht). Aber ich verstehe S. Sie mag es, wenn Leute sich gut kleiden, irgendeinen interessanten Stil tragen. Sie hat das Gefühl, die Welt ist ein bisschen besser, wenn man sich auch auf ästhetischer Ebene Mühe mit ihr gibt. Für sie hat das was mit Respekt sich und anderen gegenüber zu tun, mit Niveau, gepflegter Kommunikation, gar mit Bildung.
Der nackte, kranke, behinderte, alte Körper als Provokation. Kennen wir auch. Brustamputierte Frauen. Beinstümpfe in Großaufnahme. Nacktsein ist doch ganz natürlich, die 70er. Dicksein ist doch auch schön, die Dove-Werbung. Der Mini-Rock als Befreiung, das zerfetzte T-Shirt als Rebellion. Alles dagewesen, alles gehabt, alles wieder eingeholt, reingeholt, nichts davon falsch oder richtig, sondern ständig, sich im Fluss befindende Verhandlungsmasse von race class gender age! Ganz schön anstrengend.
Mit Zöpfchen aufm Rave, wird langsam albern. Aber warum. Und mein Tiger-Shirt will ich behalten, den Jeans-Minirock auch. Am schlimmsten sind die, die sagen, kann dir doch egal sein, mach doch was du willst. Ist mir nicht egal. Ich will nicht machen, was ich will. Wollt ich noch nie. Ich will drüber nachdenken. Über die Verschiebungen, die Schranken. Nur so kommt man weiter. Komplex.
August 2017 – Pissoires
Kürzlich, ich stehe mal wieder in einer unwürdig langen Frauentoilettenschlange in einem Club, die eine Toilette ist mit ausufernd labernden Drogenkonsumern oder Sexmachern besetzt – eh immer schon eine nervige, weil hochprojektive Angelegenheit, mit denen diese Wichtigtuer einen im Kopf belästigen – von denen sich keiner durch Türgewummer aus dem Konzept bringen lässt, so arschcool sind sie – die zweite Toilette also zu wenig für so viele Frauen, und die Jungs marschieren nur so an uns vorbei aufs Pissoir und kommen in Nullkommanix wieder zurück, schnell ab Richtung Tanzfläche oder Bar. Ich bin genervt. Und zum ersten Mal kommt mir der Gedanke, dass Pissoirs womöglich diskriminierend sind. Und dazu da, den strukturellen Penisneid aufrecht zu erhalten.
Als ich nach einer Dreiviertelstunde vom Klo zurück bin – das Papier war alle bzw. lag im Dreck und ich hatte keine Tempos dabei – und die These bei den anwesenden Männern ausbreite, bekomme ich umgehend die schlaue Antwort: Nimm doch ne Fusionella, dann kannste auch im Stehen pinkeln. Da kann ich nur die Augen verdrehen. Also nichts gegen die tapferen Mädels von der Fusion, die sich des ewigen Problems angenommen haben und die biologisch abbaubare Papierpinkelrinne zum Vornedranhalten entwickelt haben, gute Aktion!, aber wer da nicht daneben pinkelt ist untenrum entweder anders gebaut oder nüchtern oder hat 3 Liter Schussflüssigkeit intus oder kein Problem damit, das Ding so durch den Hosenschlitz in die Unterhose (besser man zieht dann auch eine mit Schlitz an) reinzufummeln, dass man nicht den Hintern sieht oder kein Problem damit, dass alle anwesenden Pissoir-Jungs interessiert schauen oder triumphierend vor sich hingrinsen oder aufmunternd lächelnd, ganz im Reinen mit sich und ihrer Natur, deren meisterliche Fähigkeiten du dir gerne angucken kannst, da haben sie gar nichts dagegen, dir das zu zeigen.
Wieso zum Donner ist das erste, was den anwesenden Jungs einfällt, dass wir uns der Welt, sprich IHRER WELT anpassen müssen (die ja bekanntermaßen so toll ist), uns Papierpenisse dranschrauben müssen, Ersatzwerkzeuge, natürlich niemals so gut wie das Original, damit wir mithalten und auch schnell auf Toilette und in die Büsche pinkeln können? Ist das das Erstrebenswerte? Wollen wir so leben? In einer pinkelnden Männerwelt in der auch die Frauen in der Lage sind, Großes zu vollbringen mit ihren DIY-Penissen, und im Stehen zu pinkeln, auf ewig dazu verdammt, ein defizitäres Bild abzugeben? Ich meine, Männer brauchen doch eh Toiletten, wenn sie mal kacken müssen. Also wieso, liebe Clubs, stellt ihr uns nicht einfach sagen wir mal 6 Toiletten hin, vor denen wir alle gemeinsam, inklusionsmäßig gleichberechtigt scheißlange in der Schlange stehen müssen? Und sitzen, ganz ehrlich und nur zur Info, das tut sowieso niemand auf diesen Toiletten, außer er ist lebensmüde. Und für die Drogis brauchts mal ein Chambre Separee.
Juli 2017 – übrig
Am Ende werden da nur Frauen sein. Sieht man ja überall. Diese Frauenbanden. Zusammen kulturell unterwegs. Die Männer werden dann statistisch betrachtet tot sein. Oder bei Frauen, die schön sind, und die Männer und ihre Rede bewundern. Am Ende müssen die Frauen einander genügen. Sie leben dann in einer Frauenwelt.
Juli 2017 – Werte
Komisch, dass man sich plötzlich gezwungen sieht, Werte zu vertreten. Werte, die im Grunde ihres Herzens konservativ sind. Wo man doch immer dachte, Werte sind was für autoritäre Großväter, für CSU-Wähler, Alt-Nazis, Gartenzwerg-Spießer, sprich: für die alte Bundesrepublik. Die es galt, zu überwinden. Die Augen hat man verdreht, im Kollektiv, wenn einer mit Regeln kam, mit Gepflogenheiten, Höflichkeit, Anstand. Dagegen ist man doch angetreten in den 68ern, 70ern, 80ern, das hat man doch in Frage gestellt, von Punk bis Frau, von Hausbesetzer bis Sympathisant, von Hippie bis Öko, dagegen hat man doch rebelliert. Und zwar erfolgreich. Und jetzt sitzt man da, liest die SZ oder guckt CNN oder hört DLR und denkt: Kann sich eigentlich irgendjemand mal benehmen? Hat eigentlich irgendjemand noch einen Funken Anstand im Leib? Ist Lügen und Betrügen und korrupt sein und Hate Speech verbreiten zu den wichtigsten Parametern geworden, um Erfolg zu haben? Um eine Karriere zu haben, um belohnt zu werden, beliebt zu sein, gewählt zu werden, die Geschicke der Welt bestimmen zu können. Liegt das jetzt am Alter oder an den veränderten Verhältnissen, dass ich plötzlich denke, was spricht dagegen, die Kacke von deinem Hund aufzuheben, dich zu entschuldigen, wenn du jemanden anrempelst, die Person, die dich liebt, nicht zu betrügen, deine Steuern zu bezahlen, deine Doktorarbeit nicht zu fälschen oder zu kaufen, sondern dich verdammt nochmal auf deinen Arsch zu setzen und sie selber zu schreiben. Bin ich konservativ, wenn ich finde, dass laisser faire nichts anderes ist als Indifferenz?
Juni 2017 – Fundstück

August 2017 – Ozark
Neue Serie auf Netflix. Bewährtes Muster, trotzdem gut.
Eine überhitzte, mückenlastige, nur aus Seen, bewaldeten Bergen und Steilküsten bestehende Redneck-Landschaft: Ozark. Der liberale, gut situierte Chicagoer Familienvater Marty Bird packt von einem Tag auf den anderen Frau und Kinder in den Familien-Van und zieht hierher. Im Kofferraum befinden sich außer dem Nötigsten: Taschen voller Geld, genau gesagt: 8 Millionen Dollar in bar. Marty hat sich die Chance, das Geld hier in Ozark zu waschen, erbettelt, und zwar von Del, dem Boss eines mexikanischen Kartells, für den er und sein Kompagnon seit Jahren Geldwäschegeschäfte machen, solide und diskret. Doch Martys Kompagnon ist greedy geworden und Del hat sich geärgert. Sehr geärgert. Also hat Del das gemacht, was zur job description von Kartell-Bossen dazugehört: Er hat alle umgebracht. Auch Marty ist kurz davor, als Leiche im Säurefass zu landen. Den Pistolenlauf im Gesicht schafft er es, Del mit seiner spontan aus dem Hut gezauberten Idee zu bequatschen, in Ozark, einer Ferienregion mit tausenden Kilometern Küste, ein dickes Geschäft zu machen. Da kann Del, in erster Linie Geschäftsmann, nicht Nein sagen. Nun sitzt Marty hier in der Pampa, und hat 3 Monate Zeit, das Geld unter die Leute zu bringen, und dadurch sein Leben und das seiner Familie zu retten – eine ticking clock, die, das ahnen wir, auch oder gerade wenn er sie einhält, für Marty auf ewig in die Verlängerung gehen wird. Wer sich einmal mit dem Teufel einlässt.
Seine Kinder, ein feinsinniger Junge im Grundschulalter und eine selbstbewusste Teenietochter, sind wegen des abrupten Ortswechsels sauer auf ihn. Von seiner Frau, die ihn betrogen hat, ist er entfremdet. Und Geld waschen, das lernen wir, ist harte Arbeit. Denn Geld muss nicht nur buchstäblich gewaschen werden – sehr schön, wie Marty in einer Folge seinem Sohn erklärt, wie man Geld in der Waschmaschine wäscht, damit es gebraucht aussieht – sondern es muss auch gegen verblüffend viele unerwartete Widerstände ausgegeben werden. Das Misstrauen der einheimischen Bevölkerung gegenüber dem Geschäftsmann aus der Stadt und seinen Versprechungen ist groß. Das viele Geld aus dem großen Verbrechen ruft schnell das kleine auf den Plan. Die Trailer-Park Familie Langmore – ganz reizend: die Tochter – kommt ihm schnell auf die Schliche und fordert ihren fair share. Das nette, ältere Farmer-Ehepaar, das auf dem Markt sein Obst und Gemüse verkauft und jeden Sonntag dem engagierten jungen Pfarrer bei seiner Predigt zuhört, entpuppt sich als Kopf eines die ganze Region beliefernden und wie geschmiert laufenden Drogenkartells, gegründet auf dem Anbau von Mohn. Von wegen die Mexikaner undd as organisierte Verbrechen, America first! Marty bringt mit seinen Ambitionen die ganze Architektur aus der Balance. Dass auch das FBI Marty im Vorgarten und im Nacken sitzt, und seine eigenen Verbrechen begeht, um das Verbrechen zu jagen, ist klar.
Die Farben sind ausgegraut in Ozark. Das Wasser, von dem, mit dem, gegen das die Bewohner der Region leben, ist allgegenwärtig. Dieses (Trumpsche) Amerika kennt nur noch den Betrug, das Verbrechen, das Geld. Wie das Wasser sind diese drei Essenzen überall, durchwandern und verbinden alles, halten das Land, die Beziehungen, das Überleben am Laufen. Der Wahnsinn ist total, sodass ein anderes Leben nicht mehr möglich scheint, es gibt keine Lösung, niemand kommt zur Ruhe. Noch die Aufrichtigsten werden von diesem Wahnsinn korrumpiert, der sich alles, was zart oder wertvoll ist, zunutze macht, seinen Gesetzen unterwirft.
Das alles geschieht wie schon in Breaking Bad und vielen anderen Serien/Filmen, die sich im weitesten Sinne mit Mafiastrukturen beschäftigen, im Namen der Familie. Für ihre Hauptfiguren – Männer – ist die Familie der Grund, die Motivation und die Legitimation fürs Verbrechen. I have to provide for my family (protect trifft es nicht mehr so recht) ist ihr Glaubenssatz. Er bestimmt ihre Identität als Mann und treu sorgender Familienvater, als Ernährer eben, da können sie noch so modern, weich, liebe- und verständnisvoll sein. Für die Familie begeht der Mann jedes Verbrechen, wenn es sein muss, sogar das Verbrechen an der Familie. Natürlich geschieht das mit dem Wissen und der Unterstützung der Frau (in Ozark anders als in BB schon von der ersten Sekunde an). Der Mann agiert auch in ihrem Sinne, auf ihren Wunsch. Mann und Frau sind Partner, und da auch die Kinder Bescheid wissen und sich aktiv beteiligen gilt: It‘s a family business.
August 2017 – Documenta
Well, bisschen boring diese Documenta. Dabei gibt sie sich doch einfach Mühe auf die aktuellen globalen Ereignisse zu reagieren. Was soll sie auch sonst machen, das macht sie halt, kann man ja irgendwie auch erwarten, ist ja durchaus sinnvoll. Weniger KunstKunst eben, da geht ja auch eh nichts mehr, eher so ThemenKunst.
Ich nehme mit, dass Andreas Temme, Verfassungsschutzmitarbeiter – bei der Tötung Halit Yozgats durch die NSU in dessen Internetshop anwesend – anders als von ihm behauptet, die Schüsse gehört, den Schießpulvergeruch gerochen, die Leiche gesehen haben muss. Dass die Justiz sich geweigert hat, eine Ortsbegehung zu machen. Was mich am meisten irritiert, woran ich hängen bleibe: Temme hat Yozgat nachdem die tödlichen Schüsse gefallen waren, Geld für die Internetnutzung auf den Tresen gelegt, bevor er den Laden verlassen hat. Ich weiß nicht genau, warum, aber es kommt mir so vor, als sei diese Geste selbst ein Verbrechen. Da befolgt einer die Buchstaben des Gesetzes, hält sich an Recht und Ordnung, verlässt den Laden, ohne sich etwas zu Schulden kommen zu lassen, macht reinen Tisch. Angesichts des toten Menschen hinter dem Tresen ist diese Geste so herablassend, triumphierend, wegwerfend, erniedrigend, spöttisch und abschließend, dass man Gänsehaut bekommt. Haken drunter, das wär erledigt, hier hast du den Salat.
Wenn es die Kunst ist, die diesen Zusammenhang aufdeckt, aufdecken muss, was ist dann los mit dieser Welt.
Ansonsten ist Kassel selbst wie Pforzheim Mühlacker Bielefeld Karlsruhe Gießen Offenbach. Eine prototypische deutsche Stadt mit Fußgängerzone, Migrantenviertel, Usselecken, SexShops, Park und ein paar schönen Gebäuden. Ich freue mich, dass wir Grüne Soße essen, Behinderungen sind ein gutes Thema, vor allem, wenn man es global betrachtet, und die Kantine in der Neuen neuen Galerie ist cool, weil dort, wo früher die Bratwürste brutzelten, alles voller Pflanzen ist.
Schüss, Kassel, bis in fünf Jahren.
August 2017 – Deutsche Kartoffel
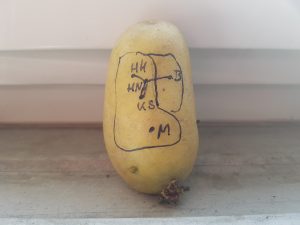
Wieso Berlin weiter weg von Kassel liegt als Hamburg: Weil’s im Osten ist, sagt T.
siehe hierzu auch: Planet Zitrone
August 2017 – Frau Schwesig
So, ich mach hier mal ne Prophezeiung. Manuela Schwesig wird die Bundeskanzlerin nach Angela Merkel. Wenn die SPD nicht dumm ist, ist sie aber leider, dann schiebt sie die das nächste Mal nach vorne. Gestern lese ich ein Interview mit ihr. Die hat Lust, was zu machen, und nicht nur abzuwarten, bis was passiert und dann drauf zu reagieren. Das ist das erste Mal, dass ich ein Gefühl dafür bekomme, was ein schlagendes Argument gegen Frau Merkel sein könnte, wie die Stimmung gegen sie kippen könnte, in diesem Land. Kommt natürlich auch schwer drauf an, was noch so alles passiert in den nächsten vier Jahren. Und Merkel tritt nächstes Mal sowieso nicht mehr an.
Mai 2017 – frame it

August 2017 – Schlechtelaunewetter
Der mieseste Sommer seit 16 Jahren (Elli-in-Berlin-Zeitrechnung).
Ich lese passend dazu ein Buch von Philip Blom über die Auswirkungen der Kleinen Eiszeit im Mittelalter: Modernisierungsschub.
August 2017 – Deutschland Detroit
Sollte man vielleicht besser bald mal kapieren, dass man am Ende ist. Dass man nicht mehr weiterkommt, mit fetter, jahrzehntelang gut gepflegter, politisch hochrangig unterstützter Arroganz, Winterkorn. Dass das alles letzte, verzweifelte Aufschreie einer sterbenden Industrie sind, einer Epoche, Dieselaffäre. Dass der Verbrennungsmotor im Angesicht des Digitalen ungefähr so lame und old-fashioned wirkt wie einst das Pferd gegenüber der Dampfmaschine. Und wenn die Politik (Kretschmar/Die Grünen: 2030 no way!; Berlin/Rotrot: Baut Autobahnen bis Kreuzberg!, Dobrindt/Merkel: Lieferverkehr auf die Straße, keine Quote für E-Autos, Software-Update gegen Dieselgate!) und die Gewerkschaften (Google böser Konzern, VW guter) weiterhin so fleißig beim Ignorieren und Arrogant sein helfen, wird Deutschland dann Detroit?
Werden wir in 10 Jahren durch ein abgewirtschaftetes, abgehalftertes Land voller Industrieruinen und tragisch-verarmter Einzelschicksale laufen, durch ein Land, das den Schuss nicht gehört hat, nicht schnell genug reagiert, umgebaut hat, sich ausgeruht hat auf der Idee vom deutschen Ingenieursgenie, nicht einmal mehr die einst so gut abgesicherten VW Arbeiter noch Geld übrig haben, ein Land, in dem alle Fascho-Parteien oder Trumpartige Bundeskanzler wählen, in dem die Jungen, die gut ausgebildeten Digitalisierungskinder nach Spanien oder Griechenland abhauen, wo die Krise lange vorbei ist und ein europäisches Silicon Valley blüht? Wird man in Wolfsburg und Stuttgart in 10 Jahren in Essen und Bochum anfragen, wie die das denn gemacht haben mit ihren Zechen und Stahlwerken, wo lange, sehr sehr lange Gras über alle und alles gewachsen ist, bis man mit viel Fördergeld die Kultur hat einigermaßen erblühen lassen?
Werden wir womöglich in 10 Jahren durch Stuttgart laufen und Luft bekommen? Werden wir durch Wolfsburg spazieren und wegen der leisen Elektroautos die Vögel hören, die sich in den leerstehenden Fabrikgebäuden eingenistet haben? Wird kein Stick- oder Kohlendioxid uns mehr vergiften, werden Bus und Tram Vorfahrt haben, statt im Stau zu stehen, werden wir keine verletzten oder toten Radfahrer mehr in unserem Freundeskreis zu verzeichnen haben? Wirklich angsteinflößend das.
Bosch (die mit den Kühlschränken) konzentriert sich gerade auf KI. Ich kann nur sagen, bringt den Kindern programmieren bei. Auf dass das selbstfahrende E-Auto der Sputnick-Schock fürs Klassenzimmer sei.
Juli 2017 – im Kino
T. und ich im Kino.
Ich: Hast Du Dein Handy ausgemacht?
Er: Nee. Falls jemand anruft.
Juli 2017 – RobbyKalleMonteur
Bekomme heute ein Holzbett geliefert. Von einer Firma aus Kreuzberg. Schon gleich als die beiden Monteure durch die Tür kommen, ist klar, wer der böse Monteur und wer der gute Monteur ist. Der böse guckt böse, ist klein, bärtig, hat Tribal-Ohrringe, ein T-Shirt mit einer gefährlichen Band drauf und eine 90er Jugend. Der gute ist groß, schlaksig, hat einen Zurückwerf-Pony, kichert fröhlich und sieht ORIGiNAL aus wie Kalle aus RobbyKallePaul, nur jetzt 50. Er hat auch das gleiche Gemüt wie Kalle. Er freut sich über mein Sch sch an der Wand über dem Bett und als er die alte Ausgabe von Pünktchen und Anton entdeckt, freut er sich gleich noch mehr. Hat bestimmt mal Tischler gelernt oder immer da gejobbt. Die beiden riechen nach Werkstatt, Holz, schon lange bei der Firma und gutem Arbeitsklima. Könnten auch in einer Kita oder einem Schülerhort arbeiten. Oder auf dem Abenteuerpielplatz. Bss bss, mit dem Akku-Schrauber und das Bett steht. Allerliebst. Kreuzberg 80er in the house!
Juli 2017 – Geht gar nicht. Oder?
Ich sitze in der U5. Eine junge Frau kommt rein – ich schätze Roma – eine alte, verknüddelte Motz in der einen Hand, einen leeren Pappbecher in der anderen. Sie beginnt ihre Tour durch den locker gefüllten Wagen, hält jedem der Mitfahrenden murmelnd den Becher unter die Nase. Sie kommt bei zwei Frauen vorbei, beide so Ende zwanzig/Anfang dreißig, leicht angeprollt, groß, blond, lange Haare – vor allem die eine. Als die Frau ihr den Becher hinhält, guckt sie provozierend dumm hinein, als wüsste sie nicht, was der bedeutet, dann ihr ins Gesicht, dazu macht sie eine Handbewegung, die sagt: Gib du mir was, Alte. Sie wiederholt das, sagt: „Fh, nee“, zeigt mit dem Zeigefinger der Frau ins Gesicht, macht wieder die schaufelnde Handbewegung: Gib du mir doch was. Der jungen Frau fällt das Gesicht runter, der Freundin ist es leicht unangenehm, aber nur leicht. Ohne die restlichen Fahrgäste weiter durchzumachen geht die junge Frau mit ihrem Becher zur Tür, sie ist verstört, wütend. Als die Tür bei der nächsten Station aufgeht, schickt sie einen schnellen, lautlosen Fluch in Richtung der Blonden, dann ist sie weg. Die Blonde hat nach einem: „Na, ist doch wahr“, einfach mit der Freundin weitergeredet.
Mein erster Impuls: Geht gar nicht, blöde Nazi-Schlampe – sicher auch durch U5 und prollig-Kontext mit angetriggert. Ich bin kurz davor, was zu sagen, ich finde es demütigend, was sie da macht, finde, sie führt die Frau vor, finde die Handbewegung herabwürdigend, ja rassistisch – sie hat ja nicht mit ihr geredet, sondern ist gleich mal von „die versteht eh kein Deutsch“ ausgegangen, warum eigentlich, wegen des Gemurmels. Aber ich gebe zu: Ich bin auch überrascht, erstaunt, fasziniert.
Ich kenne die Zumutungen der täglichen U-Bahn-Fahrt, die Attacken der Armut, der Krankheit, der Craziness. Ich hab sie voll drauf, die Routine des Abnickens, Wegnickens, höflich Bleibens, obwohl schon der Zehnte sich mir ins Gesicht schiebt. Ich setze mich dem aus. Ich lasse mich beschimpfen, volllabern, vollstinken. Ich bin dazu bereit, immer wieder aufs Neue, ja, ich erwarte von mir, mich dem auszusetzen, mich damit offen und ehrlich zu konfrontieren, nicht die Augen zu verschließen vor den Zuständen dieser Welt. Ich bin dazu bereit, mich jedesmal für einen Moment unangenehm zu fühlen, ein schlechtes Gewissen zu haben. Es kommt mir aufrichtiger vor, hier zu leben, inmitten dieser Zumutungen, als in der Kleinstadt. Es kommt mir anständig vor, mich dem auszusetzen. Mich nicht in einer Blase zu befinden, sondern in der „echten Welt“. Ist das BLÖDSINNIG? „Echte Welt“ ist schließlich global betrachtet äußerst relativ. MASOCHISTISCH? Man könnte sich für sich selbst einen anstrengungsfreieren Alltag wünschen, wär jetzt auch nicht total verboten (macht man ja auch mit Lärm, Hundekot und Luftverschmutzung, alles menschengemacht). Womöglich FRAGWÜRDIG? Man geriert sich als Gutmensch, der doch eigentlich nur sein Umgangslevel damit gefunden hat, auf dem sich nichts verändert, man nichts durchbricht, sich nur die Situation erträglich macht.
Eine Frau kommt rein und will Geld. Das ist ein performativer Akt. Den wir alle kennen. Die Signale sind klar, auch die Armut ist ein Business. Ich bin Teil dieses Aktes. Ich gebe etwas. Oder ich gebe nichts. Das ändert jeweils an der Funktionsweise des Aktes nichts, beides ist Teil seiner Aufführung. Dem Akt eingeschrieben ist die Annahme, dass die Person, die um Geld bittet, arm ist, und die Person, die angesprochen wird, reich oder zumindest im Vergleich mit der um Geld bittenden Person so reich, dass es ihr nicht weh tut, ein paar Münzen zu entbehren, während die bittende Person das Geld zum Überleben braucht. Der Akt wird – wie viele performative Akte – an mich herangetragen. Ich kann ihn mir nicht aussuchen. Ich werde nicht gefragt, ob ich Teil seiner Aufführung sein möchte oder nicht, ich bin es einfach. Die Person, die um Geld bittet, wird aber auch nicht wirklich gefragt, ihr bleibt nichts anderes übrig als den Akt aufzuführen, so zumindest die Annahme. (Daher auch mein Gefühl, sie führt die junge Frau vor: Was soll sie anderes machen, ist für sie doch eh schon demütigend genug, siehe Grundannahme)
Die Reaktion der Frau in der U-Bahn, könnte man als Kommunikationsguerilla bezeichnen (auch wenn die sich im Allgemeinen für andere Kontexte interessiert). Sie hat für einen Moment die Spielregeln nicht befolgt. Sie hat sich neben das Spielfeld gestellt. Sie hat sich verweigert. Sie hat eine festgelegte Struktur, eine Wiederaufführung des Immergleichen, einen institutionalisierten Aktes hinterfragt. Sie hat die Situation umgedreht, die grundlegende Annahme in Frage gestellt. Was, wenn ich gar nicht diejenige bin, die mehr hat als du. Woran machst du das fest, an welchem Signal. Armut ist heute oft unsichtbar. Primark Klamotten kann jeder. Nur weil ich keinen Becher in der Hand habe. In die Hand nehme, auch das ist eine Entscheidung. Vielleicht krieg ich auch Hartz IV. Vielleicht mach ich drei Jobs und hab nicht genug. Was weißt du schon von mir. Mach nicht was aus mir, ohne mich zu fragen. Ich lasse mir nicht deine Aufführung aufdrücken. Du mutest mir etwas zu, das ist dein Recht. Ich grenze mich ab, das ist mein Recht. Rechne nicht mit mir. Rechne nicht mit dem uns verordneten Spiel. Bleib wach.
Unterm Strich, das merkt man schon: Eher garantiert so AfD-Wähler. Hatten die, – ah, nein, die NPD! – nicht mal dieses schöne Plakat: Geld für Oma nicht für Roma. Das Soziale und das Rassistische geht bei denen ja schon immer pervertiert problemlos zusammen.
Trotzdem, alles in allem, zumindest: Anregende Situation.
Juli 2017 – Die Unterhosen
Auf dem Balkon über die Straße weg: Die Unterhosen. Die Unterhosen sind immer nur in Unterhosen. Sie treten ab und an auf den Balkon, gucken nach dem Rechten, dem Wetter und der Katze. Dann gehen sie wieder rein. Die Männerunterhose trägt ausgewaschene Pseudo-Schießer, die Dame Schlabber-Schlüpfer mit Breitseite. Falls es mal Gummi gab, gibt es jetzt keins mehr, das ist in der Waschmaschine zu Kaugummi geworden oder hat sich langsam aufgelöst. Die Katze hat auch schon die Nase voll vom ewigen Anblick der Unterhosen. Sie ist immer auf dem Balkon. Weiter weg kann sie nicht: Vor dem Balkon ist ein Gitternetz, falls sie auf die Idee kommt, sich zu Tode zu stürzen.
Juli 2017 – The Dark Knight Rises
Ich komme nicht aus dem Bett. Die Arme sind zu schwer. Ich schaue eine Comedy Serie. Ich fresse die wie Nutellabrot. Aus meinen Augen läuft dauernd was, das ist gar nicht zu kontrollieren. Ich frage mich, ob heute der Tag ist. An dem ich aussteige. Destruktion und Befreiung sind die Medaille. Ich frage mich, was die Konsequenzen sind. Aus der Erkenntnis, dass. Ich weiß keine Antwort, weder im Großen noch im ganzen Detail. Denn alles hängt ja mit allem zusammen und hat Auswirkungen auf anderes und bedingt sich mit unabsehbaren Folgen, also was soll ich. Da ist er wieder. Der schwarze Ritter. Er war länger nicht da. Überraschend physisch kniet er auf mir, ist vielleicht sogar ich. Mal schauen, wie lange er bleibt. Ein paar Tage werdens wohl sein. T. geht mit mir Kaffee trinken. Meine Augen brennen. Meine Knochen sind erschöpft. Fährt mit mir Auto, das Leben hinter der Scheibe, das ist gut. Legt sich neben mich ins Bett. Das hilft, wenn man krank ist.
Juli 2017 – Halbjahresbilanz
Sehen wir leider keine Möglichkeit. Passt nicht ins Programm (das ich Ihnen anbei zusende). Da hör ich schon die Fragen. Wir denken eher an sowas wie Toni Erdmann. Ist nicht zu finanzieren. Wir suchen was für Weihnachten. Toll, wirklich, genau der Ton, den wir haben wollten. Aber wir brauchen was, was wir das ganze Jahr verkaufen können. Du hast ja im Grunde schon alles. Jetzt nur nochmal ganz anders. Auf das Thema kann ich dann auch einen Promi draufsetzen. Hatten wir schon, guck dir mal Folge XY an. Achsooo – na gut, ich kanns ja mal weitergeben. Echt super Pitch. Aber hast du schon mal überlegt, das wie in dieser australischen Serie zu machen.
Juni 2017 – Schall und Rauch
Alle sind immer so pikiert über die Frage nach dem Namen bei Starbucks. Ich gebe sehr gerne meinen Namen an, wenn ich gefragt werde, für wen der Kaffee denn sein darf. Ich heiße dann z.B. Daphne oder Zoe oder Lou. Alice hatte ich schon – wegen Alice im Wunderland und Alice in den Städten einer meiner all time favorite Mädchennamen – aber auch abwegige Sachen wie Patty, Fanny, Penny, Lana, Elsa, Inga, Malu und Kai. Demnächst mach ich mal die 80er Spießernummer mit Dagmar, Beate, Bettina und Yvonne. Wer man alles sein kann, ist doch herrlich!
Juni 2017 – Valencia
Die Hitze ist wie eine Umarmung. Sie sagt. Es ist nicht so schlimm. Es wiegt nicht so schwer.
T. und ich arbeiten jeden Tag ein bisschen in der Bibliothek. Wir gehen ins Kino, trinken Kaffee, essen, kaufen ein, gehen abends ein Glas Wein trinken. Nach fünf Tagen weiß ich nicht mehr, warum wir nicht einfach hier bleiben.
Juni 2017 – Geliebtes Tier, ich esse dir
Ich gehe mit B. ein Bier trinken. Wir reden über Tiere. Ich mag Tiere. Er auch. Da haben wir beide viel zu erzählen.
Wir reden über Oktopusse, Eichhörnchen, Seepferdchen und Pinguine. Wir begeistern uns für Esel, Ziege, und die allseits unterschätzte Kuh.
B. sagt, er mag Tiere sogar so gern, dass er Lust kriegt, sie zu essen, wenn er sie sieht. Er schaut so eine Gämse an, wenn er sie beim Klettern trifft oder sieht so einen Fischschwarm, wenn er schnorchelt, und findet sie so wundervoll, ist so begeistert von ihnen, dass er so richtig Appetit bekommt, auf einen schönen, saftigen Ziegen-Braten oder eine leckere, gegrillte Forelle am Abend. (B. ist, wie man hier unschwer erkennen kann, eher so der Outdoor-Typ, er kennt Tiere aus der freien Natur, anders als ich, die sie aus dem Fernsehen oder dem Was ist was-Buch kennt).
Das habe ich noch nie gehört. Dass einer sowas sagt. Dass er Tiere zum Fressen gern hat. Ich finde das so witzig wie genial: Der Carnivore als der konsequenteste aller Tierliebhaber!
Ich hoffe nur, B. macht das nicht auch serienmäßig mit Frauen.
Juni 2017 – Feminist
Ich bin auf einer Konferenz. Es geht um gute Sachen, aktuelle Fragen und Gedanken. Der Veranstalter und Moderator hat die Vortragenden des Tages um einen runden Tisch versammelt, von wo aus sie aufstehen, zu ihrem Pult gehen, zwischendurch diskutieren. Augenfällig: Alles Männer, eine einzige Frau.
Nach der Pause berichtet der Moderator, dass die Frau ihn darauf aufmerksam gemacht habe, dass nur Männer am Tisch seien. Das, meint er, und lacht leicht nervös, wollen sie (die beiden männlichen Veranstalter) natürlich nicht, sie mögen Frauen, finden Frauen ganz toll, ja, er sei Feminist. Er schlägt vor, dass einige der Frauen aus dem Publikum, die er kennt, sich mit an den Tisch setzen, mitdiskutieren. Die wollen aber nicht. (Komisch).
Noch eine Pause später – die Sache scheint ihn schwer zu beschäftigen – haben sich ein paar seiner Freundinnen breitschlagen lassen, und sich mit an den Tisch gesetzt. Als er anfängt sie vorzustellen, fällt ihm bei zweien ein, dass sie früher Schauspielerinnen waren, bei einer dritten, dass sie sogar mal Model war. Wow! sagt er. (Genau das denke ich auch). Eine anwesende junge Amerikanerin, sowieso not amused von seinem Gehabe, sagt: You are makin it worse. Er tut daraufhin so, als sei sie gekränkt, weil er nicht ihr, sondern einer anderen Frau eine Frage gestellt hat: I have a question for you, too, in a second I have a question for you, too, sagt er, als wären seine Fragen goldene Bonbons die aus seinem Mund kommen, und nach denen sie sich verzehrt. Auch eine Möglichkeit, eine Attacke abzufedern, einfach den anderen zum Narzist erklären.
Fassen wir das mal zusammen. Da ist also einer, ein Chef und Podiumsbestimmer, der von der einzigen Frau am Tisch mit der Nase darauf gestoßen wird, dass er sich möglicherweise keine Gedanken über sowas wie Repräsentation auf seiner Veranstaltung gemacht hat. (Bis zu diesem Zeitpunkt schien mir das kein größeres Problem zu sein, am Tag zuvor waren viele Frauen da. Aber das war wohl eher Zufall wie sich zeigt). Er kriegt jedenfalls einen Schreck und fühlt sich ertappt, und weil er doch ein Guter ist und sein will, ein Aufgeklärter, bittet er rasch die anwesenden Frau/Freundinn/en sich zur Übertünchung des Fauxpas um den Tisch zu garnieren. Aber gegen strukturelle Problematiken und Misogynie hilft nun mal keine Floristik. Die tapferen Frauen, die sich dazugesetzt haben, waren schon von vorneherein im unauflöslichen Dilemma. Präsenz zeigen, den Mund aufmachen, und sein dekoratives Spiel mitspielen waren schon nicht mehr voneinander zu trennen.
Was lernen wir daraus? Erstens. Junge Amerikanerinnen sind anscheinend gnadenloser, wenn es darum geht, bei dem Thema zurück zu schießen (siehe auch Miranda July). Als er auch noch was von „Trump ist der neue Hip-Hopper“ faselt, fragt sie What do you mean? Da rudert er rasch zurück, jetzt bloß nicht auch noch latenter Rassismus-Vorwurf. Irgendwie redet er sich immer mehr Kopf und Kragen.
Zweitens. Wenn einer sagt, er sei Feminist, muss einen das misstrauisch machen. Feminismus bedeutet nicht, Frauen wahnsinnig schön, stark, und begehrenswert zu finden. Feminismus ist nicht, wenn man auf Frauen steht. Von da aus ist es nicht mehr weit zum Bumper Sticker „Ich bin für Frauenbewegung, solange sie rhythmisch ist“. Oder wie ein gender-studierter Geisteswissenschaftler-Polit-Freund mal gesagt hat: Ich bin für Emanzipation, denn emanzipierte Frauen sind selbstbewusster und deshalb viel besser im Bett. Da bleibt einem doch die Spucke weg.
Drittens. Männer, die sich als Feministen bezeichnen, wollen einem was wegnehmen. Sie wollen einem was wegnehmen, was sie gar nicht haben können. Oder kann ich als Weißer sagen, ich bin Black Power? Nee, kann ich nicht. Ich kann sagen, ich unterstütze eure Sache, weil ich die Schnauze voll habe, von diesen gesellschaftlichen Zuständen, weil ich mich selbst eingeschränkt fühle, von diesen identitären Zuschreibungen (hier hinkt der race-Vergleich), das kann ich alles sagen, und das ist auch im höchsten Maße wünschenswert, dass möglichst viele das sagen, aber ansonsten hab ich doch gefälligst zu kapieren, und damit zu leben, dass ich das Problem bin. Ich bin ein strukturelles Problem, ich bin ein Täter, das hab ich zu akzeptieren, ich kann jetzt nicht auch noch das Opfer sein wollen, den Opfern das Opfersein wegnehmen wollen. Sorry.
Juni 2017 – Weimar
Schon kein guter Start, ich und Weimar. Das AO Hostel liegt an einer menschenfeindlichen Zufahrtsstraße mit Druckampel zwischen Tanke und McDonalds und ist natürlich hässlich. Es hat keine oder eine zu gut versteckte Rampe für den Koffer, und braucht ne geschlagene halbe Stunde in der Schlange, bis es mir sagt, dass ich noch nicht einchecken kann.
In Weimar drin dann alles auf einem Platz: Goethe und Schiller Weimarer Verfassung Bauhaus Museum – alles kondensiert auf einem Haufen, einem Deutsche-Kultur-Haufen. Drumrum die übliche Mischung deutsche Fußgängerzone, hier mit einem Ost-spezifischen Schlag interpretiert: Arschgeweihe, Kulturtouristen, Roma, Kram-Discounter, Oma-Cafés, Pizzeria Romantica, Adipositas-Familien, Rollatoren, Hightech-Ausflugs-Radler, Rostbrat-Wurstebuden, Jung-Nazis als wär nix dabei, AfD-Nazis als wär nix dabei, ein paar Studenten, kaum Migranten, ein Junggesellenabschied, Goethe und Schiller als Salzstreuer im Souvenir-Shop, ein paar schöne Häuser, ein paar hässliche, ein sozialliberales Kulturzentrümchen, ein wohlsortierter Park. Im Hintergrund dräut Buchenwald.
Im Bauhaus Museum erfahren wir, dass die Bauhausianer von Anfang an zu kämpfen hatten mit der Stadt. Das ganze moderne Hippiezeug, das ganze arme Künstlergesocks, das kein Geld hatte und entscheiden musste, ob der Ofen angemacht wird, um zu heizen oder Keramik zu brennen, die jungen Mädels, die kamen, um zu studieren, das war der Mehrheit der Weimarer alles ein Dorn im Auge. Wir wissen, wies ausging. Die Stadt, die heute von all dem profitiert, macht auf mich nicht den Eindruck, als hätten ihre Einwohner G und S gelesen, wären je im Bauhaus Museum gewesen oder nach Buchenwald gefahren, außer mal mit der Schuuullee Augeverdrehsmiley. Kultur steht rum und ist für die Aushäusigen. Die würden das Bauhaus wieder vertreiben, genau wie damals.
Muss ich nicht mehr hin. Nach Weimar.
Juni 2017 – Das hier
Was ist das hier?
Ein Blog. Naja. Literatur. Nein. Ein Tagebuch, okay. Ein öffentliches Tagebuch. Mehr oder weniger. Eine Dokumentation.
Ja, das gefällt mir.
Eine dokumentarisch-archivarische Arbeit. Eine Langzeitdokumentation. Eine Subjektive auf die Objektive. Im Ausschnitt, im Anschnitt, im Fluss: Ein Leben. In einer Stadt in einem Land in einer Zeit.
Kürzlich sehe ich ein Plakat: Er litt, liebte und starb. Was hat er sich dabei gedacht? (Bazon Brock). Das wandel ich ab.
Sie litt, liebte und starb. Was sie sich dabei gedacht hat, steht hier.
Mai 2017 – Krähe und Ratte
Kürzlich gehe ich am Kreuzberger Ufer spazieren. Plötzlich rennt kurz vor meinen Füßen eine Ratte von links aus dem Gebüsch, rast, offensichtlich in Panik rechts über den Weg, dicht hinter ihr: Eine Krähe, die nach ihr hackt. Ja, sag mal, so weit sind wir schon? Hat die Ratte versucht, ihr was wegzufressen oder sind Ratten jetzt das neue Grundnahrungsmittel für Krähen? Die Verrohung der Tierwelt erreicht eine neue Dimension. Diese Stadt macht auch echt alle verrückt. Dabei mag ich Krähen so gern.
Oktober 2016 – Pornografie 1
Pornografie
not a fan.
Ich meine,
Pornografie ist ja sehr praktisch. Man sieht mal, was andere Leute so machen, und wie sie so aussehen. Man sieht, was man noch so machen könnte, und auch, was die Anforderungen an eine zeitgemäße Sexualität so sind. Dass das zwangsläufig zu einem Gefühl von Differenz führt, ist notwendig logisch. Ist man wie die anderen? Eher nicht. Oder auch: Man ist ja genau wie die anderen, ohje, boring. Oder auch: Ach, das wollen die anderen (Frauen), Schrägstrich „die Männer“? Wieso will ich das nicht? Müsste ich das nicht wollen?
Egal wie, unterm Strich ist Pornografie verstörend.
August 2016 – Leseprobe
Seit ich einen kindl hab, lese ich nur noch Leseproben. In der Regel reicht das. Ganz selten mal, wirklich selten, will ich wissen, wie es weitergeht und klicke auf den Kauf-Button. So weit ist es gekommen mit mir und der Literatur. Ich guck nur noch ihre Trailer. Früher hab ich sie geliebt. Jetzt hab ich keine Geduld mehr für sie, ich lasse sie nur in mein Bett, wenn ich mal wieder das Gefühl habe, ich gucke zu viel, so wie ich manchmal das Gefühl habe, ich esse zu viel Zucker oder trinke zu viel Kaffee. Sanft abstrahlende Literatur als bessere Einschlafhilfe. Zum Bescheid wissen und Mitquatschen reicht die Leseprobe allemal und ist sehr günstig, nämlich kostenlos. Optimal für Halb-Hartzis wie mich also. So browse ich mich durch, durch die Literatur, schau mal vorbei, im kindl, im Pop-up-Store der Literatur. Ich lese die ca. 20 Seiten irgendeines Buchs und dann weiß ich, worum es geht. Wie das hier so läuft. Aus welcher Ecke das so kommt.
Juni 2017 – Pornografie 2
Das einzige was ich vom Pornogucken gelernt habe, wo man ja ständig anderer Frauen Geschlechtsteile anschauen muss, als wäre man im Bio-Unterricht: Ich habe eine sehr hässliche Möse.
Danke dafür, Pornografie.
Als hätt ich nicht schon genug Probleme.
Juni 2017 – Neid
Kürzlich bekomme ich einen bösen Neidanfall.
Ich sage so dumme, missgünstige, misogyne Sachen über eine andere Frau, dass ich einen Schreck kriege, schon in dem Moment, in dem sie aus meinem Mund kommen.
T. erzählt mir beiläufig von einer Bekannten, die 10.000 Euro brutto im Monat verdient.
Da passierts.
Ich sehe das strahlende, weiße Lächeln dieser Bekannten vor mir und ihre schönen, vom Topfriseur gepflegten Haare und ihren übervollen Kleiderschrank und die Loftwohnung, die sie sich kauft, und ich sage: 10.000 im Monat?, klar, kann ich mir vorstellen, sie weiß, wie man Small Talk macht, sie kann bestimmt super mit Kunden umgehen, Sie sieht gut aus.
– Du liebe Zeit, ich könnte sie auch gleich als Prostituierte bezeichnen!
Dass sie – im Gegensatz zu mir – drei Sprachen fließend spricht, hervorragende internationale Referenzen hat, bis spät in die Nacht arbeitet, und ganz sicher in ihrem gesamten Arbeitsleben sehr viele schwierige, stressige und unangenehme Situationen durchgehalten und dabei immer kompetent ihre Arbeit getan hat – das fällt mir in dem Moment nicht ein.
Ich denke in diesem Moment nur: Warum verdient die 10.000 im Monat und ich 20.000 in einem (guten) Jahr. Hab ich mich nicht auch durchgekämpft? Hab ich mich nicht aus der Realschule über den Zweiten Bildungsweg ins Abitur gehievt, hab ich nicht ein kompliziertes, geisteswissenschaftliches Studium mit Eins abgeschlossen? Versuche ich nicht seit Jahren redlich, mich in einer schwierigen Branche durchzusetzen oder zumindest zu halten, stehe ich nicht andauernd frustrierende Arbeitssituationen durch, überwinde ich nicht ständig tausend Ängste? Bin ich nicht auch irgendwie ganz gut in meinem Job? Warum also hat sie ein entspanntes Leben und ich jeden Tag Angst um meine Existenz?
Dass Geld auf dieser Welt nicht gerecht verteilt ist, weiß ich. Vielleicht konnte man sich das in den 70ern in Westdeutschland mal für ein paar Jahre einreden, dass es da eine objektiv nachvollziehbare Logik gibt, dass wer fleißiger ist oder einen verantwortungsvolleren Job hat oder eine längere Ausbildung gemeistert hat, auch mehr Geld verdient, im Sinne von verdient. Aber im großen und ganzen war das ja global betrachtet schon immer Quatsch. Wieso die Arbeits- sprich Lebenszeit des einen Menschen mehr wert ist als die des anderen, dass die eine Branche diese Tarife hat und die andere jene (die Bekannte arbeitet bei einer großen Agentur als Projektleiterin), dass die einen Skills besser bezahlt werden als die anderen, das hat mit Mechanismen zu tun, die weit außerhalb von Gerechtigkeitsfragen liegen.
Dass verdienen und verdienen in direkter Korrelation zueinander stehen, ist eine übers System drüber gelagerte Vorstellung, die sich notwendig hält, um es am Laufen zu halten. Wie sollte man das alles sonst legitimieren? Wie sollte man sich sonst sicher sein, dass alles mit rechten Dingen zugeht? Und weil ich hier nun mal dazugehöre, kann auch ich nicht anders als zu denken, dass GELD etwas mit Anerkennung zu tun hat, und KEIN GELD eine Folge von Dummheit, Schuld und Versagen. Kurzum: Ich nehms persönlich. Und werde persönlich. Ich folge einem sehr tief liegenden, sehr alten, sehr verkrusteten, und sehr verbreiteten Reiz-Reaktions-Schema, und mache die Frau als Frau nieder. Ich tue das, was über Jahrhunderte getan wurde und noch immer jeden Tag getan wird: Ich nehme an, ich unterstelle, dass diese Bekannte nicht aufgrund ihrer Ausbildung, ihrer Klugheit, ihrer Fähigkeiten, ihrer Verhandlungsstärke, ihres Selbstbewusstseins den Job bekommen hat und nun gutes Geld verdient, sondern weil sie gut aussieht und nett mit den Kunden (!) Small Talk macht. Über einen Mann hätte ich das nie gesagt.
Dabei sind Frauen für mich doch eine schützenswerte Spezies! Ich will keine Frau sein, die über andere Frauen herzieht, ihnen das Leben schwer macht. Ich will mich freuen, wenn Frauen Erfolg haben, will sie unterstützen, ihnen applaudieren, stolz auf sie sein, mich mit ihnen verbunden fühlen, mir Mut holen bei ihnen, sie mir zum Vorbild nehmen, sie ein bisschen beneiden, okay, aber auf generöse, sportliche Art. Meistens klappt das auch. Aber in diesem Moment, da klappt es nicht. Irgendwo in den Untiefen meines Inneren fliegt ein Deckel weg. Die Sicherung brennt durch.
Ich weiß, aus mir spricht der Frust. Ich weiß, ich bin traurig, müde und abgekämpft. Enttäuscht von mir. Und der Welt. Aber so? Will ich nicht sein. Ich will nicht verbittert und böse sein, werden, enden.
Ich habe Entscheidungen getroffen, die Konsequenzen haben, und diese Konsequenzen haben mich nicht von den Entscheidungen abgehalten. Aber ich habe sicher auch gehofft, dass die Konsequenzen schon nicht so schlimm sein werden.
Wie nur, wie soll ich meinen Frieden machen?
Mai 2017 – Ameise
Ich sitze im grünen Gras und lese ein Buch.
Ich lege das Buch mit dem geöffneten Buchrücken nach oben vor mich hin, und guck mal ein bisschen auf den See.
Eine Ameise krabbelt auf den Buchrücken. In dieser typischen Ameisenart, hastig, zittrig tastend, getrieben, wie unter Strom, Sklavin ihrer Aufgabe. In ihrem Maul trägt sie eine andere Ameise, quer. Die andere Ameise sieht mitgenommen aus, um nicht zu sagen tot.
Okay, denke ich. Wo bringst du sie hin? Ins Ameisen-Krankenhaus? (Ich glaube nicht, dass da noch was zu machen ist, ehrlich gesagt.) Zur Ameisen-Beerdigung? Auf den Ameisen-Friedhof? Werden tote Ameisen in der Ameisenwelt irgendeinem Recycling zugeführt? Werden sie anderen zum Fraß vorgeworfen, der Königin oder den Babys? Werden sie als Düngemittel verwendet? Werden sie vor die Stadttore gebracht, weil sie an einer infektiösen Krankheit gestorben sind?
Die Ameise krabbelt mit der Quer-Ameise im Maul (sie sieht aus wie ein Gabelstapler mit Holzbalken, es muss sehr anstrengend sein, was sie da macht) über den leicht ansteigenden Buchrücken direkt auf mich zu. Als sie am Ende angekommen ist, legt sie die Ameise plötzlich vor mir ab. Blitzschnell biegt sie nach rechts ab, kratzt die Kurve, macht sich vom Acker, eilt davon, es sieht aus, als hätte sie schon vergessen, was sie gerade noch vorhatte.
Da liegt sie vor mir, die tote Freundin. Hat die Schleppameise eben jetzt erst realisiert, dass nichts mehr zu machen ist? Hat die Maulameise anders als von mir angenommen vielleicht doch noch gelebt und gerade erst ihren letzten Atemzug getan? Hat die Schleppameise von irgendeiner Chef-Ameise einen Zuruf erhalten, lass los, wir brauchen dich hier dringender? Hat die Schleppameise mir die Maulameise vor die Nase gelegt, damit ich mich kümmere, sie rette? (Sie ist tot, wirklich sehr tot.) Versucht die Schleppameise, einen Mord zu vertuschen und die Leiche auf einem Buchrücken verschwinden zu lassen? Oder hat die Schleppameise mir ein Opfer dargebracht, mir, der großen Göttin der Ameisen?
Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe nichts. Wir leben gemeinsam auf diesem Planeten, und sind einander Aliens.
Ich nehme das Buch hoch, die tote Ameise rutscht die Buchrinne runter und landet irgendwo im Gras.
Mai 2017 – Aufm Bahnhof Zoo im Damenklo
Ich muss mal. Wie die meisten Menschen gehe ich dafür zu McDonalds.
Vor dem Eingang steht ne Frau neben nem Tisch, so tellermäßig, kennste, ich geh an ihr vorbei, 2 Meter, bis zur eigentlichen Tür. Vor der Tür stehen verdruckt zwei Mädchen, so 14, schätze ich, bisschen pummelig, noch Babyspeck, eher kurze Haare, sehen wenig nach Stadt aus, eher nach Provinz. Ich sage, was ist los, die: Da brauch man n Code. Ich drehe um, gehe zu der Frau. Können Sie mir die Tür aufmachen. Sie guckt genervt, wieso, hätte ich einen Cheeseburger kaufen müssen, aber sie hat doch ihren Teller für danach, egal, sie kommt, tippt den Code. Ein bisschen so, von der Körperhaltung her, dass die Mädchen es nicht sehen. Ich geh rein, die Mädchen schnell hinterher. Sie gehen in die Kabine direkt neben mir (warum ausgerechnet, denke ich hinterher, die waren doch alle frei, aber so sicher haben sie sich gefühlt). Ich mach die Hose auf, da geht nebenan die Unterhaltung los. Du zuerst diesmal. Man, mach – nee, nich so. oaah, du Memme, nein, tiefer, jetzt. Merkst du was. Uuuhf. – Mir wird klar, die setzen sich da drüben einen Schuss! Ja, sag mal, denk ich, gehts noch? Die sind vierzehn! haben die zu viel Wir Kinder vom Bahnhof Zoo gelesen? Oder zu wenig? Was soll das? Zwei pummelige Klebe-Freundinnen aus der Kleinstadt, die aussehen als könnten sie auch mit der AWO-Freizeit hier sein, spielen hier ganz harte Drogen mit sich selber in den Arm stechen und allem drum und dran? Soll ich was sagen?
Inzwischen haben auch andere Leute den Code geknackt, ich verlasse die Kabine, wasch mir die Hände und gehe. Ich verstehe jetzt, was der Frau an den Mädchen nicht recht war. Sicher kennt sie sie oder hat einen professionellen Blick dafür.
Warum hab ich nichts gesagt? Wa-rum hab ich nichts gesagt? Hätte ich nicht was sagen müssen? Hätte ichs ihnen nicht ein bisschen schwer machen müssen, wenigstens: Ey, könnt ihr das woanders machen oder besser gar nicht, wie alt seid ihr, geht mal heim und lasst den Scheiß. Das ist nicht cool, was ihr hier macht. Hätte ich nicht gegen die Tür wummern müssen und sagen: ich hol die Frau, damit sie euch raus schmeißt, oder die Polizei, wenn ihr nicht aufhört? Was würden ihre Mamas sagen oder ihre Papas, wenn sie wüssten, dass ich nichts gesagt habe. Würde ich mir das nicht wünschen, wenn ich so eine Tochter hätte, dass irgendjemand, bitte, einfach nur irgendjemand wenigstens mal was sagt? Würd ich nicht weinen, angesichts der Tatsache, dass keiner was sagt?
Wie oft. Laufe ich an sowas vorbei, tagtäglich, ohne mich das auch nur ansatzweise zu fragen, und jetzt plötzlich fällts mir auf, nur weils junge Mädchen sind, die nich so aussehen. Bei denen die eh schon so aussehen ists okay?
Is doch scheiße alles.
Mai 2017 – Realpolitik
Bei einer Veranstaltung der Linken wird mir endlich mal wieder klar, wie Politik funktioniert, was genau ihre Aufgabe ist. Das hatte ich total vergessen, weil ich mich so lange nicht damit beschäftigt habe, aber jetzt sitze ich hier, bei einer Podiumsdiskussion zum Thema Smart City und es fällt mir wieder ein, auf. Die Aufgabe der Politik ist es, real zu sein. Das heißt, dafür zu sorgen, dass sich nichts ändert, solange es irgendwie einigermaßen unauffällig läuft. Es ist nicht die Aufgabe der Politik, Konzepte und Ideen zu haben oder wenigstens aufzugreifen, die sich für das Große und Ganze oder das Kleine und Unscheinbare oder das Neue und Perspektivische interessieren , es ist ihre Aufgabe, solche Ideen und Konzepte aktiv zu verhindern und denen, die die Ideen haben, zu erklären, dass das was sie sich da vorstellen, total interessant ist, und auch genau das, wofür die Partei steht, aber leider nicht geht. Einfach nicht geht, nicht zu machen ist. Oder wie wollen Sie das finanzieren? Oder wie wollen Sie dafür eine Mehrheit kriegen? (Helmut Schmidt: Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen.) Die Aufgabe der Politik ist die Politik. Lasst alle Hoffnung fahren, Leute, solltet ihr sie je gehabt haben. Die haben einen geregelten Job, und den wollen sie so lange behalten wie geht. Dieser Job unterscheidet sich nicht vom Job eines Sachbearbeiters beim Ordnungsamt. Politik erhebt Gebühren. Auch mal gegen die Interessen der Wirtschaft! Politiker sind nur kleine Rädchen im großen Ideenverhinderungsgetriebe Politik, und die schlimmsten sind die, die einem das auch noch mit traurigem Hundeblick mitteilen. „Der Gestaltungsspielraum ist da doch eher klein“. „Wenn wir mehr Stimmen hätten vielleicht“. Ansonsten bringen sie ihre Kinder in die Kita. In die Politik geht man wegen der Vita, der Festanstellung, der Karriere oder der Rente, nicht weil man was bewegen will. Wer was bewegen will oder was interessant findet oder eine gute Idee hat, der wendet sich schnell und mit Grauen ab von der Politik. Aber weil Politiker wie Redakteure sind, müssen die, die was bewegen wollen, dann wieder bei den Politikern vorkriechen.
Dabei: Smart City, mann, ich meine das ist doch ein Thema! Diese Stadt hat doch genug Probleme, Verkehr! Wohnen! Aber die Politik sagt ja nicht: Keine Autos innerhalb des S-Bahn-Rings in den nächsten fünf Jahren. Oder: Elektro-Roller? Super Idee, schaffen wir als Kommune an – in Kooperation mit der Wirtschaft von mir aus. Oder: Liebe Architektinnen dieser Stadt, hier ist Geld, baut interessante, leistbare Wohnungen, wir wissen, ihr brennt darauf. Oder: Ökologische Dämmung und sanierte Bäder für alle Mieter, und zwar ohne dass die wegen etwas so Sinnvollem auf die Barrikaden gehen müssen, weil es am Ende nur bedeutet, dass sie sich die Miete nicht mehr leisten können. Nein, die Politik sagt: Ach, all diese verrückten, kreativen Ideen, das ist ja so Berlin! Und dann geht sie in die Kantine und hält den Stimmzettel hoch, wenn es wieder heißt: ja zur A100, damit man wenigstens regierungsbeteiligt wird. Oder verkauft die GSW.
Im Publikum übrigens: 33 Anwesende, davon 7 Frauen. Ein Mann redet über das Problem der Terminvergabe beim Bürgeramt (tatsächlich eine typische Berliner Sauerei, nicht mal die Politik kriegt sie hin, die Politik), einer über die stiefmütterliche Behandlung der Fragen der Landwirtschaft und die Problematik der Generation Smartphone (Zombies, die sich nichts mehr zu sagen haben), eine Frau von der Gewerkschaft verteidigt VW und hasst Google (??), ein paar von den Jungen, Antifa-mäßigen OSI-Studenten, die Die Linke ja auch im Repertoire ihrer Wähler hat, versuchen’s hoffnungsvoll mit dem eigentlichen Thema, sind aber schnell frustriert, weil es kein Echo gibt.
Mein Fazit: Never again! Und ob ich nochmal wählen gehe…
Mai 2017 – Hate Crime
Ich fahre mit der Tram die Greifswalderstraße entlang. Auf der rechten Straßenseite sehe ich ein Auto, einen kleinen, dunkelblauen Golf, er steht gegen die Fahrtrichtung seltsam schräg zwischen den parkenden Autos, halb auf dem Gehweg. Jemand hat ihn übel zugerichtet. Eine Scheibe ist eingeschlagen, das vordere Rad ist abgeschraubt, er hat überall tiefe Dellen, als hätte ihn jemand mit dem Baseballschläger bearbeitet. In breiter rosa Schrift hat jemand aufs Autodach, auf die Rückfront und auf die Seite das Wort HURE gesprüht. Es sieht aus wie bei einem Filmdreh, ist aber kein Film. Ist echt. Es ist nur ein Augen-Blick aus der Tram heraus, aber es reicht, um wahrzunehmen, wie gewalttätig, brutal, verächtlich und frauenfeindlich das ist.
Den ganzen Tag beschäftigt mich die Frage, warum jemand für so etwas rosa Schrift benutzt.
Mai 2017 – Schmerzen 2 – Haltungsfrage
„Ich glaube, ich werde die Schmerzen nie mehr los“, sage ich.
„So würde ich da nicht rangehen“, sagt meine THERAPEUTIN. „Da schließen Sie ja schon von vorneherein aus, dass sie nochmal schmerzfrei werden.“
„Sag doch besser: Ich werde immer Schmerzen haben“, sagt meine PHYSIOTHERAPEUTIN, „das ist gleich was anderes.“
Mai 2017 – Schmerzen 1 – Aussichten
Heute kein guter Tag.
Ich träne heimlich beim Sport. Jede Bewegung ist mühsam, ich bin verkrampft, hab Angst, dass wieder irgendwas kracht. Ich glaube nicht, dass ich jemals ohne Schmerzen sein werde. Ich glaube, dass die Schmerzen einfach immer nur schlimmer werden, dass sie mehr werden, sich auf andere Orte, Elemente, Bereiche ausweiten, sich festfressen werden. Man kann sie ignorieren oder was gegen sie tun, oder was für sie, aber los wird man sie nicht mehr. Das sind die Aussichten.
Und das obwohl die Sonne scheint.
Mai 2017 – Bella Matrix
Ich bestelle Blumen bei einer Floristik-Kette, für eine Hochzeit. Die Verkäuferin, Anfang vierzig, ist sehr nett, gibt sich Mühe, hängt sich richtig rein. Ihre Zähne sind ein bisschen schlecht, sie hat oben so einen Zahnersatz mit Bügel, der nicht richtig sitzt. Deshalb muss sie immer die viele Spucke wegschlucken, die sich bildet. Ich mag sie. Bestimmt hat sie einen Mann und zwei Kinder und eine Mutter, die nicht immer nett zu ihr ist. Früher war sie mal mit einem anderen verheiratet, der hat getrunken und sie gehauen. Aber sie ist fröhlich, weil sie gerne was organisiert, und ich höre, wie sie einer Freundin am Telefon erzählt, dass da heute eine nette Frau (ich, ich bin das) im Laden war, die was für eine Hochzeit bestellt hat: Kleine rosa Rosen wollte die haben, 100 Stück. Ich hab ihr welche empfohlen, sagt sie zur Freundin, stolz: „Ein Arm voll Bella“. So heißen die, helles Rosa, geöffnet, eher kurz. Sie sagt, dass ihr Job ihr Spaß macht, vor allem, wenn sowas ist. Dann macht es ihr auch nichts, dass sie den ganzen Tag bei künstlichem Licht im Untergeschoss einer Shopping Mall im Schichtdienst arbeitet und sehr wenig Geld verdient.
„Ich muss mal in der Matrix gucken“, sagt sie, „ob wir die haben“. Dafür liebe ich sie. Dass sie Blumen in der Matrix hat. Dass die da drin sind, die Blumen. Sie mag das auch, sie sagt es oft und gerne, während sie im Einfinger-System in die uralt Tastatur tippt. „Wenn die diesen Freitag in der Matrix sind, dann kann ich sie bestellen. Für nächsten Mittwoch. Aber manchmal sind die dann plötzlich nicht in der Matrix, es kommt eben immer drauf an – dann sind andere in der Matrix, aber genau die eben nicht. Darauf hat man keinen Einfluss. Aber eigentlich sollten sie drin sein. Vielleicht rufen sie am Freitag an, oder gegen mir ihre Nummer? Dann kann ich am Freitag gucken, ob wir sie in der Matrix haben und sie bestellen.“ Ich zögere kurz, beschließe dann aber aufs Ganze zu gehen und bis Freitag zu warten. Am Freitag ruf ich an und sie sind nicht in der Matrix. Obwohl sie die ganzen letzten Wochen jeden Tag in der Matrix waren, sind sie nun ausgerechnet heute nicht drin. Wir sind traurig. Aber es gibt noch eine Möglichkeit, nämlich, dass sie am Dienstag wieder drin sind. Dann könnte sie sie aus der Matrix raus bestellen und sie wären am Mittwoch da. Das ist zwar High Risk, rein zeitlich, aber ich rufe am Dienstag wieder an. Sie sind zwar nicht in der Matrix, aber sie hat die Frau erreicht, und direkt bei ihr bestellt. 100 Stück, ein Arm voll Bella. Wir sind glücklich.
April 2017 – worship the dick
In „Transparent“ haben Sarah, die älteste Schwester der Pfefferman-Kinder, und ihr Ex-Ehemann Len beschlossen, wieder zusammen zu leben und gemeinsam ihre Kinder zu erziehen. Sie verstehen sich noch gut, haben aber nichts mehr miteinander. Neben jemandem wie Sarah, die wie alle Pfeffermans ruhe- und und skrupellos auf der Suche nach sich selbst ist, einer Suche, die in Transparent immer und vor allem eine nach der „richtigen“, befriedigenden Sexualität bzw. sexuellen Identität ist, kann ein netter Mann wie Len schon mal auf der Strecke bleiben.
Len hat seit einiger Zeit eine Beziehung mit einer jüngeren Frau, die im Fitness-Studio Spinning-Kurse gibt. In einer Szene bläst sie ihm einen. Er liegt auf dem Sofa, so halbwegs auf dem Rücken, sieht ihr zu, wie sie seinen Schwanz im Mund hat. Ja, sagt er, worship the dick.
Das ist ein toller Moment. Sein ganzer Frust, seine ganze Sehnsucht stecken da drin, und die ganze Tragik des modernen, heterosexuellen Mannes, der damit leben muss, dass den dick worshippen eine Spielart des Sexuellen neben vielen anderen geworden ist, beziehungsweise nur noch als solche funktioniert. Da kann die Beziehung zu einer netten, jungen, hard-body Spinning instructor was ausgleichen, ein Balsam für die geschundene Seele dieses liebenswerten Mannes sein, der seine komplizierte Frau noch immer liebt, die er mit dem dick, den er zu bieten, oder den Gefühlen, die er für sie hat, einfach nicht befriedigen kann. Sie ist längst: on a cruise. Den dick worshippen bedeutet nicht mehr, dass Männlichkeit klar ist, eindeutig oder gar Sinn stiftend und Welt bestimmend. Aber für einen Moment ist es eine Erlösung, eine Herrlichkeit.
April 2017 – Samstag
Folgender handschriftlicher Eintrag in meinem Kalender:
T.: einkaufen Karstadt. Gestritten, geweint. (Sex) Kuchen
Ja, ja, denke ich, so ist das Leben.
April 2017 – PMS
PMS ist das Schlimmste. Man befindet sich in einem hormonüberfluteten Körper, dessen Stimmungen man ausgeliefert ist und man kann froh sein, wenn einem noch rechtzeitig einfällt, dass man bald seine Tage bekommt, sonst wäre man kurz davor, sich einliefern zu lassen. Eine Heulerei, nur weil im Fernsehen jemand die Tür aufmacht und den lange verlorenen Sohn in den Arm nimmt. Auf nichts spricht man in dieser Zeit so sehr an, wie auf auf Rührung gebaute Momente. Und dann diese Gereiztheit. Jemand der sich vordrängelt, jemand, der kein Gefühl für sozialen Abstand hat, jemand, der stinkt, der laut ist, der nur über sich redet. Jemand, der dir dumm kommt, ein Gesicht zieht, obwohl du freundlich zu ihm bist. So jemand – lebt gefährlich. Zumindest im Nachhinein. PMS ist die Zeit der wütenden Selbstgespräche, der funkensprühenden inneren Dialoge mit soeben getroffenen unbekannten Sozialverbrechern. Da wird sich überhitzt aufgeregt bis die Nervennadel 280 zeigt, nur um im nächsten Moment wieder im See des Weltschmerz unterzugehen. PMS gibt es. PMS ist scheiße. Man kann froh sein, wenn einem noch früh genug einfällt, dass es am PMS liegt, wenn man jemanden angefahren oder umgebracht, jemand auf offener Straße angespuckt oder ein Bein gestellt hat. Nein, Herr Richter, ich wollte es nicht. Ich hatte PMS. Achso, Freispruch. Warum haben sie das nicht gleich gesagt. Freispruch und lassen Sie mich das ganz persönlich sagen: Mein Beileid.
PMS, prämenstruelles Syndrom ist übrigens nicht zu verwechseln mit PMS, postmenstruellem Syndrom. Da hat man die gleichen Symptome, aber es ist normal.
März 2017 – Käse 2
Am S-Bahnhof Alexanderplatz gehe ich in einen dieser Convenient-Stores um eine Butterbrezel zu kaufen. Ein Typ, eher so Friedrichshain, steht neben mir, spricht die Verkäuferin an (die Verkäuferinnen hier allesamt gefühlt eher so Flüchtlinge, die glücklich sind, für 3 Euro Stundenlohn Arbeit zu haben, wahrscheinlich hat ihr Chef Förderung für ihre Einstellung bekommen, ohne dass sie es wissen), und sagt, auf Krawall gebürstet: Der Käse ist hier ja teurer als die Wurst!
Die Verkäuferin versteht nicht, erläutert hilfsbereit die Preise: Das Käsebrötchen kostet 2 Euro 80, das Wurstbrötchen 2 Euro 10. Genau! sagt der Typ aufgeputscht, der Käse ist teurer als die Wurst, Vegetarier werden hier voll diskriminiert! Um seiner Empörung noch mehr Verve zu verleihen, dreht er sich auf dem Absatz um und rauscht, leicht zitternd, weil er so mutig politisch den Mund aufgemacht hat, ab.
Das ist also das Problem. Vegetarier werden diskriminiert. Der Skandal ist nicht, dass das industriell erzeugte, mehr oder weniger qualvoll getötete und zu appetitlichen Scheiben verarbeitete LEBEWESEN auf dem Brötchen liegt und GÜNSTIGER ist als der Käse, ein von diesem Lebewesen erzeugtes, industriell gewonnenes Produkt, das von Menschenhand und Menschenkenntnis in komplexen Prozessen bearbeitet wurde.
Dass hier, in dieser Convenient-Store-Vitrine der Kapitalismus in seiner ganzen perversen Logik sich aufführt wie auf einer Theaterbühne, zu der alle und alles Anwesende dazugehören, das ist nicht der Skandal. Nein. Der Skandal ist: Vegetarier werden diskriminiert! ER wird diskriminiert. Er als Individuum in seiner freien Entscheidung für einen Lebensstil wird benachteiligt.
Go fuck yourself, Vegetarier! Geh heim und denk nochmal nach.
März 2017 – Käse 1
Ich kaufe ein. Lebensmittel. Bei der Bio Company.
(Kein Fan dieses Ladens. Bis heute widert mich der Geruch von Bioläden an. Konnte ich schon in den Achtzigern nichts abgewinnen, diesem Geruch. Damals, als die ersten zugestopften Bioläden aus dem Boden sprossen, ich war dabei. Eng und vollgestopft waren sie, braune Holzregale bei denen man die Astlöcher sehen konnte. Die Schönheit der Natur. Und draufgestapelt auf den Regalen Vollkornmehl-Tüten im sanften Waldorf-Design. Nicht mal die Supermarktisierung des Bioladens, der Bio-Discounter hats geschafft, diesen Geruch loszuwerden. Und aus mir einen Fan zu machen. Oder wollte es gar nicht, hat womöglich den Geruch noch extra reingepumpt, weils zum Marketing dazu gehört und alle außer mir den Geruch ganz toll finden: Gesund und gut. „Natürlich“. Natürlich nervt, kommt immer daher, als wärs natürlich, dabei ist es nur ein Konzept. Was riecht da so, frage ich euch, was?! Dinkel? Vollkorn? – Der Geruch geht auf wie die Schiebetür, durch die man den Laden betritt, umfängt einen ganzheitlich, und ist weg, sobald sie sich wieder hinter einem schließt. Und wenn ich ne Augenbinde aufhätte, ich wüsste, dass ich im Bioladen bin!)
Es ist so halb 6. Alle anderen kaufen auch ein. Ich will nur ein paar schnelle Sachen, ungeplant, impulsiv, kalte Küche. Zum Beispiel Käse. Ich will Käse! Gehe zur Vitrine, wo die Stücke alle griffbereit in Cellophan verpackt rumliegen (wer verpackt eigentlich wann diese Käsestücke, geschieht das in Nachtarbeit?) Ich nehme ein Stück in die Hand, drehe es um, und schaue auf den Preis (die liegen alle so, dass man sie umdrehen muss, um den Preis zu sehen). Ich nehme jedes, ich schwöre, jedes verdammte Stück Käse in die Hand, und drehe es um, ich arbeite mich von den Höhen des Edelschimmel-Bergkäses aus Rohmilch mit Heuwiesenrand hinunter ins weißliche Honigziegenkäsetal bis zu den Niederungen des jungen Goudas, also des gemeinen KINDERKÄSES, und finde nichts, nichts! unter 4 Euro 20. Das ist, mit Verlaub, ein Arschvoll Geld. Für Stücke, die in meine Handfläche passen, und ich habe NICHT die Handflächen eines Gorillas.
Ich nehme einen mittleren Käse mittlerer Preisklasse, staple ihn zu den anderen losen Sachen auf meinen Arm: eine Packung Tee, eine Tafel dunkle Schokolade, eine Zucchini, eine Packung Bierschinken. Als ich zur Kasse gehe, und die Schlange wie immer sehr lang ist und voller Menschen, die hier vor allem eins einkaufen, nämlich Distinktionsgewinn, und der Typ hinter der Kasse wie immer sehr langsam ist, und es wie immer für sehr unnötig hält, eine zweite Kasse aufzumachen, da hier im Bioladen gilt: Bloß kein Stress für Mensch und Tier, außer für den Menschen, der stundenlang ansteht, da hole ich meinen Geldbeutel und mein Handy aus meiner Schultertasche und, was soll ich sagen, das Stück Käse wandert dabei in die Tasche und kommt da auch nicht mehr raus.
Vor der Schiebetür (Geruch erfrischend asphaltig abgasig hier draußen, ich atme auf) steht eine Motzverkäuferin und für einen Robin Hoodschen Moment gefällt mir die Vorstellung, ihr den Käse zu schenken. Aber jetzt, nach Jagd, Beute und Triumph, siegt meine Überheblichkeit, und ich denke: Ich hab meinen eigenen Überlebenskampf, baby.
Als ich zuhause den Käse esse, schmeckt er
SAU! GUT!
März 2017 – von wegen Nordpol
Zähne im Mund. Machen mir, machen uns einen Strich durch die Rechnung. Wurzeln müssen behandelt, Schmerzen mit Antibiotikum ausgemerzt, Stornierungen getätigt, Enttäuschung verkraftet werden.
B. sagt: Wer weiß, wozu’s gut ist.
Im September, im September soll der Nordpol noch schöner sein. Hauptsache, die Zitrone steht noch.
März 2017 – Nordpol

Reiseroute nach Japan. Aufgemalt auf Planet Zitrone von T. (Kleiner Hinweis zum besseren Verständnis: Wir fliegen mit FinnAir).
März 2017 – Bettina
Im Secondhandladen finde ich eine Tasche.
Es ist eine Handtasche. Der Schultergürtel schmal und lang, das Leder in einem hellen, warmen Braunton. Eher groß. Für eine Handtasche. Vorne auf der Klappe, die die halbrunde Form bedeckt, ein paar stilisierte Blüten aus abgesetztem Leder und ein paar weiße Perlen. 80er. Ganz klar.
Ich gucke rein in die Tasche und finde in der vorderen Innentasche: Eine Nadelhaarspange in Neongrün, das Metall zur Verzierung leicht gedreht, in der hinteren Innentasche: Einen Fahrradschlüssel für eine Sorte Fahrradschloss, die es heute nicht mehr gibt, weil zu lächerlich, sowie eine in eins dieser praktischen Plastikquadrate verpackte Slip-Einlage Größe L. Das Innenfutter der Tasche ist mit einem musterartig wiederkehrenden Wort – offenbar die Marke – bedruckt: Bettina Bettina Bettina.
Mein Herz fliegt der Tasche, fliegt dem Mädchen zu, dem sie gehört hat.
Ihre Mutter hat sie ihr geschenkt. Eine ordentliche Tasche. Aus Leder. Vielleicht haben sie sie zusammen ausgesucht. Guck mal, die ist doch toll. Vielleicht haben sie reingeguckt und gelacht: Und dann heißt sie auch noch wie du! Auch die Verkäuferin hat sich gefreut. Dass sie Mutter und Tochter gut bedient, einer schönen Situation beigewohnt hat. Heute war eine Mutter mit ihrer Tochter im Laden. Die junge Frau hatte Geburtstag.
Bettina hat sich gefreut über die Tasche. Sie hat Komplimente bekommen dafür, von ihren Freundinnen. Die ist ja stark, haben sie gesagt, denn es waren ja die 80er. Bettina hat die Tasche gern benutzt. Man konnte sie quer über dem Oberkörper tragen, dann war sie praktisch, oder nur über einer Schulter, dann war sie schick. Man konnte sie zu Jeans und adidas-Turnschuhen anziehen, und damit auf dem Fahrrad zu den Pferden rausfahren. Oder zum lila Hosenanzug mit Gürtel und Stiefelchen, dann konnte man damit ausgehen, in die Disco. Mit der Tasche ging alles.
Ich weiß viel über Bettina. Sie war groß. (Nur großen Mädchen stehen große Handtaschen. Länge des Schultergurts. Slip-Einlage Größe L). Und blond. (Farbe von Tasche- und Haarspange). Sie war ein fröhliches Mädchen, kein dunkles. (Blumen und Perlen). Sie kam aus gutem Elternhaus. (Leder. Anstand.). Manchmal hat sie ihre langen Haare mit der Spange zur Seite gesteckt, und bevor sie zum ersten Mal Sex mit ihrem Freund Rainer hatte, ist sie mit ihrer Mutter zum Frauenarzt. Der Rainer hat ihr damals auch das Fahrradschloss aufgesägt, als der Schlüssel einfach nicht mehr aufzufinden war. Entspanntes Verhältnis zum Frausein. Zu Bewegung. Zu Geld.
Eines Tages, Bettina hatte längst einen Beruf, vielleicht als Logopädin oder Ärztin, ein Kind, und einen Mann, und war schon lange nicht mehr bei den Pferden, da hat sie die Tasche in den Kleidercontainer gegeben. Ganz schnell ist die Entscheidung gefallen, denn wenn Bettina sich mal entschieden hat, dann geht alles ganz rasch. So, die kann jetzt auch mal weg, hat sie gedacht, und das Ding weggepackt, ohne nochmal genau reinzuschauen. Zusammen mit anderen alten Sachen hat sie sie in eine Tüte gepackt und ist auf dem Weg zum Einkaufen mit dem Auto beim Altkleidercontainer vorbei gefahren, das Kind auf dem Rücksitz. Alles noch gute Sachen, gepflegt und in Schuss, sauber, wie ihre von Slip-Einlagen geschützten Unterhosen. Aber irgendwann muss man sich auch mal trennen.
Und jetzt ist sie hier, die Tasche. Im Secondhandladen. Bei mir. Die Tasche steht mir überhaupt nicht. Passt einfach nicht zu mir. Ist klar, oder.
Ich kauf sie.
Februar 2017 – Geist
Ich bin ein Geist.
Es ist nicht sicher, ob ich da bin. Da gewesen sein werde.
Ich werde gesehen oder gefühlt, das ist anzunehmen. Alles spricht dafür. Es scheint logisch. Denn ich mache ja den Mund auf, rede, berühre jemanden. Manchmal bekomme ich Antwort. Das ist alles zu beobachten. Ich bin mir ein Rätsel, das sich nicht lösen lässt, im Angesicht der anderen. Ich schwitze nicht in meinem Angesicht. Nicht mal in der Sauna.
Mein Körper ist nicht die Lösung. Er ist mein Feind. Er schmerzt. Die Angst ist mein Feind. Sie verwirrt mich. Wie ein alkoholisches Getränk, ein Wein-Geist. Benebelt meine Sinne, bestimmt mich, fordert ihr Recht ein, versucht, mich auf ihre Seite zu kriegen, mich zu überreden, macht mir Gedanken, Sorgen, argumentiert, und hat nur immer ein Bedürfnis, das Seltsamste von allen: Zu verschwinden. Sich aufzulösen. Nicht-Angst zu sein. Ist es die Angst, die flüstert oder ein gutes Argument. Auf welcher Grundlage treffe ich meine Entscheidungen. Ich stehe auf keiner Grundlage.
Februar 2017 – Schande
Ich fahre mit dem Fahrstuhl von der Haltestelle U Schillingstraße hoch auf die Straße. Im Aufzug mit mir ein älteres Paar, im typisch mausbeigegrauen Renter-Outfit, (das die alle offensichtlich in irgendeinem geheimen Rentnerladen kaufen, von dem niemand außer ihnen weiß. Die Info, wo der sich befindet, kriegt man erst mit 65. 67. Vom Staat. An alle, jetzt: Bitte lasst uns woanders shoppen gehen, wenn es soweit ist!) Die beiden halten sich schon schwer aneinander fest, um nicht umzufallen, so gebrechlich sind sie. Als wir hochfahren – der Aufzug ist aus Glas und fährt sehr langsam, offensichtlich konzipiert für all die aufzugfahrenden Problemfälle wie Alte, Kranke und Kinderwagen – haben wir einen Panoramablick auf einen Obdachlosen, der sich mit Sack und Pack direkt neben dem Fahrstuhl auf der Straße niedergelassen hat und dort pennt.
Eine Schande ist das, sagt der Mann.
Vielleicht liegt es daran, dass ich als irgendwie links sozialisiertes Westkind ein nostalgisches Verhältnis zur antifaschistischen und antikapitalistischen Haltung der DDR habe, dass ich diesem Mann – den ich, weil er mit seiner Frau in einem Wohngebiet im Osten aus dem Aufzug steigt, für einen ehemaligen DDR-Bürger halte, vielleicht ist hier schon alles falsch – für einen Moment, trotz aller Stasi-Opa-Assoziationen, die ebenfalls hochpoppen, unterstelle, dass er etwas ANDERES meinen könnte, als all die verspießerten, ebenso mausbeigegrauen, allerdings wohlhabenden West-Gnaddel (schwäbisch für Nörgler), wenn sie diesen Klischee gewordenen Satz aus den 70ern/80ern von sich geben. „Eine Schande ist das“. So viel Bitterkeit, so viel Verachtung in diesem Satz. Doch für was? Könnte es sein, dass dieser alte Mann meint, dass es eine Schande ist, dass es sowas (bei uns) gibt? Dass Menschen auf der Straße neben Aufzügen leben, keine Wohnung, keine Arbeit haben. Dass sie arm sind. Dass das jetzt also die Welt ist, in der auch die Ossis seit dem Ende der DDR leben, die Welt vor der die DDR sie immer gewarnt hat? Oder meint er das Übliche, Erwartbare, nämlich dass der Obdachlose selbst eine Schande ist, weil er nicht arbeitet, rumhängt, dem Staat auf der Tasche liegt, und seine Mitmenschen mit seinem Geruch, seinem Anblick, seiner Anormalität belästigt wie jeder dahergelaufene PUNK?
Ich hab ihn nicht gefragt, den Mann. Eine Schande ist das.
Februar 2017 – Fundstück oder Olle Kamellen 2

Februar 2017 – Olle Kamellen 1
Beim Stöbern in alten Ordnern (digitalen), finde ich Texte von 2010 und 2012, die mich an die Einträge hier erinnern. Wackeleinträge also bevor es Wackel gab. Na, sowas. Anscheinend voll meine Form.
Da mir aktuell gerade sowieso nicht die Tastatur unter den Nägeln brennt, kommen sie hier, die ollen Kamellen:
Männer auf Messen
(toller Titel, aber offenbar bin ich nicht weit gekommen)
17.März 2012
„Barbara“ von Christian Petzold
Du liebe Zeit, hier ist ja alles unter Kontrolle. Jede verdammte Szene, ich krieg keine Luft mehr. Da gibt es Räume und in den Räumen stehen Menschen und dann sagt jemand was und dann ist Pause und dann sagt jemand anderes was. Und ich denke die ganze Zeit über ihre Handtasche nach, sowas kostet auf dem Mauerpark-Flohmarkt 50 Euro, aber so gut erhalten ist die dann noch lange nicht, wo kriegen die bloß immer diese Sachen her?
Ich kann sehen, dass es in der DDR entweder Leute gab, die weg wollten oder Leute, die sich kaufen ließen oder Leute, die richtige Böslinge waren wie der Stasi-Mann und die Hauswarts-Hexe. Am Ende opfert sich Barbara für das junge, schwangere Mädchen und verbleibt in der Regime-Hölle, um Leben zu retten, was für ein cheesy Fernsehspiel-Ende. Ich komme ohne Erkenntnisse und Fragen aus dem Kino. Wo ist die Abstraktion von Wolfsburg, Die innere Sicherheit, Gespenster, von mir aus auch Yella geblieben? Und warum ist das jetzt der beste, den Petzold je gemacht hat? Ist der schlechteste.
8. März 2012
Eine Frau, Typ „Lehrerin Mitte 50“ überreicht mir auf den Gleisen der U-Bahnhaltestelle Moritzplatz eine kleine rote Rose. „Heute ist Internationaler Frauentag“. Ich nehme die Rose entgegen und bedanke mich, und ich weiß nicht warum, aber ich muss schlucken. Weil mich die Solidarität übermannt oder sowas. das Gefühl, zu ihr zu gehören, etwas zu wissen, was sie auch weiß, über alle Grenzen hinweg. Ich versuche, die Frau zu scannen und zu verstehen, was sie dazu veranlasst, Rosen zu verteilen – ein Mädchen, gerade mal 20, bekommt als nächstes eine – als sie weitergeht, sehe ich, dass die Rosenverteilerin einen SPD-Flyer unterm Arm trägt. Wie gesagt, über alle Grenzen hinweg. Ich weiß, dass der 8. März Internationaler Frauentag ist, aber heute hab‘ ich’s vergessen, und ich bin dankbar, dass sie mich daran erinnert hat. In der Bahn schaue ich mir das 20jährige Mädchen an, das es auch dorthin verschlagen hat, wir beide stehen da, mit unseren Rosen und sie ist ’ne Frau und ich auch. Und die SPD-Frau Typ Lehrerin auch. Stell die Verbindung her.
Es gibt ein Foto von mir, wenn ich es in die Finger bekomme, schäme ich mich immer ein bisschen dafür, auf dem stehe ich mit lauter offensichtlich frauenbewegten Frauen hinter einem Transparent, auf einer Demo zum Internationalen Frauentag. Aber wieso schäm ich mich eigentlich dafür? (Vielleicht für die Offensichtlichkeit. Das Klischee, das ich abgebe. weniger für den Inhalt).
Ich gehe Zeitung lesen. In der Süddeutschen Zeitung steht kein einziger kleiner Artikel dazu. Die haben das vergessen, genau wie ich. Kein auch noch so kleiner Artikel zu Häuslicher Gewalt, Klitorisbeschneidungen, Ehrenmorden, ungleichen Löhnen, Vergewaltigung, Quotendebatte, Witwenmorden, Zwangsehen, Abtreibungen von Mädchen, Zwangsprostitution oder ähnlichem. Nichts, nada, nothing? Come on!
Ein Freund erzählte mir kürzlich, dass er mit seinen Anfang Zwanzigjährigen Studierenden Cindy Sherman besprochen hat. Als er von Feminismus sprach, hatte er das Gefühl, das ist für die ein sehr altes, sehr überholtes Konzept. Ich kann alles machen, was ich will, hat eine junge Frau zu ihm gesagt. Wenn die wüsste.
6.März 2012
“Young Adult” mit Charlize Theron
Young Adult ist eine Verteidigung der allein lebenden Frau, die sich für Beruf und Single-Apartment in der Großstadt entschieden hat und gegen eine Familie. So ein Leben ist hartes Brot. Man wird Alkoholikerin, Erfolg ist relativ und bleibt mäßig, man kratzt an Türen, fällt in Löcher, und ab und zu schiebt man morgens irgendeinen Männerarm weg, der sich um einen geschlungen hat, ohne etwas zu bedeuten. Aber hier geht es nicht um Glück, sondern um Abgrenzung! Das ist hier der Wert.
Sehr schön, wie sich der Film aus seiner selbst gebauten Kitschfalle heraus erzählt. Babys bekommen, noch dazu in der Provinz, das kann nicht die Lösung sein, schon gar nicht für alle und jede. Die Hauptfigur darf unsympathisch sein und wird nicht geläutert. Wir dürfen zugucken bei den Mühen der Verwandlung, dabei, wie sie sich immer wieder aufs Neue ihrer verschlampten Jogginghosen entledigt, die 37 übertüncht und sich in ihren Lady Look wirft wie in eine alte, solide Uniform mit der sie in den geplanten Feldzug zur Eroberung ihrer alten High-School-Liebe zieht.
Noch schöner, dass die ehemalige High-School-Beauty hier nicht das ist, was wir sonst von ihr erzählt bekommen: Die unglückliche Ehefrau, die an der Seite ihres Mannes, dem ehemaligen Football-Star und Frauenschwarm der Schule, all ihren Glanz verloren und wegen der beiden Kinder ihre Figur eingebüßt hat. Hier hat die Beauty sich aufgemacht, ihr Scheißkaff zu verlassen und in der großen Stadt Karriere zu machen, verdammt nochmal.
1.Mai 2010
Neulich im Manolo. Neben mir am Tisch sitzt ein dicker Dick-Brillenträger mit zwei leckeren jungen Dingern. Sie beugen sich über einen Computer und sprechen engagiert über Produktdesign und Käufer und Präsentationen, die Mädels nicken und antworten verständig und interessiert, die eine mehr, die andere weniger. Grundsätzlich werden Signale gleichschwingender Kommunikation signalisiert, wie es zu Beginn eines großartigen gemeinsamen Projektes üblich ist. Der Dick-Brillenträger spreizt die Beine, damit er seine Dick-Eier besser baumeln lassen kann. Ich spitze die Ohren und erfahre, dass es um eine hochinteressante neue Produktlinie geht, die Karma-Konsum heißt. Mein Gott, denke ich, ist das brillant, Karma-Konsum. Ich habe sofort die angenehme grüne Farbe vor Augen und das intelligente Design und die aus der Region stammenden Produkte, die ich auch gerne hätte, weil ich sie ohne Gewissen konsumieren kann. Als Geschenk sollen jetzt massenweise sauteure Kissen an irgendwen verschickt werden. Die Mehr-Engagierte erzählt, dass sie sich auch immer Bettwäsche für 100 Euro kauft und ich denke, wow, Bettwäsche für 100 Euro, und der Dicke stellt die richtigen Fragen: Sehen die sich mehr als Hersteller, als Berater oder als Verkäufer, und es wird nochmal klar, warum er der Chef ist. Die Weniger-Engagierte wird so langsam immer schweigsamer und entwickelt einen sympathischen Frust, weil die andere sich so gut mit dem Dick-Brillenträger versteht und schönere Haare hat. Dann kommen die Mehr-Engagierte und der Dick-Brillenträger auf Hartz IV Empfänger zu sprechen. Die heizen, und reißen gleichzeitig die Fenster auf, und das Arbeitsamt muss dann 5000 Euro dafür zahlen. Die wollen nicht arbeiten, weil die kriegen Miete, Krankenkasse und 350 Euro und kommen so locker auf 1000 Euro im Monat. Ich rechne heimlich nach. Die Weniger-Engagierte verabschiedet sich dann mal so langsam, denn eins ist klar, nach der Besprechung ist das Wochenende futsch, denn heute ist Freitag und am Montag früh muss spätestens alles fertig sein. Aber später soll nochmal geskypet werden. Die Mehr-Engagierte und der Dicke bleiben übrig und gehen dann auch, weil die Mehr-Engagierte vorschlägt noch gemeinsam irgendwo hinzugehen und sich irgendwas anzuschauen. Sie zieht ihre Sonnenbrille auf.
18. August 2010: Heute hatten wir Besuch. (Anm.: Damals hab ich in einer WG gewohnt.)
Heute hatten wir schon wieder Besuch, aber diesmal von jemand anderem. Der Besuch heute war mal richtig interessant. Er erzählte von Orestie von Aischylos. Man muss an Seifenopern denken. Und die Chöre – die Chöre sind toll! Sie sind sich einig, uneinig, sie haben Macht und fühlen sich machtlos und im Grunde ist das alles sehr verständlich.
Allerdings ist es schon sehr seltsam, was da sonst so los ist, zum Beispiel Athene, sie war eine Vatergeburt! Hat man sowas schon gehört.
Ich nehme mir vor, mir auch einen Chor anzuschaffen. Das ist besser als ein Hund. So ein Chor ist immer dabei, verbalisiert die verschiedenen Aspekte in meinem Kopf, hält mich ständig auf Trab, nervt, weil er sich lauthals einmischt, blöde Kommentare macht, und einer ist dabei, der immer rumpupst, und einen komplett aus dem Konzept bringt, weil man gerade mitten in einer sozialen Situation ist, in der es darauf ankommt, wie man sich verhält. Ah, jetzt weiß ich wo ich das her hab, das hab ich so ähnlich mal bei Woody Allen gesehen.
Ausgehen interessiert mich nicht, mich interessiert eher das Wetter.
Januar 2017 – grey magic

Januar 2017 – Nacht, Tag
Es vergeht kaum eine NACHT, in der ich nicht davon träume.
Wiederaufführungen des Immergleichen, des Betrugs, der Kränkung, der Lüge, verpackt in immer neue Varianten. Die am Ende immer in eins münden: eine magenverkrümmende GLEICHGÜLTIGKEIT seitens T., ein achselzuckendes Unverständnis, aus dem heraus er sich abwendet. Anderen zuwendet. Geht.
Und dann gibt es den TAG. An dem alles anders ist. An dem wir uns begegnen, zueinander finden, beieinander sind.
Niemand ist mehr zu trauen. Der Nacht nicht. Nicht dem Tag.
Januar 2017 – Klinik
1 Der OP-Saal, in den ich nach dem Vorbereitungsraum, dem Vor-Vorbereitungsraum und dem Vor-Vor-Vorbereitungsraum, wo andere Namensband-Patienten liegen wie am Fließband, ist nagelneu. Pfleger Ralf, Typ „Ich spiel am Wochenende mit meiner Band rockige Musik in Vereinsheimen“, macht den Job seit dreißig Jahren und sticht trotzdem dreimal daneben als er mir einen Zugang legen soll. Er hat, glaube ich, Angst vor meinen feinen Venen in Kombination mit seinen Riesenpratzen, tut aber, als wär ich schuld. Seine Kollegin macht das besser. Und sagt die richtigen Sachen. z.B. als irgendjemand von den vielen Leuten um mich herum, die noch rasch den OP-Saal umbauen müssen bemerkt, dass ein Kabel fehlt, erklärt sie mir, damit sei nur das Computerkabel vom Laptop gemeint, ich solle mir keine Sorgen machen. Ich bekomme ein Antibiotikum während ich die beiden riesigen OP-Lampen über mir betrachte, die in jedem Kinofilm zur Ausstattung dazugehören würde, in dem eine durch Aliens durchgeführte Operation an einem zu diesem Zweck entführten Humanoiden gezeigt werden soll. Ich bin eigentlich ganz ruhig, aber meine eiskalten, schweißnassen Hände und mein zitternder nackter Körper unterm OP-Kittel Größe XXL, sagen was anderes.
-Ich bekomme ein Antibiotikum. (Die Tiefkühlatmosphäre hier ist keine Einbildung, und nicht nur dem Ambiente und dem niedrigen Angst-Blutdruck geschuldet, sondern ein Temperatur-Faktum, das die Bakterien abschrecken soll, erklärt die Schwester, die alles richtig macht).
-Ich bekomme ein Schmerzmittel.
-Ich bekomme ein Schlafmittel. (Das aufgrund der frühen Uhrzeit, sieben Uhr morgens, nicht nötig gewesen wäre, aber ich bekomme es eh nur theoretisch, denn wie immer bin ich schon beim Schmerzmittel hinüber.)
2 Als ich aufwache habe ich das Gefühl, seit Jahren nicht so tief geschlafen zu haben. Was ich mitgebracht habe, aus diesem tiefen Schlaf, ist T.. Ich liege im Aufwachraum und weine zu meiner eigenen Überraschung.
3 Ich bin hier wegen einer Lappalie drin. Der Frau neben mir haben sie einen (gutartigen) Tumor in Größe eines Schweineschnitzels aus dem Brustkorb operiert. 4 Jahre lang ist sie zum Arzt gegangen, weil sie so schlecht Luft bekommen hat, weil sie sich nicht wohl gefühlt hat, weil sie gemerkt hat, dass irgendwas falsch war. Die sind schon genervt von dir, weil du immer kommst, hat ihr Mann gesagt. Aber wer auf einer Insel in der nord-ostdeutschen Pampa wohnt, der muss mit schlechter Versorgung rechnen.
Sie redet und redet und redet sogar noch, als ich mir die Zeitung direkt vor die Nase halte. Wenn sie telefoniert, stellt sie die Gesprächspartner auf Lautsprecher. Die zweite Frau im Zimmer redet auch gerne, wird aber immer von der ersten Frau dabei unterbrochen und überboten, ein Wettstreit. Nach kürzester Zeit weiß ich alles. Abhauen kann ich nicht, ich bin müde und erschöpft von der Narkose und kann mit dem Bein nicht auftreten. Wieso vergesse ich immer meine Kopfhörer?!
4 Also von Personalmangel merk ich nix. Innerhalb von drei Tagen – Montag Voruntersuchung, Dienstag OP, Mittwoch Entlassung – habe ich mit gefühlt mindestens 50 Personen Kontakt.
Am ersten Tag. Patientenmanagement/Aufnahme (1 Person). Ich bekomme eine Akte, mit der ich ab sofort durchs Haus laufe, verschiedene Stellen abklappere (2 Personen / 1 Person / 1 Person), dort jeweils nach etwas Wartezeit Fragen gestellt bekomme, die in Formulare notiert werden, die in meine dicker werdende Akte kommen.
Die Fragen werden an jeder Stelle, bei der ich vorstellig werde, wiederholt. Zwischendurch bekomme ich Blut abgenommen und leiste sehr viele juristisch und datenschutztechnisch relevanten Unterschriften.
Am nächsten Tag: Aufnahme im OP-Zentrum (1 Person), Vorbereitung und Transport (3 Personen). Warteraum (1 Person). Vorvorbereitungsraum (2 Personen) Hier komm ich auf den OP Tisch und werde festgeschnallt, keine Ahnung warum. Vorbereitungsraum (1 Person). (Wieder die gleichen Fragen, die Antworten auf dem aktuellsten Formular sind jetzt, nach der vielen Durchschleiferei schlussendlich falsch notiert.) OP-Saal (3 bis 5 Personen), Aufwachraum (1 Person). Zimmer, nach OP bis zur Entlassung am nächsten Tag: 10 Personen, Schwestern und Ärzte). Achja, Essenslieferung: 2 Personen.
5 Das Krankenhaus ist eine große, logistische Supermaschine, durchevaluiert und hyperrationlisiert bis ins kleinste Detail. Da geht natürlich dauernd was schief. Das Essen z.B. kommt viel später, weil die Maschine, die es aufwärmt, nicht funktioniert und erst ersetzt werden muss. Und dann der menschliche Faktor. die eine Schwester teilt die falschen Tabletten aus. Die andere ist schlecht beim Verbandswechsel, aber sehr aufmerksam was Hygiene und Bequemlichkeit angeht. Die Visite als Inszenierung hat nichts von ihrer Lächerlichkeit eingebüßt. Die Hierarchien zwischen den Ärzten, zwischen den Schwestern und Ärzten, zwischen den Schwestern und Schwestern, quellen durch jede performative Pore. Alles in allem mal wieder ein hochinteressantes Abenteuer. Ich beneide und bewundere jeden, der dort arbeitet. Was würde ich drum geben, wenn ich so einen normalen crazy Job hätte.
6 Zuhause kocht T. mir Hühnersuppe. Ich verschlafe den halben Tag.
Januar 2017 – refugee
Manchmal helfe ich freitags einer jungen Frau aus Afghanistan bei den Hausaufgaben. Kürzlich meldet sie sich zum ersten Mal via Whatsapp bei mir, sie hat ein neues Handy mit dem das geht. Ich betrachte ihr Profilbild.
Es ist ein gemaltes Bild. Ein Mädchen in einem weißen Kleid – wir sehen es von hinten- sitzt auf einer dünnen, instabil wirkenden Holzstange. Die Stange liegt über einem Abgrund zwischen zwei Felsen. Das Mädchen sitzt dort oben ein bisschen wie auf einer Schaukel und schaut in den Himmel vor sich, der sich mit seinen Sepiatönen nicht entscheiden kann, ob er gutes oder schlechtes Wetter verspricht. Ein Vogelschwarm auf der linken Seite des Bildes.
Zum ersten Mal wird mir wirklich klar, wie sie sich fühlen muss.
Januar 2017 – M.
Ich telefoniere mit M. Sie ist sehr aufgebracht. Ein Mann ist gekommen und hat etwas weggenommen. Dabei war das sehr schön, wunderbar war das, das war alles sehr schön gemacht worden, ja?, – und jetzt hat der alles kaputt gemacht. Sie hat gerade schon mit ihrer Schwester telefoniert. Sie ist richtig sauer.
Ich versuche, zu folgen, die Puzzlestücke ihres Redens zusammen zu fügen, ich nehme an, ein Handwerker war da und hat irgendwas verändert, vielleicht an den Pflanzen, oben Wohnzimmer, aber es gelingt mir nicht.
B., ihr Mann, mein Stiefvater, kommt ans Telefon: Er hat den Christbaum weggeräumt.
Januar 2017 – Testphase
T., ich und das Probe-Abo. Auf den jeweils anderen.
Dezember 2016 – Beschauliches zum Jahresende
Go fuck yourself, 2016.
Dezember 2016 – Breitscheidplatz
1 Ich bekomme es spät mit, und reagiere dann ziemlich abgebrüht: Wir haben alle gewusst, dass es passieren würde. Jetzt ist es da. Es ist nicht angenehm, das zu spüren. Auch alle anderen scheinen mir eher unterkühlt. Kein großes Thema, bei niemand. Liegt es daran, dass es am Breitscheidplatz war und nicht in Neukölln im Ausgehviertel oder im Prenzlauer Berg an der Eberswalder Straße. ist der Breitscheidplatz so fern wie Istanbul. Kann doch nicht sein. Ich bin da, geh da, hätte da aus bestimmten Gründen sein können. Doch Paris ist mir weitaus näher gegangen. Ist es das jetzt? Einfach eine neue Todesursache, mit der man lebt, neben Unfall, Krankheit, jetzt auch der Terroranschlag? Eine Angst, die mich auf belebten Plätzen, in Ubahnen, Shopping Malls, Clubs, Regionalzügen überfällt, von ihnen fernhält. Ein Risiko, das ich eingehen kann oder auch nicht, wie Autofahren, Fahrradfahren, Rauchen, auf eine Leiter klettern? Ich muss an Israel denken. (Ja, ich denke nicht an Afghanistan, an Syrien, typisch.) Für die ist das doch noch alles pipifax. Ändert sich ein Leben, wenn es jederzeit von einer Bombe bedroht ist?
2 Am nächsten Tag sitze ich in der Ubahn und gucke Jungs an, Jungs wie Amri. Nett sehen sie aus. NORMAL. Wie ihn gibts Tausende. Kopfhörer im Ohr, Handygedaddel, manche still, bloß nicht auffallen, ander unangenehm verdruckst, von unten hoch, wieder andere aufgeweckt, laut, frech. Meistens zu zweit oder dritt, manchmal allein. Dann verloren. Ich bin misstrauisch, hab Angst vor ihnen, bin wütend auf sie, versteh sie nicht, bekomme Sozialpädagoginnen-Instinkte. Auch das ist alles unangenehm zu merken. Auch das ist nicht neu.
3 Ein paar Tage später sehe ich ein Foto in der Zeitung. Eine endlos lange Schlange in einem Belgrader Flüchtlingslager: Anstehen für eine Mahlzeit, bei 2 Grad Minus. Auf dem Foto sind nur junge Männer. Ausgebremste, abgehängte junge Männer – die doch das Gefühl haben müssen, im richtigen Alter zu sein, um richtig LOSZULEGEN, die das Gefühl haben müssen, jetzt DRAN zu sein. Deswegen sind sie doch losgezogen! Stattdessen stehen sie in der Kälte um Essen an, und warten aufs nächste Nichts. Können nicht vor, nicht zurück. Stehen in dieser Schlange, und wenn sie vorne angekommen sind, können sie sich gleich hinten wieder einreihen. In irgendeine andere Schlange. Die Welt verschwendet ihre Jugend. Der Kapitalismus frisst seine Kinder. Und von den jungen Frauen war hier noch nicht mal die Rede.
4 Wieder ein paar Tage später. Ich schnappe irgendwo ein paar Zeilen Amris aus einem Video auf: Wir kommen zu euch, um euch zu schlachten, ihr Schweine. Was soll das sein, frage ich mich, was ist das für ein diffuser Schwachsinn? Wenn man schon terrorisiert wird, dann will man doch wenigstens wissen, warum. Diese Jungs wollen ja nicht mal was oder wissen nicht was sie wollen sollen, die können, wenn’s hoch kommt, jemandem Treue schwören, der den Eindruck macht, er wisse es. Da fallen ja nicht mal mehr Stichworte wie ihr Ungläubigen oder Amerika hat uns den Krieg gebracht oder sowas. Ist das überhaupt Terrorismus? Adeln diese Jungs einfach nur ihren Amoklauf mit einer diffusen Religiosität, einem unbestimmten Dagegensein, einem Gegen- das- Klein- sein, dumme Jungs, keine Generation 9/11 mit Abitur mehr, kleine Wichtigtuer, die ihrem beschissenen, gerne schon etwas kleinkriminellem Leben und ihrem bescheuerten Verbrechen, das sie normalerweise an der High School verübt hätten, eine höhere Bedeutung verleihen wollen. „Ihr Schweine“. Vielleicht auch einfach nur die nächste Stufe erreicht, wozu noch systemische Zusammenhänge erläutern, Überzeugungen kundtun, einfach alles Abschaum, Tiere, Ungeziefer, allgemeiner Vernichtungswille. Die Sache mit den Jungfrauen scheint jedenfalls auch nicht mehr zu ziehen, falls das nicht sowieso schon immer westliche Propaganda war, damit sind die nicht mehr zu locken, die Selbsttötung scheint aus der Mode. Da macht der heilige Krieger lieber mit seiner coolen Knarre die Biege bis nach Italien und lässt sich dort von Rechts wegen erschießen. So dass ich mich dann an Weihnachten freuen soll, dass einer tot ist. So weit kommt’s noch.
Dezember 2016 – Ausschlag
Im Gesicht.
Die Hautärztin sagt stolz und saftig ein Wort. Sie hat Spaß an ihren schnellen Diagnosen, ihren Hiobsbotschaften aus dem Reich des Alters, des Ekels und des Verfalls.
Ich krieg Creme, die nix nützt, weil das Ganze hat ja wie immer heutzutage beim Arzt auch eine PSYCHISCHE KOMPONENTE.
Psychisch heißt: Selber schuld.
Denn: Was ist es, was da ausschlägt? Hm? Das müssen sie sich schon fragen. Nicht genug entspannt? Zu unglücklich gewesen, zu drepressiv? Das müssen sie in den Griff kriegen. Nicht genug geliebt worden? Machen Sie sich davon unabhängig. Nicht die richtige work-life-balance hingekriegt, da brauchen sie sich nicht wundern. Dafür kann ich ihnen kein Rezept geben, da müssen sie selbst aktiv werden.
Dezember 2016 – Lila Koffer
Manchmal denkt man ja, man will gar nicht leben. Bis man dann in den Schönhauser Allee Arkaden steht und nach einem Buch sucht, das man verschenken kann, und dreimal im Abstand von fünf Minuten eine Durchsage hört, dass der Besitzer des lilafarbenen Koffers, der vor dem Netto steht, sich umgehend bei der Konzertkasse melden soll, man kurz einen kleinen Joke mit der Verkäuferin darüber macht, die einem nett auf die Sprünge geholfen hat, bei der Buchsuche, dann an die Kasse schlendert, endlich, nach drei Tagen blöd rumüberlegen! (Kindergeburtstag), ein Buch in der Hand, um dann eine Durchsage zu hören, die da lautet:
Aufgrund einer Betriebsstörung wird das Shopping Center geschlossen, begeben Sie sich bitte sofort zum Ausgang, es besteht kein Grund zur Beunruhigung, ich wiederhole: Es besteht kein Grund zur Beunruhigung.
Die Kassiererin vor mir lässt umgehend alles stehen und liegen, die eine sagt zur anderen: Nenn mich Kassandra,(hat sie‘s heute Morgen schon geahnt, dass der Tag böse enden wird, oder erst gerade, als die erste Koffer-Meldung kam), alle streben gen Ausgang, auch ich gehe los, lege das Buch irgendwohin, auf andere Bücher, verlasse wie alle den Laden, wie viel Leute hier plötzlich sind!, gehe die Rolltreppe runter, und denke, in einer Hitzewelle aus Angst, die mir plötzlich durch den Körper fährt, Ich will nicht sterben. Ich will raus hier, ich will nicht in die Luft fliegen, von Splittern übersät in meiner eigenen Blutlache gefunden werden, abgetrennte Gliedmaßen und schreiende Menschen das letzte was sich auf meiner Retina abbildet, ich fixiere von der Rolltreppe aus den Ausgang, da will ich hin, ich bemühe mich, nicht schneller zu werden, zu rennen, Auslöser einer allgemeinen Panik zu werden, höre schon die Polizeisirenen, erreiche den Ausgang, bin draußen!, noch mehr Sirenen, überquere die Straße, bringe Strecke zwischen mich und die lila Bombe, das in die Luft fliegende Einkaufszentrum, die Sirenen werden mehr und entfernen sich gleichzeitig, weil ich mich entferne, während ein Wagen sich nähert, das weiß ich, in dem ein Entschärfungskommando sitzt, drei Männer, denke ich, in Spezialkleidung, die da jetzt reingehen und irgendwas machen, von dem ich keine Ahnung habe, um rauszufinden, ob in dem lila Koffer nun was drin ist, was morgen in der Zeitung steht oder nicht, während ich, schon wieder zurück in meinem Alltag, denke: Scheiße, jetzt hab ich immer noch kein Buch.
Aber für einen Moment, für einen kurzen, wollte ich leben. Ich wollte ein Buch kaufen, durch die Straßen nach Hause schlendern, vielleicht noch irgendwo einen Kaffee trinken.
Das mach ich dann auch.
Dezember 2016 – Untergrundbahn
Morgens halb acht in Berlin. Ich betrete die Ubahn, da ist schon einer so richtig wach. Ein junger Voll-Assi, wie soll man‘s anders sagen, schreit los, macht eine Frau an, die durch den Gang an ihm vorbeiläuft, vielleicht Ende zwanzig, Kopfhörer im Ohr: du Ausländerfotze, hau ab!, geh nach Hause! Die Frau rupft sich die Kopfhörer aus dem Ohr, dreht sich zu ihm, ein deutsch-türkischer Shitstorm geht auf ihn runter: Las misch in Ruhe, du Bastardsohn, schreit sie, (ich bin überrascht, heißt das nicht Hurensohn), Ich bin Deutscher, du Schlampe, schreit er, so brüllen sie, der Sound der Ubahn, ganz reizend, auf leeren Morgenmagen, ich sage Ey!!, bleibe natürlich ungehört, genervt, hilflos wie alle anderen, die wir der Situation ausgesetzt sind, nicht wissen, wird er gleich handgreiflich, wann muss man ihn stoppen, wann die Bullen rufen, oder ist eh alles egal und wir erklären auch diesen Zwischenfall zum ignorierfähigen Normalzustand dieser Großstadt.
Ein Mann mischt sich ein, klein und dick, schon etwas älter, geht auf den Typ zu, redet auf Polnisch beruhigend auf ihn ein, die Hand beschwichtigend auf und ab bewegend, da antwortet der Typ ihm plötzlich auf Polnisch! Sie reden miteinander, der Mann setzt sich ihm gegenüber, kultura, kultura, sagt er immer wieder appellierend, kultura. Ich bin irgendwie gerührt. Ja,ja lass mich in Ruhe, sagt der Assi, jetzt wieder auf Deutsch. Ich bin Deutscher, ich hab Kultur!
Mann, mann, Leute. Diese ganzen verwirrten Volltrottel in deren Hirne sich die Dinge überlagern, angesichts der Weltlage, (ich kenn mich ja auch nicht mehr aus), und die sich dann ermuntert fühlen, das in selbstgerechten Zorn gegen andere umzumünzen und sich aufzuplustern und nächstes Jahr die AfD zu wählen.
Die Berliner Ubahn war schon immer eine der härtesten, aber kommt‘s mir nur so vor oder wird dieses öffentlich- rechtliche Verkehrsmittel in den letzten Jahren zur unterirdischen Zentral-Versammlung für die Armen, Verrückten und Touristen dieser Stadt? So wie in L.A. der Bus? Wer jedenfalls wissen will, was los ist, der sollte runter vom Kuschel-Rad und rein in die Ubahn.
Dezember 2016 – Musik
Musik ist nicht mein Ding.
Ich muss ja nur immer weinen.
Oder tanzen.
Alles so manipulativ.
Und man kann nicht mal die Ohren zumachen, wenn‘s schlimm wird.
So mal ist ja okay. Wenn andere Leute dabei sind. Dann, manchmal richtig toll. Party.
Aber grundsätzlich hau ich mir einfach lieber was auf die Augen.
November 2016 – Heribert Prantl
Heribert Prantl ich bin so froh, dass es dich gibt
Heribert Prantl so heißt mein Lied
Heribert Prantl schrabbelt meine Ukulele
Heribert, Cheribert
check it out on Youtube
Heribert du bist die letzte Bastion
Heribert du lässt dich nicht irritiern
Heribert du beharrst beharrlich
(Schwester Angela).
auf die Mindest Standards
des Mindest Anstands
in Zeiten einer auf der Werte-Ebene aus den Fugen geratenen Welt
Heribert Prantl ist Jurist
Heribert Prantl ist leider Christ
Heribert Cheribert
wir brauchen dich
Heribert Cheribert
verlass uns nicht
ob AfD oder ISIS
du weißt wie man denkt in Zeiten der
Krisis
Heribert Cheribert
klär uns auf
Heribert Cheribert
kommentier uns da raus
November 2016 – Die Alterslüge
Wenns um mein Alter geht, lüge ich wie gedruckt. Da bin ich schlimmer als eine Schauspiel-Diva.
Ich finde Alter scheiße. Und mein Alter finde ich ganz besonders scheiße. Und noch scheißiger finde ich Leute, die sagen, wieso stehst du nicht zu Deinem Alter. Sowas sagen nur Leute, die immer zur rechten Zeit am rechten Ort waren, mit beiden Beinen mitten im Leben stehen, rechtzeitig erreicht haben, was es zu erreichen gilt. Ich hasse solche Leute. So ein Leut war ich nicht mal bei meiner Geburt. Da hatte ich schon Ringe unter den Augen.
Wie alt bist du? – Da denk ich mir schnell was Passendes aus. Ich seh’s nämlich nicht mehr ein. Wie schnell hat man sich heute mit einer ehrlichen Antwort auf diese Frage einen Standortnachteil eingehandelt, weil man mal wieder zu alt oder zu jung ist, für das, was man gerade will oder was die anderen von einem wollen.
Das Problem ist allerdings, dass ich sehr schlecht im Kopfrechnen bin, so dass ich auf Folgefragen, wie: Seit wann wohnst du in Berlin? Wann hast du studiert? Wie alt ist dein acht Jahre jüngerer Bruder? oft nicht schnell genug antworten kann, und ich ins Schwimmen gerate. Dann wird aus einer Lüge, wie im Falle aller Lügen, eine riesen Story, vor deren Komplexität man auf keinen Fall klein beigeben darf, die man gnadenlos aufbauschen und kaltblütig durchziehen muss. Am Ende tun mir die Leute leid, weil ich sie leider nicht mehr in mein Leben lassen kann. Im Grunde muss ich sie umbringen. Es ist einfach zu viel passiert.
Wie alt bist du? – Ich kann die Reaktionen auf die Antwort nicht ertragen, immer diese REAKTIONEN in den Gesichtern. Was holen die Leute sich da ab, wenn sie das fragen, worauf wollen die hinaus, was hat die Antwort auf die Frage eigentlich zu bedeuten? Denn die Frage wirkt sehr bedeutungsvoll, und mit der Antwort scheint immer einiges klar zu sein, um nicht zu sagen: alles. Alles klar. Immer stößt man da auf was, wenn man diese Zahl raushaut, auf Einverständnis, Nähe, Irritation, Geringschätzigkeit, heimliche oder offene Überraschung, Die Frage hat immer viel mit dem Fragenden zu tun. Da findet ein Abgleich statt, in Sekundenschnelle, anhand des besser-schlechter-Koordinatensystems, fest implementiert in unserem Gehirn. Die Antwort dockt in einer nur dafür zuständigen Ecke des Gehirns an, wird per Blitz-Synapse schematisch-assoziativ befragt, abgespeichert, und nie mehr vergessen.
Als wäre man nicht eh immer schon ZU irgendwas in dieser Welt: Zu spießig, zu nett, zu arm, zu kindisch, zu langweilig, zu großbusig zu kleinnasig, zu dumm, zu still, zu laut, und dann auch noch: zu jung, zu alt? Für den Job, die Freundschaft, den Sport, das Interesse, die Lebensweise. Warum muss ich mich damit auch noch rumschlagen, muss mich von einer objektiven Zahl und den so Ich-gefärbten wie sozial repressiven Assoziationen, die sie in den Gehirnen meiner Umgebung auslöst, tyrannisieren lassen? Am Schlimmsten sind die Folgekommentare. Hast dich aber gut gehalten. Echt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ach, genau wie ich! Ich meine, was soll das?
Ich steh nicht zu meinem Alter, das seh ich gar nicht ein. Ich steh eh zu gar nix. Ich stehe höchstens dazu, dass das Faktum meines Alters mich mit Komplexen belädt, wie der Rest meines ZU-Lebens auch. Und wenn ich an dieser kleinen Stellschraube die Möglichkeit habe, AUSNAHMSWEISE einfach mal ein bisschen unlocker und neurotisch zu sein, dann mach ich das.
Die sozialen Medien bieten Menschen wie mir da einen großen Vorteil. Klarnamen und Alter werden überall abgepresst, aber es gehört inzwischen zum guten Ton, diese Forderung nicht zu erfüllen, und sich trickreich um deren Nennung drum rum zu drücken, um kein willfähriges Opfer von Werbeindustrie und Vollüberwachung zu werden.
Sehr junge Menschen und sehr alte Menschen reden gerne über ihr Alter. Sie sind stolz darauf. Frauen im mittleren Alter, also so zwischen 25 und 69 stellen sehr gerne die Frage nach dem Alter, reden aber nicht gern über ihr eigenes, und Männer haben ihr Alter meist vergessen. Die schauen dann im Perso nach.
Nächstes Jahr jedenfalls, spul ich einfach mal vor, und feiere meinen 50sten Geburstag. Ich fühle mich so langsam in der Lage, dieses Alter zu stemmen und möchte nicht mehr länger warten, bis es so weit ist. Die Leute werden sagen, echt, hätte ich nicht gedacht, oder: hätte dich älter geschätzt. Danke! werde ich sagen, und mich freuen. Am 6. November 2017 ist es soweit. Wenn ich mir meinen Jahrestag nicht nochmal anders zusammen lüge. Ich hoffe, ihr erscheint zahlreich.
November 2016 – Meckerfixierung 2
Toilettenpapier! FALSCHRUM eingehängt, wo man geht und steht, jawohl! Statt RICHTIGRUM! das lose Blatt nach vorn!, locker im Wind baumelnd, griffbereit, leicht zugänglich, damit jeder, der gerade versucht, den Öffentliche-Toilette-Hocksitz auszubalancieren, einfach mal easy drankommt, und nicht genervt auch noch die zweite Hand Zuhilfe nehmen muss, um sich vielleicht auch mal ein paar Blätter am Stück abreißen zu können und kein Gefummel hat, weil das Papier nur einblattweise oder gar fetzenweise abgehen will – eh schon eine ständig drohende Gefahr bei dem ganzen unverschämten Billigtoilettenzeitungspapier, das sie einem unter dem Deckmäntelchen des Umweltschutzes auf Gastro-, Hotel-, öffentlichen und WG-Toiletten unterjubeln, in Wahrheit aber nur aus reinem Knausergeiz über den Halter stülpen, einem Knausergeiz gepaart mit einer deutschlandweit tief sitzenden, schwäbischen Abneigung gegenüber dem WOHLBEFINDEN, dem sogenannten ZUWOHLBEFINDEN, einer Abneigung dagegen ganz besonders im Bezug auf DA UNTEN Schrägstrich HINTEN. Du sollst nicht genießen deinen Toilettengang. FALSCHRUM! eingehängt die Rolle, GEGEN die Wand, wo das Papier beim Abrollen die größtmögliche Oberflächenberührung mit ebendieser Toilettenwand eingeht, ja geradezu an ihr entlang schrabbelt, sie ableckt wie eine Papierzunge, und dabei die gesammelten Bakterien, die sich dort tummeln, gierig abstreift, ja, sie geradezu frisch von der Toilettenwand aufnimmt, kurz bevor man es mit seinen hochempfindlichen, schwerpunktmäßig aus empfindlichen Schleimhäuten bestehenden, naughty bits berührt.
Come on, ist das denn so schwer? Ich kann doch nicht die einzige sein, die das nervt.
November 2016 – Das unsichtbare Mädchen
Für immer. Leise und im Geheimen, wie dieser Blog hier. Kein Licht bitte, den Finger auf den Mund gelegt und zärtlich geküsst die Dinge.
Gesehen,
nicht gesprochen.
November 2016 – A.
Es gibt da eine Frau, die ich nett finde, ich würde mich gern mit ihr anfreunden (und Gott weiß, dass das nicht oft vorkommt). Also mache ich, was man mir sagt, was man macht, wenn man eine Frau nett findet und zur Freundin haben möchte: Ich melde mich bei ihr. Ich verabrede mich mit ihr.
Ich komme zum verabredeten Date, aufgeregt, glücklich, wir fangen an zu reden, alles läuft flüssig, knappe zehn Minuten lang – dann steht ihr Freund vor unserem Tisch. Küsst sie zur Begrüßung, setzt sich. Ich bin verwirrt. Hab ich was Falsches gesagt, was Falsches signalisiert? Ich kenne ihn schon länger, mag ihn, aber ich wollte sie treffen. Wie haben die beiden darüber kommuniziert? Hat sie ihm erzählt, dass wir uns treffen und dann hat er gesagt, oh cool, da komm ich mit oder hat sie ihn gefragt, ob er mit will oder hat er gefragt, ob er mit darf? Ich hab keine Ahnung.
Ich verabrede mich wieder mit ihr, mache das, was man mir sagt, was man macht, wenn man sich mit jemandem anfreunden will: Nicht gleich aufgeben, ma bisschen dranbleiben. Es braucht ein bisschen, bis ich sie hab, aber dann sitzen wir wieder in einer Kneipe. Ich freue mich, umschiffe die ersten Gesprächshürden, gottseidank, wir haben uns was zu sagen, nach zehn Minuten sehe ich durchs Fenster: Ihren Freund. Schließt gerade sein Rad an. Ich kapier‘s nicht. Es ist nett zu dritt, aber. Es ist ja doch. Was anderes. Ne?!
Zeit, eine andere Freundin zu konsultieren. Die sagt: No way!, eine andere meint: Geht gar nicht. Ich bin also nicht allein mit komisch. Zeit auch, paranoid zu werden: Vielleicht hat sie ihm schnell getextet, Hilfe, Elli ist so booring, wenn du nicht gleich kommst, ramme ich meinen Kopf gegen die Holzpaneele? oder auch: Sie ist ja ganz nett, aber ich verzehre mich nach dir und kann immer nur an dich denken? Vielleicht darf sie ja auch nix mehr ohne ihren Typen machen (dafür ist sie echt nicht der Typ) oder sie dürfen nie mehr was ohne einander machen (weils so romantisch ist) oder sie findet es unhöflich, ihn nicht dazu zu holen, weil ich ihn schon länger kenne oder er denkt, ich muss da mit, hinterher geht die Schlampe ihr noch an die Wäsche oder redet schlecht über mich?, WHATEVER, Leute, was weiß denn ich.
Es gibt eine Veranstaltung in einer anderen, nahe gelegenen Stadt. Sie spielt in einem Film mit, der im Rahmen der Veranstaltung gezeigt wird. Es geht um ein Thema, das mich interessiert, das sie betrifft, und über das wir uns jedes Mal angeregt unterhalten haben, wenn wir uns gesehen haben. Ich äußere spontan die Idee, dass ich mitkommen könnte. Sie freut sich. Dann höre ich nichts mehr von ihr.
Wie schon die ganze Zeit ignoriere ich meine aufkommenden Zweifel, konzentriere mich auf den Kokser in mir (Ich bin geil, sie findet mich super, ich will was, ich sag was, dann krieg ich was), und melde mich. Eine Meisterleistung, ich brauche drei Energieriegel nachdem ich sie vollbracht habe. Sie freut sich wieder. Sagt, sie sagt Bescheid. Funkstille. Ich hab die Sache inzwischen abgeschrieben, mir erklärt, dass es jetzt sowieso zu stressig wäre, noch hinzufahren. Dann plötzlich, zwei Tage vorher, eine Nachricht von ihr. Ob ich denn noch vorhätte, da hinzufahren. Interessante Formulierung, denke ich. Sie hat evtl. ein Ticket und sogar einen Schlafplatz für uns. Ich atme ein und sage zu.
Ich stehe auf dem Gleis, der Zug fährt gleich ab, ich zücke mein Handy. Sie kommt gleich. Sie kommt eine Minute bevor der Zug abfährt. Wir steigen ein.
Als wir bei der Veranstaltung ankommen, auf die Filmleute warten, mache ich ein Foto von ihr im Foyer. Ich schicke es einem Freund, dem ich von der ganzen Sache erzählt habe. Der tippt zurück: Ist das da hinten ihr Freund? (Hahar. Nein, das ist nicht die Pointe).
Als die Filmleute kommen, ist mir meine Anwesenheit plötzlich unangenehm. Ich bin „eine Freundin, die mitgekommen ist“. Von wegen – ich kenn‘ sie kaum. Ich hab mich hier voll reingeasselt, inklusive Ticket und Schlafplatz.
Der Film ist großartig, ich find ihn richtig gut, ihren Auftritt auch. Wir gehen auf die Party, es ist ihre Party, sie hat alles Recht darauf, sie trinkt, redet, flirtet, mal hier und mal da so im Raum, ich halte gut mit, unterhalte mich, wir überschneiden uns manchmal auf ein paar Worte, aber immer nur kurz, ansonsten ist sie, wo sie ist, und will da auch sein, und ich bin möglichst bei mir statt bei ihr.
Irgendwann will ich eigentlich nur noch zum Pennplatz, den sie organisiert hat, doch daran ist nicht zu denken, macht ja nix, ich bin hier ja nicht der Spielverderber, also tanze ich, rede nochmal irgendwo, trinke, aber so ganz kann ich irgendwann nicht mehr. Sie kümmert sich auch den Rest des Abends nicht mehr um mich.
Irgendwann, schon schwer betrunken, fängt sie an, ihr Top auszuziehen und im BH dem Typ mit dem sie sich unterhält, ihre Tattoos zu präsentieren. (Vielleicht kommt es mir nur so vor, aber es scheint schon den ganzen Abend darum zu gehen, den Leuten zu zeigen, dass sie kein langweiliges Mäuschen ist, dass man sie nicht unterschätzen sollte, obwohl das niemand vermutet, niemand tut. Vielleicht hat sie Sorge, dass das im Film so rübergekommen sein könnte.) Eine Runde von Interessierten bildet sich um sie, ihr alle wohlgesonnen, alles warm und weich, keine Gefahr, aber ich frage mich, ob es meine Aufgabe ist, als eine Freundin, die mitgekommen ist, ihr zu sagen, dass man den Abend so langsam mal zumachen sollte.
Sie ist so betrunken, dass sie die Tür vom Fahrersitz für die vom Rücksitz hält. Ich bitte darum, mich am Bahnhof rauszuwerfen, zum Pennplatz zu fahren würde sich nicht mehr lohnen, um kurz nach 6 geht mein Zug. Es ist halb fünf.
Der Bahnhof ist leer, kalt, und nur McDonalds hat offen. Da sitze ich mit den anderen Assis, einzeln in Plastiklederecken verteilt, und trinke heißen Wasserkakao. Die Frau hinterm Tresen hat gleich Feierabend, deshalb oder weil es so Firmenpolitik ist, schenkt sie mir zwei kleine Schokoladen. Wir reden ein bisschen. Ich bin müde, übernächtigt, zittrig. Ich mag was ich erlebt habe, denn ich hab was erlebt, und doch ist klar:
Ich war verliebt in eine Frau und sie hat mich vorgeführt.
November 2016 – Trump
Trump, die olle Trumpete.
Nicht mal die, die es wissen müssten, also die Marvel-Universen, die SciFis, die James Bond-Filme haben es je vorausgesehen, dass der Blonde der Schurke ist? Der, der die Weltherrschaft übernimmt? Ein blonder, dicklicher, aufgepumpter Junge, ein Schulhof-Bully mit Bauernschläue, einem feisten Lachen, dem Durchsetzungsvermögen eines durchschaubaren Großkotz und einer Frisur, die versucht auszusehen wie ein Toupet?
Es hat schon eine Menge andere wie ihn gegeben, es gibt sie, überall. Das sollte man nicht vergessen. Nicht zum ersten Mal beeindruckt so einer die Leut‘. Einer der stiehlt, lügt, betrügt, Frauen verwertet, der an nichts denkt, als ans Gewinnen, an Macht, an Geld, daran, sein rosa Schweineschwänzchen in Milch zu baden, tagein, tagaus. Einer, der Schurkenallianzen mit anderen Schurken eingeht. Der ein Kabinett aus Rechtsradikalen, religiösen Fanatikern und Konzernchefs zusammenstellt und sie als Consulting-Firma für den global agierenden Amerika-Konzern betrachtet. Eine Comic-Figur, die irgendwo mit seinem Clan aus weiteren Plastikmenschen auf einem TV-studioartigen Anwesen in der Hyperrealität lebt.
Den haben sie gewählt, die Abgehängten, die Armen, die Arbeits- und Hoffnungslosen, die Klasse und Mittelklasse der ausgedienten Fließbandarbeiter, die doch eigentlich die Revolution machen wollen sollten, und sie irgendwie nie auf die Art und Weise machen wollen, wie die Linke will, dass sie sie machen wollen sollen. Statt Solidarität und Schwesternschaft wählen sie ihn, den dicken Kapitalisten-Mann, den Herrn, den Ausbeuter, den Abschieber, den Diskriminierer, den Verlierer-Verächter. Wen hätten sie auch sonst wählen sollen? Etwa die andere?
Eine Wahl zwischen zwei Schülersprechern auf der High-School. Diesmal war die wache, gebildete junge Dame aus gutem Hause, die immer „ihre Hausaufgaben gemacht hat“ (wie oft wurde das betont, in leicht beleidigtem Ton, vor allem von Frauen, die immer noch darauf hoffen, dass es darum gehen könnte), die auf viel Erfahrung im Debattierclub und der Schülerzeitung, sowie auf ein solides Netzwerk aus politisch engagierten Leuten in politisch engagierten Institutionen bauen kann, und auch in punkto Ehrgeiz und brutale Entscheidungen treffen können jedes Assessment-Center für den Job bestanden hätte, eben nicht dran.
Ist mit der Wahl der Trumpete nicht einfach konsequent zu Ende gedacht, dass der globale Kapitalismus (der gerade unter den Verarmten doch die größten Fans hat, liebe Linken, denn sie wollen doch teilhaben an dem, die wollen doch endlich wieder rein in den und nicht raus aus dem), es mit sich bringt, dass Politik ausgehebelt, unterwandert, und zum Handlanger des Kapitals gemacht wird, sich machen lässt,
dass man also möglicherweise am besten fährt, wenn man den Staat einfach vollends als Unternehmen angeht, statt ewig pseudomäßig dagegen zu halten, und den Präsidenten als Konzernchef begreift.
Trump scheint weiter keinen evil Masterplan zu haben als diesen. Dass der Exxon-Chef jetzt Außenminister wird, geht da in die richtige Richtung.
November 2016 – Miete
Gestern bei Starbucks am Hackeschen Markt. Eine Mitarbeiterin erzählt am Rande des Tresens einer anderen, dass der Store geschlossen wird. Die Miete wird erhöht.
Auf wie viel denn? fragt die Kollegin. Die erste beugt sich nah zu ihr, flüstert: Sechzigtausend. (im Monat, im Jahr?!)
Starbucks – weggentrifiziert vom Hackeschen Markt! Das muss man sich mal vorstellen.
Kann man als Konzern eigentlich einen WBS beantragen? Verstopfen demnächst die Starbucks-Aufsichtsräte die Flure des Sozialamts, des Wohnungsamts, des kalten Berliner Asphalts, die Motz-Zeitung schön in der Klarsichtmappe, falls es regnet? Demonstrieren wir demnächst, die Internationalen Kaffeebecher hochhaltend, Seit an Seit mit den CEOs von Seattles Fairest Coffee Beans auf der Anti-Wohnungskatastrophen-Demo?
Aber rot-grün tut ja jetzt was dagegen.
Oktober 2016 – 4M10T – Phantom
T., ich, und das Phantom.
Manchmal taucht es auf, zwischen uns.
Das Phantom hat einen Namen.
Manchmal kann ich es sehen, manchmal er. (da bin ich sicher).
Es verschwindet wieder.
Manchmal bleibt es zu lange. Dann weine ich.
Manchmal hole ich es absichtlich hervor.
Auch, um es zu ärgern.
Oktober 2016 – Warum ich Kinder nicht leiden kann 1
Weil sie immer nur an eines denken: Essen.
Tagein, tagaus geht’s nur darum: Essen, Mampfen, Mümmeln, Aufweichen, Kleinlutschen, Reinstopfen. Es geht ums Kriegen, ums Abkriegen, ums mehr Kriegen, ums mehr Kriegen als der andere, ums noch mehr Kriegen als der andere, ums mehr Kriegen als alle, ums alles kriegen! Süßes. Das Größte. Das Beste. Diese gierigen kleinen Scheißer, diese Ego-Fresser. Auffressen würden sie dich, wenn sie nur könnten, in alles würden sie reinbeißen, alles würden sie zerkleinern, mit ihren zahnlosen bis kleinzahnigen Mündern, ihren Mini-Zungen, die in ihren Rachen, ihren Schlünden sitzen wie die von Reptilien.
Die härtesten, eiskalten Deals schließen sie ab mit dir, wenns ums Essen geht. Still sein, sitzen bleiben, aufhören zu nerven – alles geht, wenn sie bloß was in die Finger kriegen, was sie sich reinschieben können. Korrupte und korrumpierbare kleine Schweinchen sind sie, wenn man ihnen was Essbares vor die Nase hält, denn erst kommt das Fressen und dann die Moral, das weiß jedes Kind. Von wegen guck mal wie süß, widerlich ist das, dieses Pampe-Essen in den kleinen Händchen, am besten noch Banane, die ekelhafteste Frucht von allen, mit ihrem verrottenden, süßlich braun-gelben Geruch, der an die Tropen erinnert, an Max Frisch und sein: Wo man hinspuckt keimt es, abstoßend dieses Zermatschen-quetschen-malmen im Mund, dieses Rumspielen damit, abschmieren, wegschmieren, ausspucken, einsaugen, zu doof, den breiigen Scheiß drin zu behalten, zu faul, zu bequem, zu vollgefressen.
Und dann die Mütter dazu, Füttermaschinen, immer den Mund der Kleinen im Auge, um den sie ständig kreisen, in den sie ständig was stopfen, auf den sie ihr Denken ausrichten, ihren Körper, ihr Sein, ihr eigenes Essen, wie Tiere, Vogelmütter, im Innersten getrieben, vom Signal des gelben Schnabels, und seiner Forderung, da was reinzustecken, in dieses gnadenlose existenzgierige Loch, willenlos und mit hohem Anspruch ihrem Fütterinstinkt ausgeliefert, und der satten Befriedigung, dabei zuzusehen, wie ihr Kind ihr Futter entgegen nimmt, es in der Hand dreht, es anschaut, wie es eines Tages einen Penis oder eine Vagina anschauen wird, ein Glücksversprechen, das es sich zuzuführen gilt. Meine Verachtung, liebe Mütter, für die Rigorosität eures Fütterwillens, Hindernisse? – aus dem Weg, Leichen? – drüber gehen, mein Kind muss gefüttert werden, jetzt.
Ja, ja, keine Sorge, ich bin in Therapie.
Oktober 2016 – Gottlose
Ja, ja, die Religion, die muss man respektieren. Na klar, jeder kann glauben, was er will. Absolut. Bin ich dafür.
Aber halten wir doch mal eins fest:
Kein Atheist rennt im Namen seiner Überzeugung durch die Gegend und sprengt Leute in die Luft. So viel kann man schon mal sagen. Kein Atheist verweigert seinen Kindern Schulbildung, Gleichstellungsgedanken, Bluttransfusionen, Masturbation oder Sex vor, nach oder während der Ehe.
Natürlich, es gibt religiöse Menschen, die lang und ausführlich erläutern können, warum das alles keinesfalls Teil ihrer Religion ist, und die das mit Stellen aus den einschlägigen Dickbüchern hieb- und stichfest belegen können, und die im Gegenteil Liebe, Umweltbewusstsein, Toleranz, Homo-Affinität und Protestkultur als die wesentlichen Aspekte ihrer Religion ansehen. Aber klar ist doch: Religion ist keine Garantie für gar nix. Ob du „a good person“ bist, or an „evil monster“, wie die Amis es gerne auf zwei populäre Nenner bringen, die sie dann, religiös wie sie sind, mit Inhalten füllen, wie es ihnen passt – im Namen von Religion ist beides gut zu machen.
Also rechnen wir doch mal auf, Auge um Auge, Wurst um Wurst, hier explodieren schließlich Bomben: Wer hat die besseren Referenzen, historisch betrachtet? Die Gottlosen mit ihrer Aufklärung, ihrer Psychologie, ihrer Wissenschaft, ihrer Philosophie oder die Gottesfürchtigen mit ihren Religionskriegen, ihren Scheiterhaufen, ihren Exorzismen und strukturellen Missbrauchsskandalen?
Welches ist das überzeugendere Konzept? Was wählst du, wo machst du dein Kreuz? (ha)
Oktober 2016 – Meckerfixierung 1
Ich meine, Entschuldigung, aber:
Wieso sind Umkleidekabinen eigentlich immer so dreckig?
Ich lauf da in irgend so einen Großkonzern rein, in ein milliardenschweres Klamottenimperium wie Zara oder Cos oder H&M, in dem ich Geld lass, für Gewinnmargen und Transfervolumen, von denen ich keine Ahnung hab, weil mir davon eh nur schwindlig und schlecht wird, und dann geh ich da in die Umkleidekabine, und dann liegen da Wollmäuse rum in einer Größe, die auf eine mindestens 10tägige Intensiv-Züchtung hinweisen, und muss beim Abstreifen meiner Jeans und der dabei einzunehmenden, nur durch lästiges, demütigendes Ausgleichshüpfen zu haltenden Balance aufpassen, dass die Hosenbeine nicht kontaminieren, und sich meine Socken nicht in Wollmaus-Magnete verwandeln und ich mit Staublappen-Füßen zurück in meine Schuhe steigen muss. Wieso zur Hölle kann nicht einer von diesen Jungs und Mädels da vorne am Nummern-Tresen mal EBEN KURZ, morgens bevor’s losgeht, einen Swiffer in die Hand nehmen und verdammt nochmal dafür sorgen, dass die SCHEIß UMKLEIDEKABINEN sauber sind? Come on!
Oktober 2016 – Dr. Strange
Kürzlich in Dr Strange. Ein grauenvoll langweiliges zweistündiges Eso-Gelaber in 2 bis 3 D, mit hübschen, zusammenklappbaren Großstädten und vielen Martial-Arts-Motiven.
Als es bei der weisen alten Meisterin Tilda Swinton nach sicher prüfungsreichen 250 Jahren Leben oder so (sie sieht jünger aus) ans Sterben geht, sagt sie ungefähr folgendes:
Nun hab ich so lange gelebt und dachte, ich könnte es einfach lassen, aber am Ende will man einfach nur den Schnee sehen.
Da fange ich an zu weinen.
Bei mir wär‘s nicht der Schnee, aber das Prinzip stimmt natürlich.
Oktober 2016 – konkurrenzfähig
Heute eine Frage von 1und1:
Ist Ihre Website noch konkurrenzfähig?
Ich verstehe die Besorgnis.
Ja, ich teile die Besorgnis!, denn die Frage lässt sich ja ausdehnen auf andere Bereiche meines Lebens.
Ist Ihre Wohnung, Ihre Sexualität, Ihre Bauchmuskulatur, Ihre Persönlichkeit noch konkurrenzfähig?
Sollte, wenn Sie das alles ehrlich mit Nein beantworten können – und Sie sollten diese Frage ehrlich beantworten, das ist der erste Schritt zu einer positiven Veränderung in Richtung Konkurrenzfähigkeit – nicht wenigstens Ihre Website konkurrenzfähig sein?!
Ich lösche die Mail.
Oktober 2016 – Familienaufstellung
Neulich im Zug. auf der Rückfahrt von Hamburg. Mir schräg gegenüber eine Familie:
Eine junge Frau, hübsch, verständig, bisschen sozialpädagogisch, zwei blonde Kinder, ein Junge ca.5, ein Mädchen ca. 3, und ein großer, schlanker junger Mann, ihr aktueller boyfriend, sehr bemüht und empathisch, nicht der Vater der Kinder.
Bereits nach 2 Minuten ist klar: Das wird nervig. Die gesamte Beziehungsdynamik schwappt über den Gang, die Familienaufstellung offenbart sich in peinlich unterdrückter Manier. Ich bekomme Beklemmungen, fühle mich belästigt, als hätte jemand die Grenze in meinen Schutzraum überschritten und frage mich am Ende, warum ich verdammt nochmal nicht einfach aufgestanden und ins ICE Restaurant gegangen bin. Oder zumindest, wie andere schlaue Leute, die Kopfhörer nicht zuhause vergessen habe. Seltsam, wie sich Intimität herstellt in so einer Szenerie. Ich erlebe, erfahre etwas, das ich nicht wissen will, als schaute ich jemandem ins Wohnzimmer, ins Innere seines selbst. Ich hab das Gefühl, ich sehe alles. Ich sehe sie alle, und wurde nicht gefragt.
Die Schlimmste ist, wie meistens übrigens: Die Mutter. Sie mag das Mädchen nicht, ein aufgewecktes Ding. Den Jungen mag sie, aber auch an ihm lässt sie kein gutes Haar. Die Kinder sollen still sitzen und aus dem Fenster schauen. Wie Erwachsene. Sie appelliert an ihre Vernunft. Das geht so lange gut, bis die Brezel aufgegessen und die Apfelschorle getrunken ist. Also bis etwa fünf Minuten nach Einstieg. Die Kinder sind keine Sekunde in der Lage, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Es gibt aber auch keine Bücher, Hörspiele, Daddelspiele, Malblöcke. Und wenn sie sich was ausdenken – das Mädchen spielt irgendwann Verkaufen, steht dazu auf und benutzt die Armlehne als Tresen, den boyfriend als Käufer, eigentlich ganz süß – dann würgt sie sie ab.
Ständig schnalzen ihre Drohungen über den Gang, und ihre noch unangenehmeren Enttäuschungsäußerungen: Mit euch kann man nicht mal zwei Stunden Zug fahren. Der Mann versucht aufrichtig, die Frau nach allen Regeln der Kunst zu unterstützen, die Kinder abzulenken, zu bespaßen. Das hält nie lange, sind sie wahrscheinlich auch nicht gewohnt. Sie droht: wenn sie nicht still sitzen, nicht aufhören, sich zu streiten (ein großes Hobby von ihnen), dann gibt es eine Strafe. Jetzt. Gleich! Beim nächsten Mal!! Die Strafe wird exekutiert: Stehen im Gang. (Ich bin etwas enttäuscht). Das hält die Mutter etwa 2 Sekunden durch, dann steht sie auf, flüstert irgendwas, die Kinder jubeln – und gehen an Mamas Hand wie eine glücklich schlendernde Familie in den Speisewagen. Weitere 2 Sekunden später ist sie zurück mit den beiden, die lieben Kleinen tragen je einen DB-Merchandising Artikel in den Händen. Ich bin verblüfft. Da soll noch einer mitkommen, selbst mir war der Sinneswandel und das Gemütsschwankungstempo zu rasant. Das blöde Hohl-Geschenk hält ebenfalls nur für 2 Sekunden.
Die Frau redet immer mal mit ihrem Freund über andere, Freundin, Bekannte, Kollege. Ihr Grundton: Ich mache so viel, ich bin so anständig, ich kümmere mich um zwei Kinder, ich gehe arbeiten und DIE oder und DER: sitzt sich faul den Arsch platt. So siehts aus. Man kann so gut sein, wie man will, man wird am Ende immer von hinten gefickt. Sogar von den eigenen Kindern.
Das war keine schöne Fahrt mit euch, sagt sie am Ende, das war schrecklich und peinlich, nie wieder möchte ich mit euch Zug fahren.
Da kann ich ihr leider nur zustimmen.
Familie – bringing out the worst in you.
September 2016 – I had this!
Eine der schönsten und traurigsten Geschichten in Transparent ist die von Josh und der Rabbinerin:
Josh, der jüngste Sohn der Pfeffermans, ist glücklich. Mutig und frei von der Leber weg glücklich. Endlich mal! Er hat jemanden gefunden, der dasselbe will wie er: Zusammen sein, ein Leben teilen, ein Haus bewohnen, eine Familie gründen. Eine Frau, mit der er ein Mann sein könnte. Und kein überforderter, sehnsüchtiger, haltloser, unsicherer, verwöhnter, dummer, sprunghafter Junge.
Dass es sich bei der Frau, die er liebt, nun auch noch um die Rabbinerin handelt, macht das Glück auch äußerlich so perfekt, dass es alle zum Lachen bringt. Denn natürlich ist das wie wohl für die meisten jüdischen Familien, auch für die Frauen in Joshs Familie (und nach dem Coming Out des Vaters als „Trans-Parent“ sind ja außer Josh nur noch Frauen übrig) eine Aufwertung, dass ihr Bubbele nun mit einer angesehenen Person der Jüdischen Gemeinde liiert ist. Oh my god, he is fucking the Rabbi! schreien seine Mutter und seine Schwester Sarah begeistert, als sie davon Wind kriegen, und Josh kann nicht anders, als zu lachen vor Stolz und Glück. Es ist, als sei plötzlich der Schleier weg und das Licht da, als habe sich etwas gefügt, und es gibt endlich jemanden, den er liebt, wirklich liebt, und nicht nur anschaut.
Da sind die Belastungen aus Joshs Vergangenheit. Ein fast erwachsener Sohn aus der Beziehung mit seinem viel älteren Kindermädchen erscheint plötzlich auf der Bildfläche. Harter Tobak für Josh und Raquel, so haben sie sich das nicht vorgestellt. Sie werden damit fertig werden. Sie bekommen ein Baby. Aber Raquel ist unruhig. Sie hat eine Liste. Sie will einen Mann, ein Kind, eine Familie, wie es sich gehört, und dazu gehört ein Ring an ihrem Finger. Josh weiß das, versteht das, nickt, sagt, ich kümmer mich drum.
Den ganzen glücklichen Tag lang denkt er darüber nach, wie er ihr einen Antrag macht, welchen Ring er für sie haben will und auch hier fügt sich alles perfekt. Er ist voller Energie, durchdrungen von seiner Idee, seiner Vorstellung. Dann kommt er nach Hause, in das Haus seiner Familie, das Haus in dem er aufgewachsen ist, in dem sie nun gemeinsam leben werden, eine Familie gründen werden. Raquel ist da, sie hat sich ein schönes Kleid angezogen, das Licht gedimmt, Josh, sagt sie, und verschränkt nervös, verlegen lächelnd, die Hände. No, sagt Josh, der ahnt, was kommt, da geht sie schon auf die Knie, No, sagt er, und sie klappt eine Schatulle mit Ring auf, beginnt feierlich zu sprechen, No, wait, sagt Josh entsetzt, versucht, sie aufzuhalten, sie hochzuziehen, sie spricht weiter, steuert auf das zu, was sie hier vorhat, was sie hier tun wird, was sie gleich sagen wird, auf die Katastrophe: Will you… – No! schreit Josh sie an, denn das ist falsch, so ist es falsch, You dont trust me! bricht es aus ihm heraus, der sich plötzlich und auf ewig beraubt sieht, seiner Vorstellung von diesem Antrag, seiner Liebe zu dieser Beziehung, seines inneren Bildes, dessen Realisierung er so sehr gebraucht hätte. I told you, I had this! fügt er hinzu, sagt es hinunter auf die am Boden kauernde Raquel, die weiß, was sie angerichtet hat,
I had this!
Es dauert noch ein bisschen, aber kurze Zeit später sind sie getrennt.
September 2016 – 3M14T – Romance
T. nimmt mich mit auf seinem Elektroroller.
Wir fahren ans Wasser und schwimmen.
Ich hab die ganze Zeit Angst.
Dass alles nicht stimmt, aber es ist mir egal.
September 2016 – Tote Tiere
Es ist doch so: Die ganze Stadt ist voller Tiere. Voller Vögel zum Beispiel. Die sitzen in Parks rum, brüllen um 5 Uhr morgens von den Bäumen runter, kacken von Dächern, latschen im Cowboygang über die Hauptverkehrsader, wohnen auf Müll-Haufen und frühstücken Croissants im Cafe. Füchse. Laufen nachts auf der Straße an einem vorbei. Mäuse. Huschen über die U-Bahn-Schienen. Ratten. Kruscheln hektisch im Gebüsch, halten inne, Auge in Auge mit dir und deinem Sushi aus dem Plastikschälchen, das du gerade auf einer Bank am Alex verspeist.
Ein Leben also, ein blühendes, sichtbares Leben allüberall auf den Tannenspitzen! – aber ein Sterben? Wo zur Hölle sterben diese ganzen Viecher? Klar, ab und an sieht man mal den ein oder anderen Vogel zermatscht auf der Straße liegen oder sich mit inneren Todesprozessen auf dem Gehweg krümmen – Verkehrsunfall, Lebensmittelvergiftung, das sind die Kollateralschäden des Großstadtlebens, das kennen wir auch.
Aus dem Nest gefallen – okay, vom (einzigen) Fressfeind (der Innenhof-Katze, die will nur spielen), zerfleddert – klar. Aber diese dramatischen Tode sollten doch, wie bei uns, eher die Ausnahme sein. Was ist mit den natürlichen Toden? Mit den Herzinfarkten, den Schlaganfällen, den tödlichen Krankheiten, der Altersschwäche? An irgendwas müssen diese Tiere sterben. Und zwar ständig. Aber: Wo? Wo?, frage ich euch.
Müssten wir nicht, wo wir gehen und stehen auf tote Tiere treten? Müssten wir nicht dauernd über Tierleichen steigen, auf dem U-Bahn-Gleis, am Fahrradständer, auf den Stufen zum Cafe, sie mit der gleichen routinierten Haltung quittieren wie Obdachlose, schon wieder einer, welche Karte ziehen wir, höflich beiseiteschieben oder komplett durchignorieren?
Ich meine, das sind doch Tier-Massen! Die müssen irgendwo sein! Die Nestdichte hier ist so groß wie in keiner anderen Metropole Deutschlands, Ratten sind ne Plage, Mäuse erobern die Altbau-Wohnungen, Krähen schließen sich zu Gangs zusammen und essen den Eichhörnchen die Nüsse weg. Jeder Hipster-Vogel, der was auf sich hält, zieht hierher, um auf die gemeine Dummtaube runterzuschauen, die blöde gurrend wegen einem Schrippe-Krümel unter den Bus gerät, weil sie zu blöd ist, das Großstadttempo zu kapieren, zieh doch nach Marzahn, Alter.
Oder haben diese ganzen Tiere irgendwo im Untergrund ein gut organisiertes Geheimsystem aus Palliativstationen, Beerdigungsinstituten und Friedhöfen? Effektives und diskretes Ableben je nach Status garantiert, so wie bei uns. Wo sind all die toten Tiere hin? Wo sind sie geblieben? Hat die Wissenschaft da was übersehen? Wurden da Forschungsgelder wegen Lobbyarbeit für die falschen Studien ausgegeben? Und jetzt komm mir keiner mit: Die gehen zum Sterben in den Wald. Das ist ja wohl total sozialromantisch. Ich meine, in welchen Wald denn bitte? Der ist doch viel zu weit weg. So ein Mitte-Vogel schafft‘s doch grade mal in den Weinmeisterpark. Und wer will schon im Görli sein Leben aushauchen? Oder sich im Tiergarten aus Kondomen ein Sterbebett bauen?
Dann lieber gleich auf die Verkehrsinsel. Da hat man wenigstens seine Ruhe.
September 2016 – Smartspur
Dauernd renn ich in Leute rein oder krieg eine reingerannt, weil ich oder die anderen plötzlich mitten im Laufen abstoppen, um auf dem Handy was zu suchen, zu tippen, zu daddeln. So ist das. Man bräuchte so langsam mal zwei Spuren auf den Gehwegen, eine zum Laufen und eine für Handygeschäfte. Eine Smartspur.
September 2016 – Wackelpudding
Ich träume, ich halte mein Leben in den Händen. Es ist weich und hellrosa und hat die Konsistenz von Wackelpudding. Es trieft mir zwischen den Fingern durch.
September 2016 – 3M4T – Tacheles
T. und ich reden viel Tacheles.
Manchmal müssen wir dabei lachen.
September 2016 – Wedding
Ich steig Rehberge aus und lauf die Müllerstraße rückzus. Innerhalb von 3 Minuten auf einer Quadratmeterdichte von höchstens 5 Kubik sehe ich im Sekundentakt:
_eine schwarze Frau mit einem leuchtend blau gefärbten Afro, die sich mit ihrer Freundin, einer Rollator-Oma am Draußentisch einer Bäckerei unterhält (Ilse, die könn mich mal, echauffiert sie sich bei 1-Euro-Kaffee, wahrscheinlich übers 1-Euro-Amt)
_eine Kopftuch-Mami im mausgrauen Biederlook, die in einem SUV sitzt, so hoch wie ein Doppeldeckerbus, und mit quietschenden Reifen um die Ecke schießt als wär sie Hot in Quatar
_drei Refugee-Jungs zwischen 14 und 19, die sich gegenseitig darin überschlagen mir praktikumsmäßig einen Cappuccino und eine Zeitung (Die ist von heute!) an den Cafétisch zu bringen,
_eine Frau mit Komfortfahrrad, Birkenstocks und Öko-Shampoo-Haaren, die, ischwöreman!, als sie ich vom Rad abschließen umdreht, einen kraus gewachsenen Kinnbart präsentiert als wär sie ein Neukölln-Hipster!
Damn it!! Vielleicht ist im Wedding noch Berlin?!
September 2016 – Vexierbild
Jeden Tag laufe ich am Schaufenster eines Ladens vorbei. Darin ein Bild, eine Fotografie. Schwarz-weiß. Aus dem 19. Jahrhundert, schätze ich.
Es zeigt eine junge Frau. Sie sitzt nackt auf einem Stuhl, den Oberkörper über den Tisch vor sich geworfen, das Gesicht in Schmerz und Gram auf den Unterarmen verborgen. Das ist das Wort, das einem einfällt: Gram.
Geht man am Bild vorbei, bemerkt man, dass es sich verändert, dass es kippt. Betrachtet man es von der anderen Seite, sieht man denselben Frauenkörper, auf demselben Stuhl, in derselben Pose. Doch nun ist die junge Frau ein Skelett.
September 2016 – 11W6T – Freiheit
Mit der Freiheit des anderen ist jederzeit zu rechnen.
August 2016 – Männerdilemma
Seit Köln HBF – natürlich schon zuvor, doch jetzt, wo zur eh schon komplexen gender-Gemengelage auch noch die Ebene des Rassismus hinzugekommen ist, noch weit mehr – stecken Männer in einem Dilemma, um das sie nicht zu beneiden sind.
Nehmen wir an, ein Mann beobachtet in der U-Bahn, dort passieren diese Dinge gern, wie eine Gruppe Männer, jung, mit Migrationshintergrund, Frauen belästigen. Sagen wir: verbal belästigen. Blöde Sprüche, dummes Glotzen, lautes Lachen, Pfeifen, Schnalzen, das ganze übliche, übergriffige, (noch) nicht physische Repertoire des Belästigens, das sich in Sekundenschnelle atmosphärisch unangenehm über den ganzen Waggon ausbreitet und alle in Befangenheit erstarren oder unbeteiligt und taub tun lässt, über und unter ihren Kopfhörern, als wäre plötzlich jemand eingestiegen, der Heil Hitler ruft.
In dieser Situation muss der ANDERE MANN,
der höflich, zuvorkommend, gar solidarisch sein möchte,
WEIL er Freundin, Frau, Freundinnen, Mutter, Tochter, Schwester hat, und diese als Menschen und Gegenüber erlebt und begreift, weil er nicht zu denen gehören will, die Frauen etwas antun, generell nicht, aber schon gar nicht auf der Ebene sexueller Gewalt,
WEIL er nicht teilnehmen möchte an ihrer Sexualisierung, ihrer Reduzierung auf ihr Geschlecht, weil er sie nicht objektiviert und ausgebeutet sehen möchte, ohne dass sie sich – zumindest soweit man im Rahmen kapitalistischer Verhältnisse davon sprechen kann – selbstbestimmt und selbstbewusst dafür entschieden haben und/oder dafür bezahlen lassen, wie zum Beispiel im Porno, den er auch mal schaut, oder im Puff, in den er auch mal geht,
WEIL er den Frauen in einer Situation, die er empathisch nachvollziehen kann, zur Seite stehen möchte, eingreifen möchte, sie nicht allein lassen möchte – denn diesen Anspruch hat er an sich, als Mensch und als Mann, das gebietet, so findet er einfach, das allgemein menschliche, nicht nur weiblich-männliche Miteinander, landläufig auch der Anstand genannt –
in dieser Situation jedenfalls muss der ANDERE MANN
erstmal abwarten. Und sehen, wie die Sache sich entwickelt.
ABZUWARTEN bleibt nämlich, ob, zum einen,
anwesende, nicht direkt von der Belästigung betroffene Frauen aktiv werden und eingreifen – was eine fast optimale Entwicklung der Situation darstellen würde, erhebt sie die gesamte Situation doch augenblicklich zu einem Diskurs, zu etwas Gesamtweiblichem, zum Solidaritätsthema und schafft einen Gegen-Raum, in dem Frauen ihre Sache gemeinsam in die Hand nehmen,
ABZUWARTEN bleibt zum anderen, ob die Frau sich überhaupt belästigt fühlt, oder womöglich geschmeichelt (denn sowas gibts, und auch wenn davon nicht viel zu halten ist, wäre dies nicht der Moment, in eine Diskussion darüber einzusteigen), eventuell also positiv auf die Belästigung eingeht, so dass der ANDERE MANN sie mit einem beherzten Eingreifen in die Situation ihrer selbstbestimmten Sexualität, ihres lustvollen Vergnügens berauben würde,
ABZUWARTEN bleibt vor allem aber auch, und davon muss vom ANDEREN MANN schon aus feministischen Gründen ausgegangen werden, ob die Frau sich nicht prima selbst gegen die BEDROHUNGS-MÄNNER verteidigen kann, was sein Eingreifen zu einem paternalistischen Verhalten machen könnte, zu einem Verhalten, das davon ausgeht, dass Frauen sich weder verbal noch physisch wehren können, Opfer sind, und auf die Hilfe des Mannes angewiesen sind, der sich hiermit womöglich selbst zu Held und Retter stilisieren möchte, um seine identitäre Männlichkeit für sich aufzuwerten oder womöglich sogar gegenüber den belästigten Frauen zur Geltung und in Anschlag zu bringen.
JEDOCH, die Sache des Belästigens ist ja schon von vorneherein ein gender-Ding und trägt deshalb in sich immer schon eine Gerichtetheit, und zwar eine Gerichtetheit nicht nur vom Mann zur Frau, sondern auch eine von den BEDROHUNGS-MÄNNERN auf den ANDEREN MANN, eine innere Ansprache findet da statt, eine indirekte Frage wird da gestellt, eine Provokation gesetzt, eine Forderung aufgestellt, eine Annahme getroffen, bist du einer von uns, du bist doch einer von uns, das hier ist das männliche Normverhalten, und wir gehen mal davon aus, dass du diesem entsprichst, dich loyal verhältst, mit uns, denn du bist einer von uns, ein BEDROHUNGS-MANN wie jeder andere, oder? Oder?? …
und hat nun, als wäre das mit dem gender-Diskurs nicht alles schon schwierig genug, auch noch den ganzen Rassismus an der Backe. Denn er trifft ja auf eine Gruppe Männer, von der er aufgrund von Äußerlichkeiten annehmen kann, dass sie einer anderen, höchstwahrscheinlich islamisch geprägten Kultur entstammen, in der die Welt der Männer weit weg ist von der der Frauen, in der sie einen Alltag kennen und leben, in dem Frauen keine figurbetonte Kleidung tragen, in der Frauen, ihre Körper und ihre Lust daran, nicht in Erscheinung treten. Er erlebt diese Männer – denen er Verständnis und Solidarität entgegen bringt, die er als tendenziell ausgegrenzte, vom System zur Chancenlosigkeit verdammte Existenzen begreift, die hier, in diesem Land, mit ihren höchstwahrscheinlich von Migration, von Flucht geprägten Biografien, nur geduldet sind, zur Stumpfheit, zum Warten und Vergehen verdammt – als bedrohlich.
So sitzt er also in der U-Bahn, der ANDERE MANN, konfrontiert mit der hochgradig komplexen Situation der Belästigung, und was soll er jetzt tun, der ANDERE MANN? Was? Und mit welcher Geste?Soll er sich zu den Frauen stellen, neben sie oder vor sie? Soll er die Klappe halten und sitzen bleiben und den Diskurs laufen lassen wie er eben laufen wird, sind ja alles erwachsene Menschen mit ihren eigenen Entscheidungen, noch ist niemand verletzt, oder?, keine Opfer zu verzeichnen? Soll er die Polizei rufen, die Sache ins Öffentlich-Institutionelle auslagern? Soll er den Bedrohungs-Männern entgegen treten und sagen: Sowas machen wir hier nicht, und damit paternalistisch, kolonialistisch, didaktisch und eventuell zumindest diskutierenswert respektlos gegenüber ihrer Kultur auftreten oder den Anschein erwecken, er verteidige „die deutsche Frau“, seine deutsche Frau? Soll er ihnen eine reinhauen? Oder soll er sich an die seltsam altmodisch wirkende, west- oder gar nur nordeuropäisch geprägte, an die CSU und Mutti erinnernde, zweifelhaft moralische und unpräzise Kategorien des Anstands oder des Allgemeinmenschlichen halten, die da sagen, so geht’s nicht, da muss jetzt mal einer was sagen, hier in der U-bahn, und zwar auch und am besten bitte
ein anderer Mann?
August 2016 – 9W4T – Herzwerte
Meine Herzwerte stimmen nicht. Kein Witz. Meine Hausärztin schickt mich in die Klinik. Sie hat Angst, ich hab ne Lungenembolie. Ich nicht. Ich liege in der Rettungsstelle der Charite auf einem Bett und in meiner linken Armvene bohrt eine Schwester nach Blut (die rechte war gestern bei der Hausärztin dran), das tut weh und sie kriegt keinen Zugang hin, blöde Kuh, den werd ich eh nicht brauchen.
Links ein Vorhang, vor mir ein Vorhang, dahinter Schattentheater. Ich kann die komplette Anamnese plus halber Biografie einer alten Dame aus Ludwigshafen mit anhören, inklusive der Verlegung eines Blasenkatheters. Vielleicht mach ich mal ein Hörspiel draus, ich mache eine Notiz. Ich muss dringend aufs Klo (vielleicht war zu viel vom Blasenkatheter die Rede), aber erst als die Ärztin und die Schwester weg sind, trau ich mich an der Dame vorbei auf den Gang. Sie lächelt mich an und hat jetzt auch noch ein Gesicht zur Herzklappen-OP rechts vor drei Jahren, und den seit Wochen nässenden Beinen.
Da ist so ein Putz-Typ, der hat schon dreimal am Zimmer vorbeigewischt, immer den Linoleum-Gang runter und wieder rauf. Er glotzt mich irgendwie geduckt gierig an, keine Ahnung, vielleicht weil ich im Bett liege oder so. Perverso! Bestimmt ein Ex-Knacki, der hier nochmal ne Chance bekommt, den Boden zu moppen. Der wischt da landauf und landab und die Toilette ist trotzdem siffig wie ne Bar in Neukölln. Ich! liebe! Desinfektionsmittel! hnfp, hnpf, immer schön aus dem Spender. Hnpffff.Pf. Das ist bestimmt auch gut für die Haare.
Dem hinterm Vorhang neben mir wirds langsam langweilig. Sein Arzt hat aber auch echt nicht so richtig Bock auf ihn. Kurz bevor ich gehen muss, schiebt er den Vorhang beiseite und unterhält sich mit mir über die Bücher auf meinem Kindl – zu meiner Überraschung kennt er alle, sogar The Girls, dieses brandaktuell gehypte Buch von einer Frau über die Frauen aus der Manson-Familie – eigentlich macht der Typ den Eindruck eines Bauarbeiters (möp, sorry, Bauarbeiter-Diffamierung, woher die Annahme, dass die keine FAZ-Rezensionen lesen) mit Niereninsuffizienz (wie gesagt, Vorhang, Hörspiel).
Am Ende bin ich draußen, ohne Embolie. Hätte ich euch gleich sagen können. Ich weiß, warum meine Herzwerte nicht in Ordnung sind!
August 2016 – Pokemon
In meiner Küche steht ein Pokemon. Da drüben, zum Greifen nah auf meinem grauen PVC ein kleines gelbes Ding mit Babybauch und japanischer Punkfrisur. Ich schreie, so ultimativ erstaunlich finde ich das. Ich komme mir gleichzeitig vor wie ein Kind, ein Idiot und ein Greis.
P. hat den das Pokemon da hingestellt. Sein Handy wusste sofort wo ich bin, wo er ist, nämlich in meiner Küche, meiner Wohnung, meinem Haus, meiner Straße, meiner Stadt, meinem Planeten. Ich sehe die Kamerafahrt, rauszoomend.
Ich habe nicht den Impuls das Pokemon zum Kaffee einzuladen, was mich später sehr irritiert. Wie ein kreischender Marine-Offizier befehle ich P. die sofortige Killung, die Abfeuerung desselben! Nach ein paar Anläufen klappt das auch, so leicht sind die nicht totzukriegen. Als es weg ist, bedaure ich das.
Wo ist mein Sammeln hin, meine Gastfreundschaft? Ist es die Struktur, die das vorgibt? Nein, ich wollte es weghaben, bevor ich wusste, dass es darum geht. Es kam so plötzlich, ein Eindringling in meine Privatsphäre. Was, wenn es geklingelt hätte, gefragt, gebeten? Ich hoffe.
August 2016 – 8W4T – der Stand der Dinge
ein mann hat eine affäre. er beendet die affäre und will zurück zur frau. die frau ist bereit, ihm zu verzeihen. da will der mann nicht mehr zurück. er will lieber noch mehr affären haben.
August 2016 – Urban
C. ruft mich an:
J., angereist aus Anlass von Cs. Geburtstagsfeier, angereist nach sehr langer Zeit mal wieder, angereist aus einem früheren Leben, in dem wir drei viel miteinander zu tun hatten, hat ihr eine sms gschrieben: Sie liegt im Urbankrankenhaus mit Herzinfarkt. Ich lasse alles stehen und liegen und fahre hin.
Auf dem Weg dorthin versuche ich sie zu erreichen: Anruf, sms. Keine Antwort. Ich bekomme Angst. Was wenn ich zu spät komme, was, wenn sie stirbt, allein in dieser fremden Stadt, wie kann ich ihren Freund erreichen, der inzwischen ihr Mann ist, und von dem ich nicht mal weiß, wie er mit Nachnamen heißt, was für Schmerzen hat sie gehabt, was erlebt man, wenn man einen Infarkt hat, was bedeutet das für die Zukunft, warum habe ich keinen Kontakt mehr zu ihr, wenigstens lose, eine Gratulation zum Geburtstag, da bricht man sich doch keinen Zacken aus der Krone, bei allen Animositäten, die es zwischen uns auch gegeben hat. Sie ist 47 Jahre alt, das geht doch nicht. Das geht gar nicht.
Ich laufe aufs Urban zu. Da wandeln sie herum, die Patienten (die ja immer auch Wartende sind, auf Besserung, den weiteren Verlauf, die nächste Untersuchung, die Erlösung, auf was der Arzt sagt) oder sitzen in ihren Rollstühlen, in ihre Hemdchen gesteckt, die Beine ab, die Haare dünn, die Gesichter bleich, Beuteltiere, die ihren Urin, ihre nässenden Flüssigkeiten, ihre tropfenden Medikamente an Stangen, auf Schößen, an Haltevorrichtungen mit sich herumtragen wie Verlängerungen ihrer selbst. Die, begleitet von Freunden oder Söhnen oder Cousinen oder allein die paar Schritte ans Kanalufer gehen, aufs Wasser schauen, auf dem Bänkchen in der Sonne sitzen, in ihr Handy reden, auf Schwäne und gesunde Menschen gucken und unbekümmert aussehen und doch so bekümmert sein müssen, man sieht ja nie rein, in die Menschen. Die sich ein bisschen gute Zeit abtrotzen, ein Momentchen haben hier, bei dem schönen Wetter, denn um den geht es doch, um das Momentchen, Leben, Trost, Normalität, mitten zwischen den Schmerzen, dem Tod, seinem Wahnsinn.
Sie liegt auf der Intensivstation, sagt man mir an der Rezeption. Das macht die Angst nicht kleiner. Ich sehe Schläuche, bleiche Haut, piepsende Geräte. „Da dürfen Se erst ab drei hin“. Das sind noch anderthalb Stunden. Ich eile herum, kaufe Blödsinn ein, den ich eh noch einkaufen muss, und überlege, was ich ihr mitbringen könnte. Blumen, Zeitschriften, Schokolade, darf man Süßes essen nach einem Herzinfarkt, was wenn ich da stehe, mit meinen Blumen und dem ganzen Scheiß und sie ist gestorben, sind Blumen auf Intensivstationen überhaupt willkommen, herrscht da nicht allerhöchste Hygienealarmstufe? Ich entscheide mich für eine Sonnenblume, die ich leicht kürzen lasse.
Punkt 15 Uhr betrete ich die Klinik erneut, suche mir meinen Weg auf die Station, fasziniert wie immer vom System Krankenhaus als atmendem, geradezu städtischem Organismus wie aus einem Science Fiction Film.
Auf der Station muss ich klingeln, um eingelassen zu werden („Schleuse“). Als ich den langen Gang hinuntergehe (Linoleum), schiebt sich ein paar Meter vor mir von rechts ein Bett aus dem Quergang, darin ein frisch Operierter, schwer krank, gerade so noch am Leben, gleitet wie ein Geisterschiff vor mir nach links, gelenkt von einem ungerührten Gondelfahrer im Kittel. Weg ist es, das Geisterbett, verschwunden im Nebel. Ich muss noch ein paar Gänge weiter links rechts.
Ich nutze jede Gelegenheit, mir die Hände zu desinfizieren.
Ich finde J. im hinteren Teil eines Zweibettzimmers, schlafend. Sie wacht auf, als ich mich neben sie setze. Sie ist da, wach, freut sich, umarmt mich, wirkt nur leicht angeschlagen, ich nehme für einen Moment ihre Hand. Sie erzählt, was passiert ist. Seit Monaten Schmerzen in der linken Schulter, Brust. Dachte, es ist was Muskuläres. (Sie macht einen Knochenjob.) Keine Zeit, kein Geld (Freiberufler, vorübergehend keine Krankenversicherung), sich drum zu kümmern. Gestern im Auto (allein) von München nach B, schon während der Fahrt irgendwie schlimmer (und wenn sie ihn im Auto gehabt hätte, den Infarkt). Abends dann: ein paar Schlucke Wein beim Übernachtungsfreund, nachts dann: Notarzt.
Sie ärgert sich, es waren wirklich nur ein paar Schlucke, nicht, wie die Sanis (4 Schränke, ich sehe ein Foto wie sie vor ihr stehen, J. gestikulierend auf einem Sofa), ihr was unterstellen wollten, Alkoholismus. Alle sehr schnell, kompetent, nett. Heute Morgen haben Sie ihr einen Herzkatheter gelegt (Kanülen in Handgelenk, Ellbogen), sie konnte zugucken, auf dem Monitor, wie sie sich durch ihren Arm bis in ihr Herz vorgetastet, und ein Stent gesetzt haben. Jetzt geht es ihr wieder gut, sie fühlt sich wirklich ganz gut.
Der Pfleger, mit der schnorchelnden frisch operierten Halbleiche hinterm Vorhang beschäftigt, hört jedes Wort, das wir sprechen, meint, es ihr sagen zu müssen, nachdem er mir eine Vase für die Sonnenblume gebracht hat: Sie rauchen, hab ich gehört? Sie wissen, dass es da einen Zusammenhang gib. J. weiß es. Es ist nicht so, dass ihr der Gedanke nicht auch schon gekommen ist. Sie macht ne Kotzgeste als der Typ wieder weg ist.
Sie raucht, seit ich sie kenne. Ich kenne sie seit dreißig Jahren. Sie hat ihre Morgenkippe im Frühstücksei ausgedrückt, in der Küche unserer WG, ich hab mit ihr zusammen gewohnt in meiner ersten Alleine-Wohnung, mit 18. Sie war wichtig für mich. Sie war immer stark, hart im Nehmen und Austeilen, zynisches Weltverhältnis, abgebrüht, ein Brocken, und sehr lieb. Die beiden Salz- und Pfeffer-Schweine aus Holz, eins dicker und größer, das andere schmaler und kleiner, die ich heute noch habe, sind von ihr, aus dieser Zeit. Sie ist mir fremd und trotzdem nah. Ich kenne ihre Haare, ihre Bewegungen, ihren Körper, der über die Jahre schlanker geworden ist, dem sie Gewicht abgetrotzt hat, ich sehe ihre Haut, ihre Nägel, wie sie gestikuliert, sich wehrt, gegen die latenten empörenden Vorwürfe die man ihr macht. Was sieht sie, wenn sie mich anschaut? Sie ist jetzt mit F. verheiratet, sie zeigt mir Bilder vom Häuschen, das sie umgebaut haben, ich freue mich sehr, alles sieht gut aus, schön, nach ihr, ihr selbst, angekommen, glücklich, stabil, alles.
Das ist mir zu früh. Mir ist das alles zu früh. Ich dachte, ich muss erst in zwanzig Jahren zu jemand ins Krankenhaus fahren mit Herzinfarkt. Ich mag diese Vorboten nicht, diese Vögel, die vorbeifliegen, die sich eines Tage einnisten werden, in unsere Leben, ihre Schnäbel in uns bohren werden, nicht mehr weggehen, sich niederlassen werden, um zu bleiben bis zum Schluss.
Als ich im Aufzug wieder runterfahre, steigt ein Arzt ein, weißer Kittel, Gesundheitsschuhe, sonore Stimme. Er grüßt nickend, drückt den Knopf, das Handy am Ohr. Ja, Dr. Meier hier, ich rufe an nochmal wegen dem Patienten mit den Hodenprothesen.
Herrgottnochmal, Leute, Ärzte, Schwestern, Pfleger, Linoleumbodenwischer, wie könnt ihr da nur arbeiten? Wie könnt ihr das nur alles aushalten, diese schrecklichen, schrecklichen Dinge, wie könnt ihr darüber reden als wäre das nichts, als wäre es normal, ein Sachverhalt, kein magenzerrender, angstmachender Supergau. Diese ständige Bedrohung, diesen Tod, der überall lauert, das Leiden, das so präsent ist in den Krankenakten, als wäre es die Regel und nicht die Ausnahme. Ich meine, ich verstehe das Prinzip, natürlich, das pragmatische Angehen, aber ich verstehe nicht, wie man so leben kann. Was würde ich drum geben, eine Krankenschwester zu sein, so ein Typus zu sein, der seine festen Arbeitszeiten hat, der seinen Job gut macht, den Leuten das Essen reicht, ihnen den Moment erleichtert, mit einem aufgeschüttelten Kissen, der die Notwendigkeit einer Blutabnahme oder einer Tablettengabe einsieht, nach vorne schaut, denn man kann hier auch gesund werden, denkst du denn daran gar nicht, nein., und am Ende der anstrengenden Schicht nach Hause geht, und sich freut, dass dort alles seinen Gang geht.
Zwei Tage später wird J entlassen. Sie taucht auf dem Geburtstagsfest auf wie geplant. Sitzt ihr der Schreck in den Knochen, in den Gliedern, im Herzen? Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sehen. Macht sie weiter wie bisher, ist es nicht plötzlich das größte Glück, weiterzumachen wie bisher oder ist es Zeit etwas zu ändern und das ist das Glück? Was macht man mit so einer Erfahrung?
Ich weiß es nicht.
Ich bin einfach nur unendlich froh, dass ich da war.
August 2016 – 4W5T – Drive
Ich höre Drive von Boy.
Ich stelle mir vor, ich sitze neben T. in einem Auto. Er fährt.
Wir lassen etwas hinter uns (rear window).
Wir fahren auf etwas zu (front window).
Es läuft Musik. mit Text.
Ich fühle mich sicher. Ich lasse los. Ich schaue ihn an. Ich darf das alles.
Er schaut zurück.
Wir lächeln.
August 2016 – 2W5T – Wut
Meine Wut kracht durch die Decke.
Die Schädeldecke.
Die wie vielte Phase ist das, frei nach Elisabeth Kübler-Ross?
Juli 2016 – 2W4T – Die Passantin
Leute sehen mich im Vorübergehen.
Ich trage einen Rock oder eine Hose.
Ich komme aus dem Supermarkt.
Ich warte an Ampeln.
Ich weiche Radfahrern aus.
Ich sitze im Cafe und lese Zeitung.
Einen Augenblick lang bin ich da.
Dann bin ich vorüber.
Juli 2016 – 2W2T – Vogel
Ich rede auf meine Spiegelbilder ein wie ein Wellensittich. Ich diskutiere, erkläre, wüte, wäge ab, antworte, frage, und empöre mich.
Juli 2016 – 18 Jahre
Hat die Globalisierung eine verlorene Generation (vor allem) junger Männer hervorgebracht? Unterscheidet sich der 18jährige arbeitslose Grieche vielleicht gar nicht so sehr vom 18jährigen Kriegsflüchtling aus Syrien vom 18jährigen Wanderarbeiter aus Beijing vom 18jährigen Drogendealer aus Baton Rouge vom 18jährigen Amokläufer mit IS-Veredelung?
Juli 2016 – Metallteile
Beim wie vielten werde ich aufhören zu sammeln.
Ansbach
Juli 2016 – Axt
Da ist er, der erste Anschlag. Ein kleiner noch.
Würzburg
Juli 2016 – Lorna oder: Beinbruch
In Orange is the New Black (OITNB) gibt es eine wunderschöne Szene über die Liebe.
Lorna bekommt Besuch von Vince, ihrem Ehemann, den sie über eine Knast-Brieffreundschaft kennen gelernt hat. Vince ist ein süßer, lieber Junge, Italo-Amerikaner wie sie. Die beiden haben im Gefängnis geheiratet. Lorna trug einen weißen Schleier aus Papier zu ihrer unförmigen Gefängniskleidung, und war so glücklich wie wir sie viele Folgen lang nicht gesehen hatten. Die beiden haben im Anschluss zum ersten und einzigen Mal miteinander geschlafen – dank einer Aufseherin, die weggesehen hat.
Nun sitzen Lorna und Vince einander gegenüber im Besucherraum, den alten, verschlissenen Holztisch zwischen sich, die no-touching!-policy im Nacken, die der Wachmann an der Tür bereit ist, umgehend heraus zu bellen, wenn jemand sich zu weit vorwagt. Und um die beiden herum trennen viele weitere Holztische andere khaki-farben gekleidete Insassinnen von ihren Besuchern. Wie soll man hier, an diesem Ort, in dieser Situation, seine Liebe leben?
Nun muss man über die zierliche Lorna (die wir nie ohne tiefrot geschminkte Lippen, sorgfältiges Make-up, und 40er Jahre Frisur sehen) wissen, dass ihr Glaube an die Liebe groß ist. Nie ist sie es müde geworden, ihren Mitinsassinnen in schillernden Farben von ihrer großen Liebe Christopher zu erzählen, vom romantischen Kennenlernen, vom Sex, den sie miteinander haben (praktisch eine spirituelle Erfahrung), von seinem Antrag, ihrer Verlobung, den Details der bevorstehenden Hochzeit, vom Haus, in dem sie leben, von den Kindern, die sie bekommen werden, von der unbedingten Treue, die sie sich geschworen haben, und die sie einander halten werden bis zum Tod (dass sie sich von ihrer Mitinsassin Nichols ab und an mal lecken lässt, zählt für die katholische Lorna nicht). Manchmal, so scheint es, kann sie beim Erzählen selbst kaum fassen, dass ihr Prinzessinnentraum wahr geworden ist.
Eines Tages kommt ans Licht, dass Lorna (unter anderem – ein bisschen Internetbetrug kommt auch noch hinzu) wegen Stalkings eines Mannes namens Christopher, mit dem sie ein einziges Date hatte, wegen Eindringens in seine Privaträume, wiederholten Brechens der von ihm erwirkten Restraining Order, und einem Mordversuch an ihm und seiner Freundin im Knast sitzt. Sie bricht zusammen.
Lorna also, das kann man sich nun vorstellen, ist gewillt, ihre neu gewonnene und mit anrührender Aufrichtigkeit begonnene Liebe zu Vince, hier, in dieser Situation, an diesem Tisch zu leben. Sie beginnt langsam und mit verführerischer Stimme ihm über die Distanz des Tisches hinweg zu erzählen, dass sie ihn berührt, wie sie ihn berührt, wie er sie berührt, was das mit ihr macht, wie sie sich für ihn anfühlt, und was das in ihm auslöst, und wenn Lorna eine Sache gut kann, so gut kennen wir sie inzwischen, dann ist es, bild- und detailreich Liebe und Sexualität zu beschwören. Und so kommen die beiden schließlich, in Anwesenheit von Aufsehern und Besuchern – und der Einhaltung des Buchstabens des Gesetzes, sich nicht zu berühren, zum Orgasmus.
Natürlich ist diese Szene eine wundervolle Hommage an eine der berühmtesten Szenen der Filmgeschichte: Sally beweist Harry in „When Harry Met Sally“ anschaulich, dass Frauen sehr wohl in der Lage sind, überzeugend einen Orgasmus vorzutäuschen. Auch diese beiden haben dabei einen Tisch zwischen sich – allerdings im Diner.
Vor allem aber ist diese Szene – wie Lornas Figur insgesamt – eine große Erzählung über die Liebe. Liebe ist Projektion, sagt man. Man könnte argumentieren, dass es das ist, was hier eindrücklich veranschaulicht wird. Aber stimmt das? Sollen wir annehmen, dass der Sex zwischen Vince und Lorna nicht wirklich stattgefunden hat, dass er eingebildet war, weil sie sich nicht berührt haben? Sollen wir annehmen, dass Lornas Liebe zu Christopher der überzogene Affekt einer Borderline-gestörten Persönlichkeit ist, und nicht wahrhaftig, groß und aufrichtig, und von einem Wissen geprägt, zu dem Christopher einfach keinen Zugang hat? Sollen wir es überzogen finden, dass Lornas Leben und Persönlichkeit, alles was sie ausmacht, zusammenbricht, als man ihren fantasmatischen Raum durchkreuzt, und ihr vor Augen führt, dass ihre Liebe zu Christopher nichts gewesen ist als eine brutale Lüge?
Die Liebe ist kein Beinbruch. Nein. Doch sie sitzt in unseren Körpern und Leben und folgt dort Gesetzen, die uns heilen, retten oder an denen wir zugrunde gehen können.
Juli 2016 – 1W5T – Haiku
Es regnet.
Das kürzeste Haiku
der Welt.
Juli 2016 – Türkei
Wir werden an diese Tage zurück denken, als die, an denen die Türkei zur Diktatur umgebaut wurde, und niemand in Europa oder den USA etwas dazu zu sagen hatte, außer: Wir unterstützen die demokratisch gewählte Regierung Erdogan.
Und ich hab’s verpasst, nach Istanbul zu fahren. Das kann man jetzt erstmal vergessen, für eine laange Zeit.
Juli 2016 – 1W4T – bam
Mein I love Malaga-Schlüsselanhänger ist kaputt gegangen.
Ich hab T. mit meinem Schlüssel beworfen, da ist der Anhänger abgefallen.
Vor zwei Jahren sind sie schon mal zusammen im Bett gewesen.
Warum er mir das jetzt, in der Stunde der Wahrheit, wo alles auf dem Tisch ist, wo er mir gesagt hat, dass er zurück will, nicht erzählt hat? (sondern D dafür gesorgt hat, dass er es zugeben musste.)
Er dachte, wir haben es dann einfacher, wieder zueinander zurück zu finden.
Der Schlüsselanhänger liegt jetzt unter einem Busch im Monbijoupark. Wer ihn findet, kann ihn auf ebay versteigern.
Juli 2016 – 1W3T – Linienstraße

Ich finde einen Troststern.
Juli 2016 – 1W2T – Dissoziation
Ich steig jetzt emotional einfach mal aus.
Im globalen Zusammenhang betrachtet ist das doch eh alles pipifax.
Ich koppel mich ab und reite davon, in den Sonnenuntergang der kapitalistischen Erderwärmung.
Juli 2016 – 1W2T – Blocker
Können die ihre Geschichten nicht besser abstimmen?
Ich such jetzt im Netz mal nach einem Mailblocker.
Juli 2016 – 1W2T – Verbotene Liebe
So langsam Seifenoper.
Eigentlich ganz unterhaltsam.
Juli 2016 – 1W2T – Gefahr
D schreibt mir noch eine Mail.
In der sagt sie mir.
Dass sie und T. vor zwei Jahren schon mal was miteinander hatten,
Danach immer wieder,
Bis zu den letzten beiden „intensiven“ Monaten (wieder dieses schöne, assoziationsreicheWort),
Dass er ihr seit Jahren seine Liebe offenbart, ihr nahezu hinterher gerannt ist und dass sie nun
raus möchte, aus diesem Albtraum mit jemandem, der nicht zu sich stehen kann,
Dass sie keine Gefahr mehr darstelle.
Dass, wenn sie nicht gewesen wäre, ich heute noch nichts davon wissen würde,
dass er ein Spiel gespielt hätte, mit uns beiden, das er noch jahrelang weiter getrieben hätte.
Dass ich nun, da ich alles weiß, auf dem freien Feld entscheiden kann.
Juli 2016 – 1W2T – Körperfresser
Wie zwei Spulwürmer sind sie in meinen Kopf und meinen Körper gekrochen und haben dafür gesorgt,dass alles was ich dachte, was ich wusste, woran ich geglaubt habe, angefressen ist, zersetzt und ausgehöhlt.
Und ich weiß nicht, wie ich sie da wieder rauskriegen soll.
Juli 2016 – 1W2T – Mail
T. schreibt mir eine Mail.
Er hat lange für sie geschwärmt, war aber nie verliebt, vor zwei Monaten hat er zum ersten Mal zugelassen, dass was passiert, hat sich verliebt, konnte nicht mehr raus, hat es laufen lassen.
Das Schlimmste was er je gemacht hat, es tut ihm leid, es ist vorbei, er hat es beendet, er ist nur noch erleichtert.
Juli 2016 – 1W2T – kalt gestellt
Ich halte mich am liebsten in Tiefkühlabteilungen auf.
Der Schmerz macht so viel Hitze.
Juli 2016 – 1W1T – transparent
D schreibt mir eine Mail.
In der sagt sie mir.
Dass sie es nicht forciert hat.
Dass sie verliebt ist.
Dass sie immer dafür war, dass er sein
„jahrelanges emotionales Werben“ um sie
mir gegenüber transparent machen soll,
nicht erst in den letzten zwei Monaten als es zwischen ihnen
„intensiver“ wurde.
Dass sie mich schätzt.
Dass sie mir viel Kraft wünscht.
Juli 2016 – 72h – zurück
Er sagt, er will zurück.
Wohin zurück?
Juli 2016 – 72h – sprachlos
Jetzt weine ich eigentlich nur noch.
Juli 2016 – 72h – raus
Es ist D.
Ähnlicher Typ, ähnlicher Schwierigkeitsgrad.
Er hatte gar keine Affäre.
Er hatte eine Beziehung.
Juli 2016 – 48h – berührt
Das Schlimmste wird sein, dass niemand mehr meine Brüste berührt.
Ich kann mir nichts Einsameres vorstellen.
Juli 2016 – 48h – Instructions
Achte auf Körper- und Dentalhygiene. (Auch wenn du dir das jetzt noch nicht vorstellen kannst, es kann jederzeit sein, dass dir jemand begegnet, der mit dir Sex haben will. Schneide die Haare an deiner Möse besonders sorgfältig, es könnte sein, dass die andere Frau das besser gehandhabt hat.)
Es gibt Menschen, die nett zu dir sind. Nimm das an.
Masturbiere. Wenn du dabei weinen musst, weine, dann mach weiter. Wenn du nicht weißt, wen du dir vorstellen sollst, denk an Mark Wahlberg.
Sei verwirrt. Das ist keine Schande. Im Gegenteil, es ist eine Superkraft.
Sage nichts ab. Geh zu allem.
Nimm Psychopharmaka. Die machen dich glücklich und die Schmerzen sind nicht mehr so stark.
Triff jeden Tag mindestens einen anderen Menschen zu dem du Sichtkontakt hältst und gegenüber dem du den Mund aufmachst, um Worte raus zu lassen.
Kaufe sehr viel Weißbrot. Bau dir ein Bett daraus und lass dich hinein sinken. Achte darauf, dass die Kruste außen ist.
Juli 2016 – 48h – Traum
Ich küsse, S., einen gemeinsamen Freund, während er Auto fährt. Es fühlt sich genauso an wie mit T. S. fährt dabei einfach immer weiter. Ich sehe immer wieder mal auf die Straße. Da liegen drei Leute rum, wie nach einem Motorrad-Unfall, der in der Mitte ist tot, verdreht, sieht aus wie bei Zombie-Highway. S. fährt einfach drüber ohne ihn zu berühren. Hast du gesehen, sage ich, da lag ne Leiche. Nee, sagt er.
Wir küssen uns nochmal, ich bin sehr froh und erleichtert, dass es gut geht und genau wie mit T. ist. Ich weiß, dass S. mit J. (anderer Freund) geschlafen hat. Ja, sagt er, den haben sie mir zum Geburtstag geschenkt. Dann bist du jetzt der lachende Dritte, sage ich. Ja, sagt er, und lacht.
Wir sind in einer Bar. Die Frau mir gegenüber am Tisch reicht mir Pillen auf ihrer ausgestreckten Hand. Kleine blaue, hellrosa und weiße Pillen, wie aus Keramik. Die sehen aber hübsch aus, sage ich. Ja, sagt sie. Sie ist mir ganz nah, ihre Hand mit den Pillen bei mir, ich atme und lutsche dabei ein Jasminbonbon. Sie setzt sich zurück mit diesem angenehmen Lächeln, das sie hat. Plötzlich fängt sie an, schwer zu atmen. Sie ist allergisch auf das Jasmin, das aus meinem Atem kam. Ihre Freundin bringt sie schnell raus.
Juli 2016 – 48h – Hollywood
Im Film bauen die Frauen nach sowas immer ihr Leben um. Das wird dann ganz großartig und viel besser als bisher, weil sie nach Indien reisen oder einen Pferdehof übernehmen.
Dass einem das Leben immer als lebenswert verkauft werden muss, wo man geht und steht.
Juli 2016 – 48h – Problem
C. sagt, ihr müsst mal reden.
Ich will nicht reden.
Ich will das alles vergessen, ich will dass die Schmerzen weggehen. Ich will ihn küssen und mit ihm schlafen und Witze machen. Ich will, dass das alles ein schlechter Traum ist und ich aufwache.
Das alles wird Monate dauern. Wenn wir uns trennen, Jahre. Wer will sich damit beschäftigen? Ich nicht. Was für eine sinnlose Idiotie.
Wenn ich wenigstens verstehen würde, wo das Problem war. Warum er das gemacht hat. Warum er diese Beziehung so schrecklich fand, dass er da raus musste. Durch die Affären-Hintertür. Oder gehts darum gar nicht?
Du spinnst, sagt C. Auch du hattest ein Problem.
Juli 2016 – 48h – Prozent
Ich sitze zwei Stunden lang bei einer Tasse Tee an einer Kreuzung und schaue alle Männer an, die vorbeikommen. 99,99 Prozent aller Männer möchte ich nicht berühren.
Juli 2016 – 48h – Job
Was würde ich jetzt geben, um einen Job, der mich körperlich und mental so fertig macht, dass ich keine Zeit habe, nachzudenken oder nachts aufzuwachen. Vielleicht frag ich die Bauarbeiter da drüben, ob ich mitarbeiten kann.
Juli 2016 – 48 h – klar
Ich hab immer gedacht, wenn es passiert, dann ist alles ganz klar. Dann gehe ich. Nichts ist klar.
Juli 2016 – 48h – Wechseljahre
Ich wusste, dass das eines Tages passiert. Ich dachte nur, es passiert etwas später, wenn ich in die Wechseljahre komme.
Juli 2016 – 48h – Management
Ich weiß gar nicht, wie er das hingekriegt hat. Bei all dem Job-Stress, den er hatte. Aber so ist das, Affären setzten unglaubliche Manneskräfte frei. Auch bei meinem Vater waren da ja alle voller Bewunderung.
Juli 2016 – 48h – Kondom
Hat er ein Kondom benutzt?
Vielleicht benutzt er eins, gerade jetzt.
Juli 2016 – 48h – Paranoia
Wer ist es? Wer weiß es? Wer hat es die ganze Zeit gewusst?
Im Kopf hab ich in Sekundenschnelle alle Frauen durch, die T. so kennt, die wahrscheinlichen und die unwahrscheinlichen. In den nächsten Stunden wiederholt sich das in unendlichen Schleifen. Ich bin sicher, es ist jemand, den ich kenne. Ich bin sicher, ich habe mit dieser Person in den letzten acht Wochen gesprochen, ich war nett zu ihr und sie zu mir. Ich bin sicher, wir haben uns angelächelt, und ein paar Worte gewechselt. T. hat das nicht verhindert.
Ich bin sicher, ich habe in den letzten acht Wochen mit Menschen geredet, die gewusst haben, dass T. eine Affäre hat. Die haben mir ihre Gesichter freundlich vors Gesicht geschoben, was sollen sie auch sonst machen, und hinter ihren Stirnwänden hatten sie Informationen aus der eigentlichen Realität und die haben runtergelächelt auf mich, die leider von nichts ne Ahnung hat, und dabei haben sie sich sicher ein bisschen unangenehm gefühlt. T. hat das nicht verhindert.
Schlimmer noch: Wer von meinen Freunden und Vertrauten weiß was? Wen kann ich anrufen, mit wem kann ich reden, ohne mir den nächsten Tiefschlag abzuholen, weil ich spüre, dass sie es wissen, weil sie mir sagen, dass sie es wissen, weil sie mir sagen könnten, wer es ist und sie nur mit diesem Geheimnis in ihrem Kopf und ihrem Dilemma in den Augen mit mir reden können. Vertrautes Land – Feindesland. T. hat das nicht verhindert.
Ich sitze hier wie ein Vollidiot. Isoliert und aller Gewissheiten beraubt. Und T. hat das nicht verhindert.
Juli 2016 – 48h – vermissen
Vermissen bis zum Phantomschmerz. Sogar in meiner Vagina zieht es.
Juli 2016 – 48h – Schlussakkord
Wenn jemand den Schlussakkord spielt, dann steht man auf und geht, oder?
Man sitzt noch einen Moment da und hält inne und lauscht nach. Dann klatscht man, weil es großartig war. Und dann steht man auf und geht.
War das der Schlussakkord?
Juli 2016 – 48h – Matrix
Wir hatten Sex, wir waren auf dem Erdbeerfeld, wir waren essen, wir haben Spargel gekocht, wir haben unseren Genitalien Namen gegeben und darüber gelacht. Wir haben den Balkon gelobt, über Pläne im Sommer nachgedacht, uns in Entscheidungen und Gefühle einbezogen, seine Veranstaltungen besucht, seine Mutter gesehen, wir haben uns mit Freunden getroffen. Wir haben im Cafe parallel gearbeitet. Er hat Stress gehabt. Wir haben uns gesagt, dass wir gut aussehn. Wir haben uns angenervt, gestritten, zusammengenommen, vertragen. Wir haben Dinge für uns getan. Wir haben über Politik diskutiert. Und in all dieser Zeit hat er
Seinen Schwanz in eine andere Möse gesteckt. Hat Haare gestreichelt, in Augen geschaut und Füße betrachtet. Hat Brüste berührt. Seine Zunge in weiche Höhlen gesteckt. Gerüche gerochen. Ist richtig gut gekommen. Hat richtig gut gefickt. Hat Neues gelernt. Hat verglichen. Hat Gefühle entwickelt. Hat verglichen. Hat darüber nachgedacht, wer besser ist und bei wem er bleiben soll. Hat mir nicht die Möglichkeit gegeben, das Gleiche zu tun. Hat Minority Report gespielt mit mir und meiner Wahrnehmung, meiner Realität. Das Erdbeerfeld gibt es gar nicht. Das ist alles die Matrix in der ich gefangen bin, weil er es so bestimmt hat.
Juli 2016 – 48h – verstehe
Ich verstehe das.
Ich verstehe, dass man nach 15 Jahren denkt, man will in diesem Leben auch nochmal jemand anderen nackt sehen. Mal wieder verliebt sein. Jemanden mal wieder so richtig toll finden. Sich toll finden lassen. Seinen Schwanz mal wieder woanders reinstecken. Mal wieder merken, dass sich noch andere Leute für einen interessieren. Dass man’s noch hinkriegt, sich jemandem zu nähern. Dass man nicht komplett vergessen hat, wie man das macht. Mal wieder neu sein. Für sich. Für andere. Ich verstehe das.
Mein Magen ist ungefähr so groß wie eine Pflaume, genauso hart und fest.
Juli 2016 – 48h – erstaunt
Im ersten Moment bin ich einfach nur erstaunt. Ich bin vollkommen, wirklich völlig bass erstaunt. Ich bin so erstaunt, dass mir die Luft weg bleibt. Ich schnappe nach ihr, nochmal und nochmal, wie ein Fisch, den man an Land geworfen hat, und krieg keine. Ich starre aus meinem Gesicht raus und weiß, da sind irgendwelche Löcher drin, die irgendwas durchlassen müssten, aber da kommt ein solcher Schub aus Temperatur und Rauschen von innen hinten, dass der Schub und die Löcher nicht zueinander finden, das eine passt nicht durchs andere, nichts hat mehr miteinander zu tun, auch nicht mit der Haut und ihren Poren, auch nicht mit dem Skelett, das alles zusammenhält.
Ich gehe auf den Balkon, da ist die Luft besser. Dann geh ich wieder rein.
Ich bin sehr gefasst.
Eine Affäre.
Juni 2016 – Virus
Versteh einer einen Virus.
Der Virus an sich grassiert ja gerne. Er taucht einfach irgendwann irgendwo auf. Wie er sich gebildet hat, woher er eigentlich so plötzlich kommt, warum er sich auf Kotzerei und Durchfall spezialisiert, ob er eine Neuerfindung ist und wo die gemacht wurde – keiner weiß es. Er ist einfach plötzlich da und stürzt sich auf alle im Büro oder der Kita. Er lässt sich von Mensch zu Mensch schleudern, schmieren oder schieben, und wütet dann dort z.B. in den Eingeweiden. Er feiert eine Vermehrungsparty, dass es einem in den Ohren rauscht, bevor er dann langsam, ganz langsam nachlässt. Er fällt den Antikörpern zum Opfer, offensichtlich eine Truppe bis an die Zähne bewaffneter Spezialeinheiten, die ihn scannen, erfassen und besiegen, und er sucht das Weite, bzw lässt sich bequem, z.B. von mir, mit easyjet von Portugal über Frankreich nach Deutschland fliegen, um sich dort neue Opfer zu suchen. Oder er bleibt noch eine Weile im Belüftungssystem sitzen und steigt gar nicht erst mit aus. Am Ende verschwindet er einfach, zurück in das seltsame Nichts aus dem er gekommen ist. Und er wird nie zurückkehren, jedenfalls nicht in dieser Form. An einem geheimen Ort arbeitet er an seiner Modifizierung.
Juni 2016 – Atlantik
Der Atlantik ist anders als die anderen Meere. Also zum Beispiel anders als die Nordsee oder das Mittelmeer. Das Mittelmeer ist ne Pissbrühe gegen den Atlantik (und im übrigen inzwischen auch ein Massengrab)! Das Wasser des Atlantik ist so klar und so kalt und so salzig, dass du merkst, der hat schon ganz andere Sachen gesehen. Der kann dir Geschichten erzählen, von Dinosauriern, Meteoriten und dem Urknall. Der Atlantik ist nichts für schwache Gemüter. Der Atlantik erinnert dich daran, dass du auf der ERDE bist, also auf einem Planeten, also in einem Universum. Der Atlantik ist so kalt, dass er in deinen Kopf reinknallt.Der ruft dir in Erinnerung, was du bist, und wenn du nur gerade mal den Fuß reinstreckst in einen seiner ruhigsten, zahmsten, befriedetsten Ausläufer in einer hübschen kleinen portugiesischen Bucht, weißt du: Du bist ein Nichts. Und wenn du nur ein bisschen weiter raus schwimmst, und die Strömung spürst, und eine leise Andeutung davon bekommst, was Gezeiten bedeutet, dann schwimmst du schnell wieder zurück an Land und legst dich auf den herrlichen sattgelben Sand.
Juni 2016 – M.
Wenn du Alzheimer hast, ist es so. Da bringt dich jemand, von dem du dir nicht sicher bist, ob er wirklich weiß, was er tut und über alles informiert ist, in ein Haus, das du noch nie gesehen hast und setzt sich mit dir an einen Tisch und bestellt dir einen Tee. Und du weißt gar nicht, ob du das alles möchtest, und das so richtig ist, aber der Tee ist erstmal ganz gut und die Dame die ihn bringt, ist auch ganz freundlich, und dann erklärt dir die Person, dass alles in Ordnung ist und gleich noch die ganzen anderen Leute kommen, aber damit kannst du nichts anfangen, weil du nicht weißt, warum ausgerechnet hier, wo es ja fremd ist und noch gar keiner da, und wer denn nun genau und vor allem wann, ja wann? In einer halben Stunde. Aber das ist ja jetzt. Wenn der Zeiger hier ist. Aber irgendwie bleibt dir auch nichts anderes übrig, als da zu sitzen und den Tee zu trinken, denn um zu Hause zu sein, oder woanders, dazu müsste ja ein Auto kommen und dein Mann.
Juni 2016 – Die Patin
L. fragt mich, ob ich Patin werden möchte. Ich freue mich sehr, bin aber auch überrascht. Ich bin weder in der Kirche, noch religiös, das weißt du, sag ich. Er: Macht nichts, Pfarrer (katholische Kirche) locker, alles kein Problem.
Kurze Zeit später schreibt meine (evangelische Paten)Tante: Sie freut sich, dass mal wieder jemand getauft wird, ihre Enkelkinder hatten das alle nicht, und ich Patin, toll! Ich denke, ja, aber vielleicht nochmal klar stellen: Ja, freu mich auch sehr, finde das einen schönen Gedanken, zwei Menschen, Figuren, die man so einem Kind an die Seite stellt, die nach ihm schauen, eine Verbindung zu ihm aufnehmen, werde das auf meine Weise interpretieren, denn: Ich bin ja nicht religiös und auch nicht in der Kirche, ne? (ausgetreten mit 18)
Dann denke ich: Was schreib ich das meiner Tante, schreib ich doch mal lieber L., wie ich die Patenschaft verstehe, und ob das so klar geht mit ihm, ihnen, dem Pfarrer.
L.: Ja. Danke für Deine Worte. Genau.
Kurz vor der Taufe, ich hab inzwischen viele Stunden damit verbracht aufgeregt ein sehr ideelles Taufgeschenk zu basteln, bittet mich L. am Telefon eine Taufkerze mitzubringen und die schnell zu bestellen, sonst haut das nicht mehr hin. Sie waren im zwei wochenendlichen Taufkurs, außerdem will er nochmal mit mir den Ablauf durchgehen, das scheint ihm besser. Er meldet sich am WE nochmal.
Es scheint ihm besser.
Ich kaufe schnell die säkularste Kerze, die ich finden kann (Leuchtturm, schön). Als wir uns endlich wegen des Ablaufs erreichen – am Vorabend meiner Abfahrt dorthin – er ist müde und fertig von der vielen Arbeiterei – liest er mir am Telefon vor, was ich sagen muss. Ich muss also doch was sagen. IN einer Art ritualisiertem lautem Dialog zwischen Pfarrer und Eltern/Paten. Bei „Wir erbitten die Taufe“ gehe ich noch mit, bei „Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria“ verschließt sich langsam mein Magen, ein Kreuz soll dem Täufling von den Paten auf die Stirn gemalt werden, und als dann noch das Wort vom Satan fällt, dem ich wiedersagen soll, und vor dem ich das Taufkind beschützen soll, da platzt es spontan aus mir heraus: L., das pack ich nicht.
L. organisiert in aller Hektik und Anspannung einen anderen Taufpaten.
Ich weine bei T. am Telefon. Wieso nur, nimmt mich das so mit? Mein Bruder hat sich etwas gewünscht von mir, etwas, was ihm wichtig war, und ich konnte es ihm nicht geben. Vielleicht auch. Er wollte mich drin haben, in dieser Familie, und ich hab es wieder mal vorgezogen draußen zu bleiben.
Wir haben es beide geahnt, wir haben es beide hinausgezögert bis zum letzten, traurigen Moment. Ich respektiere seine neu gewonnene Nähe zur Kirche. Ich kann nicht so tun, als hätten diese Zeremonien keine Bedeutung und seien nur eine bürokratische Hürde. Wenn ich das Glaubensbekenntnis gesprochen hätte vor versammelter Mannschaft, und gesagt hätte, ich wiedersage dem Satan, dann wäre ich dort zu Staub zerfallen wie ein Vampir. Was wäre ich für ein Vorbild für meinen Neffen.
Der Pfarrer in der Kirche gibt sich alle Mühe, offen und tolerant zu wirken. Er erklärt Bedeutungen und ihre Entstehungsgeschichte.
Ich weiß von der ersten Sekunde an: Es war die richtige Entscheidung.
Ich werde eine gute, ideelle Tante sein.
Juni 2016 – Demolition
Demolition gesehen. Vielleicht ist das Kino ja auch einfach tot.
Juni 2016 – OMGyes
Auf einer Seite im Internet erklären Frauen, wie sie einen Orgasmus bekommen.
Die Seite ist hell, modern und freundlich, die Frauen lustig, nett, normal und selbstbewusst. Ein paar Auszüge aus den Videos kann man sich anschauen, bevor man bezahlen muss. Auf den Videos sieht man, in aufklärerischer aber warm gefilmter Frontalaufnahme sowie sanften, verspielten Blicken auf Brüste, Hände usw., wie sie masturbieren und dabei erläutern, was sie tun.
Alter Schwede, ist das kompliziert. Dreimal links rum, einmal rechts rum, dann etwas schneller, aber nicht zu sehr und kurz vor knapp bitte aufhören.
Und jede was anderes!: Also ich habs am liebsten so, ahja?, nee so könnt ich ja gar nicht.
OMG, die armen Jungs.
Juni 2016 – Spatz gerettet!
Ich will mich ja nicht selber loben, aber heute hab ich einen Spatz gerettet.
Ich sitze im Cafe, einem dieser Kettencafes, vornehmlich von Touris besucht (ich hatte das bereits weiter unten erwähnt, dass es mich dort manchmal hinzieht), und arbeite. (tippe ins Laptop, und sie nannten es Arbeit). Dieses Kettencafe hat zwei, bei der Hitze offen stehende Glastüren (praktisch die gesamte Außenwand besteht aus bodentiefen Fenstern), die sich diametral gegenüber liegen und viele Croissants. Aus dieser Gleichung ergibt sich: Spatzenhorden halten sich hier auf. Heute nicht. Dass das komisch ist, fällt mir erst in dem Moment auf, in dem einer reinsaust, ein Einzelheinz, und sich im Karacho den Kopf an der Fensterscheibe anschlägt. Er sinkt zu Boden und ich denke schon, er ist hin. Nein. Er schreit lautlos (schnabel offen, kleine Zunge raus) und guckt belämmert. Kapier ich nicht, denkt er. Hier geht’s doch raus. Er versucht es nochmal und nochmal das Fenster hoch, panisch flatternd, dann nochmal, nach kurzer Bedenkzeit, mit Anlauf – Boing!, erneutes Schädel-Trauma.
Scheiße, ich kann mich doch jetzt nicht um den kümmern, die sind hier eh nicht gern gesehen, was soll ich mich da jetzt in die Spatzenwelt einmischen, die hier normalerweise prima zurecht kommt, gleich kommt der nächste, helf ich dem dann auch, ich will arbeiten, lass mich in Ruhe, du kleiner Blödmann.
Kein Kumpel da, um ihn zu unterstützen, ihm zu erklären, wo’s hier rausgeht. Jetzt sitzt ein anderer seiner Sorte draußen, auf der anderen Seite des Fensters. Betrachtet die Misere. Der von innen ist noch verwirrter. Ja, das ist schwer zu verstehen, kleiner Spatz. Er sitzt im Knast, im Glasknast. Draußen ist drinnen und andersrum. Da kann man schon mal schreien und dreimal Dünnschiss auf den Boden machen. So, jetzt reichts. Genug Brain-Place für ihn aufgewendet. Ich nehme erst mein Buch – iiih, nee, wenn er da drauf kackt, der Berliner-BazillenSpatz – ich nehme eine Zeitung des Hauses, knicke sie, lasse ihn draufhüpfen, macht er auch, nach drei nachdrücklichen Aufforderungen, ich trage ihn in Richtung offener Tür – Freiheit, raus ist er im straight Flug. Mannmannmann. Wieso bedenkt niemand die Auswirkungen bodentiefer Fenster auf die Spatzenwelt.
Kurze Zeit später sehe ich einen anderen zur einen Tür rein, geradeaus mit Karacho durchs Cafe zur anderen Tür wieder raus fliegen, wie ein Profi. Also entweder meiner war sehr jung oder extra doof.
Juni 2016 – behindert
T. und ich haben gerade angefangen im Wasser des kleinen Müggelsees Beachball zu spielen. Ein Junge, ca. 10, kommt wasserspritzend angerannt, stürzt sich mit einem Flatsch auf den Ball, der gerade zwischen uns im Wasser gelandet ist, und schwimmt damit weg. Fehlt bloß noch, dass er mit dem Schwanz wedelt. T. und ich gucken doof. T. genervt: Ey! Und will ihm hinterher. Kommt ein Mädchen angehüpft, splash splash, durchs Wasser, bis auf Höhe des Jungen. Was machst du?, fragt sie den Jungen. Ich zu ihr: Kannst du ihm mal sagen, er soll den Ball zurückgeben (bevor T. ihm eine reinsemmelt). Gib!, sagt sie zu dem Jungen. Der rückt augenblicklich den Ball raus. Der ist behindert, sagt das Mädchen zu uns, und gibt uns den Ball. T. und ich gucken irritiert. Ist der jetzt wirklich behindert? (Er sieht gar nicht so aus.) Und wenn ja, wie? Besteht die Behinderung darin, dass er denkt, er ist ein Hund? Oder ist das einfach der neuste kleine-Strolche-Trick: Unverschämt sein und dann sagen, der ist behindert, damit sich keiner aufregen kann? Oder meinte sie einfach das, was wir auch dachten: Voll behindert, der Typ.
Ich nehme mir jedenfalls vor, mir das zu merken und demnächst mal irgendwo anzuwenden: Ich mach was Bescheuertes und sag dann, ich bin behindert. Oder ich bitte T. darum, es zu sagen, der macht das bestimmt gerne.
Juni 2016 – Männer und Tee
Der Wasserkocher sprudelt. Willst du einen von deinen Blümchentees? fragt T. laut über ihn drüber. Ja, sage ich, und greife zum Kräutertee. Und du,? Wie immer deinen Hardcore-Dickschwanz-Tee? Ich reiche ihm den schwarzen.
Juni 2016 – Vom Fleck
Ständig diese Klischee-Träume vom nicht vom Fleck kommen. Danke, Unterbewusstsein. Für die Info. Wär ich jetzt nicht selber drauf gekommen.
Juni 2016 – Junge in der Ubahn
Ein Junge in der U-Bahn spricht mich an. Er fragt mich, ob ich ihm helfen kann, eine Fahrkarte zu kaufen, er muss neun Stationen fahren, sagt er. Aha, sage ich und helfe ihm. Mein Eindruck ist, er kann das eigentlich. Nicht vergessen zu stempeln, sag ich noch, dann trudele ich den Bahnsteig runter, warte auf die Bahn. Er kommt hinterher geschlappt, macht ne Kurve um eine Säule, dann taucht er wieder vor mir auf. Mein kleiner Freund. Offensichtlich in Plauderstimmung.
Er will wissen, was für ein Handy ich hab. Samsung. Er auch! Was für eins. Ich: keine Ahnung, GT irgendwas. Ham sies dabei? Ich: Ja. Und rühre mich nicht. (misstrauisch, will diese Berliner Rotzgöre mich beklauen?) Zeigen sie mal. Ich hol mein Handy raus, er seins – Handyvergleich. Seins ist größer, gebe ich unumwunden zu. Das findet er gut. Wir steigen in die Bahn. Er fragt, wie alt ich ihn schätze. Ich gucke ihn an. Er geht mir bis zum Schlüsselbein (und ich bin klein, wie wir alle wissen). Ich sage: neun? Er lacht auf. Was? Nee ich bin vierzehn! ich bin vierzehn und rauche. Ach deshalb bist du so klein geblieben, sag ich. (ganz schön frech). Wir steigen in die Bahn. Ich beweis es Ihnen, sagt er. Er öffnet seine Gürteltasche einen kleinen, konspirativen Spalt breit, darin eine durchsichtige Tupperbox mit losen Zigaretten. Glaub ich dir nicht, sag ich, dass das deine sind. Die sind bestimmt für deinen Onkel oder Vater oder wo du jetzt hinfährst. Für seinen Opa, gibt er schließlich zu. Dann zeigt er mir noch seinen Bizeps am rechten Arm (weicher Babyspeck). Ich muss raus. Junge, allzeit gute Fahrt, denke ich, und: hoffentlich quatschst du immer die richtigen Leute an. Ich nehme mir vor, mit meinem Freund G. darüber zu sprechen, er ist Kinder- und Jugendpsychologe.
Juni 2016 – Coaching
Ich habe einen Termin bei einer Coaching-Agentur.
(Die Arbeitsvermittlerin im Jobcenter, (ja, back to Hartz), hat mir einen Gutschein für ein Coaching gegeben. Es muss eine anerkannte Einrichtung sein, schwups, wird’s bezahlt. Ich muss das nicht machen, ist freiwillig.)
Außentemperatur heute: 33 Grad. Hier drinne: 36 Grad. Um den Tisch sitzen außer mir noch zwei andere versprengte Scheiter-Gestalten (neun sollten es insgesamt sein, ein paar Hitzetote sind offenbar zu verzeichnen). Der Mann, der heute die Offene Sprechstunde abhält, also eine Infoveranstaltung über die Agentur und was sie so machen und wie das so läuft ist ein Mann, 60plus, mit blauer Brille und nuscheligem Grundton. Seine Performance ist nervig schlecht, alles was er sagt, wissen wir schon von der Website.
Eine Frau, groß, schlank, blond, weißer breitkrempiger Hut (!), rotes Kleid (!), hohe helle Tango-Schuhe, setzt sich 15 Minuten zu spät und äußerst schlecht gelaunt mit an den Tisch, und spricht, als Garnitur zu ihrem Auftritt, mit osteuropäischem Akzent.
Der Coach erzählt in langweiligem Tonfall von Alfred Adler, blauen und roten Typen (wenn sie rot sind, dann können sie gut verkaufen) und dem energokybernetischen Konzept, das sie in ihrer auf Medienschaffende spezialisierten Agentur anwenden. Auf seine Frage am Ende seines Referats zum Absatz Inhaltliches, ob es dazu noch Fragen gäbe, bevor er dann in die organisatorischen Details gehe, sagt die Frau: Ich bin nur interessiert an Einzelcoaching. Er wiederholt, dass er erstmal wissen will, ob das alles verstanden worden sei, dann käme er wie gesagt zu den Konditionen. Sie: Ja, weil ich dachte, das wäre hier ein Einzelcoaching, an Gruppe bin ich nicht interessiert. Die Gruppe guckt pikiert. Baby, wir sind hier alle wegen Einzelcoaching, aber das ist ne Info-Veranstaltung, kein Grund die Gruppe zu haten.
Er erklärt ihr die Situation – wie ich sprachliche Missverständnisse vermutend – dass es sich heute um eine Info-Veranstaltung handelt, deshalb Gruppe. Die Coachings: Selbstverständlich Einzelcoachings.
Dann holt er wieder aus, faselt weiter von den tollen Coaches, die sie haben, die dann flexibel auf die Leute, je nach Bedarf, losgelassen werden. Sie unterbricht, sagt etwas, was keiner versteht, muss dreimal wiederholen, ich verstehe Vorsingen, versuche ihr beizuspringen: Sie meinen, ob hier auch aufs Vorsingen vorbereitet wird? Nein, sagt sie zu mir mit einem kleinen, spitzen, verächtlichen Schnauben: Vorbereitet bin ich. Sie häuft weiter rudimentäre Sätze auf, bis wir alle mit einem erleichterten AAAh! schnallen, dass sie Termine zum Vorsingen vermittelt bekommen möchte. Sie fügt hinzu, dass es in Berlin skandalös ist, weil die Termine bei Theatern und Opern nicht online stehen und man nicht weiß, wann man vorsingen kann.
Nein, erklärt der Langweiler ausschweifend, Vorsingen vermitteln sie nicht, aber sie helfen ihr, jemanden zu finden, der das tut. Er preist seine Coaches an, die alle aus der Medienbranche kommen: Musikproduzentin, Filmemacherin, alle mit Alfred-Adler- und Individualpsychologie-Ausbildungen, eine Diplom-Psychologin gar, langjährige Erfahrung, Kontakte, vielleicht ein Showreel für sie….bla.
Ich erinnere mich an eine Freundin, die Berlin mal als Hauptstadt des Coachings bezeichnet hat, hier coachen die Coaches die Coaches. Mein Eindruck: Das Jobcenter hat jahrelang Geld für die Coaching-Ausbildungen dieser Leute ausgegeben (nämlich u.a. der ewig prekären Medienschaffenden, die hier gerade um den Tisch rumsitzen, und jetzt muss es aktiv beweisen, dass Coachings ein sehr wichtiger Faktor für eine erfolgreiche Arbeitssuche sind, und sich die Investition gelohnt hat, und viel weniger Leute als früher Coaching-Ausbildungen machen müssen. Deshalb hauen sie gerade Coaching-Gutscheine raus wie warme Semmeln.
Und deshalb sitze ich jetzt hier mit dieser bis an die Haarkante frustrierten Hartz-Lady, die nicht fassen kann, was für eine narzisstische Kränkung ihr in diesem Leben zuteil wird, wo sie doch so ein schönes und talentiertes Mädchen ist und die Welt und das Universum das nicht sehen und finanziell anerkennen wollen. Ey, frag mich mal! Frag mal alle, die hier am Tisch sitzen, den stoischen Typen hier neben mir, mit den Tattoos, vielleicht Cutter oder Kameramann oder die kleine freakige Spanierin da drüben, die so grantig guckt, wegen dem was man ihr hier abverlangt, hallo? Meinst du, du bist die einzige frustrierte Zicke auf der Welt? Musst du deshalb den Betrieb aufhalten und alle, aber wirklich alle über die Maßen an deinem Frust teilhaben lassen, die Situation so wenden, dass es nur um dich, wie immer endlich mal nur um dich geht? Es ist gleich elf, ich hab auch noch was anderes vor heute.
Der Coach erklärt, dass es einen weiteren Termin geben wird, an dem die Interessierten versammelt werden und dann erzählen, was sie brauchen und was sie machen und dann wird ein Coach ausgesucht. Und das ist dann der erste Termin des Coachings. Aha. Mhm. Also noch ein Gruppensammeltermin an dem alle außerdem auch noch ihre private Geschichte auspacken müssen? (er: Das hat sich sehr bewährt. Aha.). Ich beschließe spätestens jetzt, mich noch woanders umzuschauen, an Angeboten mangelts ja nicht gerade, siehe oben.
Jetzt wird die Spanierin rabiat (wenigstens die müsste die Hitze doch gewohnt sein). Wie können Sie denn nach zwei Sätzen über mich darüber urteilen, was ich brauche (wir alle haben einen Zettel ausgefüllt, mit Beruf, Ausbildung, und unseren Wünschen an ein Coaching). Ihre Frage ist berechtigt, auch wenn sie wiederum auf einem wahrscheinlich sprachlich induzierten Missverständnis beruht, sie hat nämlich nicht verstanden, dass die Coaches erst nach dem Kennenlern-Gruppentermin verteilt werden. Aber muss sie sie so aufs Äußerste empört und keifig stellen, dass allen anderen die Stimmung und der Tag auf jeden Fall auch versaut wird? Leute, was ist denn los mit euch? Das Arbeitsamt bietet euch ne Möglichkeit, die ihr ergreifen könnt oder auch nicht. Freiwillig, keine Sanktionen. Ist das das Schlimmste auf der Welt, passieren in anderen Ländern auch solche himmelschreienden humanen Katatstrophen?
Da sitzen sie und fühlen sich gegängelt und getriezt, vom Jobcenter, schlecht behandelt, und von unwürdiger Serviceleistung angegriffen und ich denke, bin ich jetzt ein rechtskonservatives Arschloch, dass ich finde, man kann das hier mit Anstand über die Bühne bringen und ohne die eigene Scheiße (und ich weiß, dass es scheiße ist, believe me, guys), flächendeckend auf alle Anwesenden auszubreiten?
Nachdem auch dieses Spanierinnen-Missverständnis lang, breit und erfolglos vom Coaching weggenuschelt wurde, erklärt er, das Coaching geht über 40 Unterrichtseinheiten. Uff, das ist echt ein Haufen Zeug. Wer braucht sowas, um am Ende zu wissen, dass er nicht der rote Typ ist?
Die Polin (Tschechin, Russin, Slowakin) fragt daraufhin, schlau, provokativ und stolz darauf, wie viel Geld er eigentlich für uns bekommt. Okay. Ein bisschen Respekt zolle ich ihr dafür, das ist ne Forderung nach Transparenz, die ich gut finde, aber schon wieder diese unendliche Verachtung für Mensch und Tier in Blick und Stimme?
34 Euro die Stunde, sagt der Coach, offen und prompt. Und fügt hinzu, das ist nicht viel, bedenkt man die langen Ausbildungen und vielfachen Kompetenzen der Mitarbeiter.
Die Polin schnaubt schon wieder. Eine Gesangslehrerin (und schon sind wir wieder bei ihr) verdient 12 Euro die Stunde, eine Putzfrau 10 Euro, da findet sie es schon komisch, dass er 34 Euro wenig findet. Er: Eine unserer Coaches ist Diplom Psychologin, das werden sie doch nicht mit einer Putzfrau vergleichen wollen!, andere Coaches verlangen viel mehr, seit Jahren Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt, immer gutes Feedback, usw. blabla. Die Polin setzt nochmal an – mir reicht‘s jetzt, es ist viertel nach elf. Ich rede laut und deutlich über ihren ego-narzistischen Sermon und zusätzlich noch über den dünkelhaften, vom Arbeitsamt geförderten Coach drüber: Niemand hat gesagt, dass es auf der Welt gerecht zugeht, man muss das doch innerhalb eines Marktes sehen, 34 Euro für Coaching finde ich nicht viel, bedenkt man, dass Coaches in großen Firmen sicher sehr viel mehr verlangen, außerdem worüber reden wir hier, sie muss es ja nicht aus eigener Tasche bezahlen, oder?
Hab ich gerade den Coach verteidigt – er versucht es so aussehen zu lassen, indem er sich bedankt. Dass er genauso ein Depp ist, die Putzfrau zu beleidigen, die im Übrigen heute auch lange Ausbildungswege hinter sich hat, und in der Ukraine Hirnchirurgin war (zu der könnten sie allesamt mal gehen und sich operieren lassen), und ein Studium heute sicher keine Garantie mehr für einen Job oder ein anständiges Einkommen ist, oder dass es sowieso schon immer zynisch und menschenverachtend war und ist, dass irgendjemandes Lebens/arbeitszeit mehr Wert ist als die von anderen, dazu komme ich nicht mehr. Die Veranstaltung löst sich nach meiner Intervention schnell auf. Wir vier Teilnehmer fahren schweigend im Fahrstuhl nach unten.
Der einzige, der die ganze Zeit kein Wort gesagt hat, ist der Typ mit den Tattoos. Er hat uns Zicken machen lassen.
Juni 2016 – einige Gedanken zum Brexit
1. Oh dear
2. Erstmal ne schöne Tasse Tee
3. Sieg des Rechtspopulismus
4. Jede Börsenhysterie ist nichts als die Vorfreude auf die nächste Hausse
Juni 2016 – Orlando
So, jeder durchgeknallte Amokläufer (danke Amerika für deine Bürgerrechte, die es jedem erlauben eine Waffe zu besitzen), der sich besser mal frühzeitig auf die Couch gelegt hätte, um mit seiner Homosexualität klar zu kommen (danke Religion, für deine Fähigkeit, die Leute zu verkorksen), kann sich jetzt adeln, indem er sein Tun einfach dem IS unterordnet, kann sein weirdes, armseliges Psychoding jetzt einfach zur ganz großen Sache erklären – und der IS möbelt damit im Gegenzug seine Referenzliste auf. Super Deal.
Juni 2016 – Und, guckst du EM?
Okay, jetzt ist wieder EM und ich frage mich so langsam, wieso hat eigentlich keiner ein Problem mit Fußball? Sind doch sonst immer alle so schnell dabei, wenn’s um Korrektheitsverhalten geht. Man darf nicht bei Primark kaufen, bei amazon, keinen unzertifzierten Tunfisch verspeisen, kein Gluten, kein Fleisch, aber Fußball gucken, das darf man! Dabei ist Fußball die unkorrekteste Veranstaltung von allen! Da waschen sich Männer gegenseitig die Hände, Männer, von denen man dachte, sie wären längst ausgestorben, mit den 50er Jahren untergegangen, aber nein, wie sich herausstellt, regieren sie die Welt! Die klopfen sich gegenseitig auf die Schultern und schieben sich unterm Tisch die Millionenverträge zu und geben sich feuchte Händedrücke und dann teilen sie sich zur Feier des Tages eine Edelhure. Im schlimmsten Fall gibt’s mal einen Sex- oder Korruptionsskandal. Aber das schadet nicht weiter, im Gegenteil. Das Ganze zieht sich dann runter bis auf die Spielerebene. Und wenn wenigstens ENDLICH mal einer von denen die COJONES hätte, zu sagen, dass er schwul ist! Aber nein, nicht mal das kriegen die Feiglinge hin! Dabei wär der ein Superstar, hochgejubelt und international durchgetalkshowt. Come on, da ist jetzt echt genug geredet und der Weg geebnet worden. Das hat inzwischen so ziemlich jede Sportart hingekriegt, außer Reggea und Synchronschwimmen. Und dann wird einem dieser ganze korrupte Geldlesverdiener-Scheiß auch noch von Antifa bis grün als big united Multikulti-Ding untergejubelt, dabei geht’s nur um globalen Kapitalismus und internationale Verschiebeverträge. Das hat doch mit: Ey, ein Schwarzer spielt für uns, der kann das und ist hier geboren, eat that, du borniertes rechtes Nazi-Arschloch!, nichts mehr zu tun, funktioniert doch überhaupt nicht. Und dann die Fans! Eine reizende Bagage in deren Mitte sich genau dieses rechte, verspießerte, brutale Dumm-Männertum unterm Deck- und Legitimationsmäntelchen des angeblichen Familien- und Gewerkschaftssports austoben kann: Saufen, dummbrüllen, Randale machen, und dann noch nicht mal wissen warum! Herrgott, man ist doch auch irgendwann mal aus der Kirche ausgetreten, weil man von dem Verein nichts hält, auch wenn er ab und an mal was Gutes tut!
Ob ich EM gucke?
No fucking way, liebe Genossinnen und Genossen! Ich mach den Spielverderber.
Und Tor !!! Nachtrag, 17.6.: wie konnte ich die vergessen!? Die ganzen misogynen Arschlöcher, die sich vom Fußball ins Recht gesetzt fühlen die übelsten Hasskommentare über eine Frau! als Moderatorin! im Fußballjahr 2016 abzulassen. Von „Kampflesbe“ und „geh Wäsche machen“ über das solide alte „Schlampe“ bis zu „darf die überhaupt raus aus der Küche“ und „nix gegen Emanzipation, aber können sie uns nicht wenigstens den Fußball lassen“ sowie „die können ja Frauenspiele kommentieren, aber doch nicht die richtigen“ war alles dabei, was man wissen muss.
Juni 2016 – grüßen
Es gibt ja so Leute, die hat man irgendwann mal gegrüßt und dann grüßt man sie irgendwann nicht mehr. Das ist sehr unangenehm. Geht das nicht irgendwie anders? Und wer hat überhaupt damit angefangen. Bzw. aufgehört? Man selber? Oder der andere? Eigentlich immer der andere. Immer hat der andere angefangen. Nicht zu grüßen. Wir haben uns gegrüßt, dann hat er mich nicht mehr gegrüßt. Ich kenne niemanden, der sagt, ich hab aufgehört, den zu grüßen. Ich kenne nur Leute, die sagen, der grüßt mich nicht mehr. (Oder, gerne Frauen: Die grüßt mich nie, also grüß ich sie auch nicht.)
Und dann sitzt man plötzlich nebeneinander im Cafe oder begegnet sich auf der Straße und läuft auf einem engen Gehweg aneinander vorbei und es ist komisch. Awkward, wie der Ami sagt. So awkward. Oder jemand anderes, den man gerade am Nachbartisch getroffen, und der noch zu denen gehört, die man grüßt, sagt zu dem am übernächsten Nachbartisch, den man nicht mehr grüßt : Ihr kennt euch doch auch, oder? Die allerunangenehmste Variante. Die peinliche Direkt-Ansprech- Bloßstellungsvariante, von freundlichen unbedarften Zeitgeistern durchgeführt, die denken, alle ham sich lieb. Dann muss man sagen, jaja, richtig, von da und da, ne? Das wird einem eine Lehre sein, das nächste Mal wird man sich wieder grüßen. Oder auch nicht. Mal sehen, ob er mich dann grüßt.
Aber was ist das auch für ein komischer Moment, das Grüßen. Wie kommen einseitiges und einträchtiges Grüßen zustande? Wer entscheidet wie in Sekundenbruchteilen des Anschauens, Registrierens und Prozessierens, ob man und wie man grüßt? Hallo. Hi., nacheinander, überlappend, gleichzeitig. Lässt sich das nicht algorithmisch lösen? Eine Sheldon Cooper Autisten App, eine would appreciate App, die das für einen übernimmt, das Grüßen.
Es gibt Leute, die grüßt man jahrelang immer nur und wechselt nie ein Wort. Dann kann mans ja irgendwann auch echt mal lassen, das Grüßen, oder? Aber wer weiß schon, ob man sich nicht doch mal wieder begegnet, in irgendeinem Kontext in dem es wichtig gewesen wäre, die Person zu grüßen. Du willst den Job? Hättste mal besser gegrüßt.
Dann gibt es Leute, die erkennt man tatsächlich nicht mehr oder man ist, wie ich, damit beschäftigt mit den Zähnen zu knirschen und beim Laufen ein Problem zu zermalmen, das im Kopf rumkullert wie ein Stein, und man ist für einen Moment zu langsam bzw. zu schnell vorbei am Anderen. Oder man ist einen Moment nicht sicher, ob es die Person ist, die man immer gegrüßt hat? Denn man wird ja auch alt, vergesslich und wunderlich. Und man hat so langsam auch echt schon viele Gesichter gesehen, und manche von denen sind sich ähnlich oder überlagern sich, Frisuren, Figuren verunsichern einen, weil sie sich verändern sich oder man kann den Gesichtern keine Namen mehr zuordnen und man grüßt lieber nicht, denn wenn die Person stehen bleibt, dann muss man umschiffen, dass man ihren Namen nicht weiß oder keinen Schimmer mehr hat, aus welchem Zusammenhang man sie kennt. Und manchmal ist man einfach zu faul zum Grüßen, zum Nettsein, zum Lächeln, auch wenn‘s nur kurz ist. Eine Sache, die man einsparen kann, ach du, egal, rasch vorbei, danke.
Eine seltene, aber sicher die sozial alptraumartigste Version des Nicht-Grüßens ist natürlich die des Nicht-Grüßens, weil man sauer aufeinander ist. Weil man nichts mehr miteinander zu tun haben will. Da gehen Menschen grußlos aneinander vorbei, die Sex miteinander hatten. Die ihre Genitalien betrachtet und ineinander gesteckt haben. Die sich weitaus mehr zu sagen hatten, als Hi. Die beste Freunde waren! Sich ihre Liebe gestanden haben! Ihre Familien, Freunde, Haustiere, Wohnungen geteilt haben! Und jetzt: kein Wort. Grußlos gehen sie vorüber. Wenn man sich vorstellt, dass man da einfach so zwischen durchläuft, dass da einer die Straßenseite wechselt, nicht einfach weil er zu Rossmann will, sondern weil er der Person, die gerade an dir vorbeiläuft, nicht begegnen will. Was für eine Energie, was für eine Geschichte. Von der man nichts mitkriegt.
Je länger man in einer Stadt wohnt, umso häufiger und weitverzweigter wird natürlich die Grüß-Problematik. Das Netz wird dichter, zieht sich langsam zu. Man muss aufpassen wie ein Luchs. Wie mag das alles erst Menschen gehen, die viele Leute kennen? Ich kenne ja praktisch niemanden.
Trotzdem überlege ich, wegzuziehen.
Irgendwo ganz neu anfangen, mit dem Grüßen.
Juni 2016 – Fundstück 14

Tierwelt in Brandenburg
Juni 2016 – Weg, Ziel
Wer hat eigentlich gesagt, der Weg ist das Ziel. So ein Blödsinn.
Der Weg nervt, und zwar ziemlich, und so lange, bis das Ziel auch nervt. Der Weg verdirbt einem das Ziel. Er macht das Ziel egal. Dann halt nicht, Ziel. Wenn der Weg so scheiße ist. Dann bleib halt wo du bist, in deinem Tal der Unerreichbaren. Viel Spaß da, Ziel. Tschüss, Weg, danke für die Scheißnummer.
Ich springe in die Luft, dann halt ich sie an, damit ich nie wieder runterfalle, auf den Weg.
Juni 2016 – Traum
Ich träume, ich trenne mich von T. Ich weiß, es wird hart, und noch lange wehtun, aber ich werde es schaffen. Ich wache auf und schnappe nach Luft, ein Schub aus Angst und Panik erfasst mich. Was hab ich nur getan?! Glücklicherweise liegt er neben mir.
Seltsam. Normalerweise träume ich das Gegenteil: Er verlässt mich und ich weiß nicht mehr ein noch aus. Ich weine und bettle. Er zuckt nur mit den Achseln. Es ist das Gefühl von damals, als er mich verlassen hat. Wenn ich aufwache, bin ich erleichtert, weil es nur ein Traum war. Aber das Gefühl hängt noch lange in den Tag hinein.
Juni 2016 – kaufen
ich kaufe und kaufe. hier was und da was. im laden oder online. ich guck mal hier, ich guck mal da, vielleicht ham sie was dort. dann entscheid ich mich. und kauf das. richtig gut ist das. spontan oder überlegt: das kauf ich jetzt. kaufen ist das beste. es gehört mir. ich kann das, kaufen kann ich gut. ich kann das richtig gut, ich bin ein guter käufer, das ist ein skill, das ich habe. ich kaufe mit geschmack, sinn und verstand. ich kaufe essen. ich probier das mal aus und das nächste mal das. ich kaufe klamotten. die umkreis ich, guck sie an, probier sie an, die hab ich gesehen, vorher, an leuten, in zeitschriften, an puppen in schaufenstern. ich kaufe sachen für die wohnung. ich will dass die sachen schön sind, dass sie richtig schön sind, ich will nur schöne sachen kaufen, nur was mir gefällt. ich will nicht nicht kaufen, das macht keinen spaß und führt zu frust. wenn ich kaufe bin ich am leben. ich nehme am leben teil. mit dem kaufen und mit den sachen, die ich kaufe. andere leute haben die auch, oder eben gerade nicht. ich bin für mich, ich bin bei mir, beim kaufen, da sind auch andere leute, aber ich bin parallel, in der kauf-parallel-welt, ich seh die anderen aber die sind nicht wichtig, nur beruhigend. ich guck gern, was die anderen kaufen. ich guck auch in der werbung, was ich kaufen kann. ich kaufe sehr gern. wirklich sehr sehr gern. kaufen bedeutet, dass ich geld habe. das ist vielleicht das wichtigste, es bedeutet, ich bin frei, frei zu kaufen was ich möchte. wenn ich kaufe, bin ich unterwegs, hab was zu tun, muss hierhin und dorthin, entscheidungen treffen. wenn ich kaufe, werde ich nicht depressiv. die welt ergibt sinn, wenn ich kaufe, ich ergebe sinn in der welt. ich kaufe. früher war mir das egal, kaufen, geld, egal. heute weiß ich nicht, was ich sonst machen soll außer kaufen und geld spielt in meinem kopf die rolle nummer 1, ich will welches, die ganze zeit und hab nie welches, die ganze zeit.
Mai 2016 – Stopp
Kann mal kurz jemand STOPP sagen, bitte? Mal kurz anhalten, die Zeit, bitte? Die gnadenlose, die weiterklackert, egal was passiert, wie es passiert, ob was passiert. Mal eben haltmachen, bitte, alles einfreezen, wie im Film, zum Angucken und Näherbetrachten und zwischendrin und nebenher Schnell- mal-was-erledigen, was man nicht in vorgeschriebener Zeit geschafft hat oder nicht früh genug wusste, dass man es schaffen will oder dass es unerlässlich ist, es zu schaffen, um eine gute Zeit zu haben? Mal eben bisschen Luft, bitte, um aufzuholen, catch up machen, wie der Amerikaner sagt, sich auf den gleichen Stand bringen mit der Zeit. Damit man wieder auf der Höhe ist mit ihr. Dann kann man’s von mir aus wieder weiterlaufen lassen. Danke.
Mai 2016 – Model Escort
Kürzlich in der S-Bahn. Ein unglaublich schönes Mädchen steigt ein, groß, schlank, dunkelhäutig, wilde Haare, vielleicht 21, sehr präsent, sieht aus wie ihr eigenes Foto. Sie ist mit einem Typen unterwegs, ein Freund, nicht ihr Freund, schätze ich, beide hipstermäßig gekleidet, das Wetter ist toll, Getränk in der Hand, wohl auf dem Weg in den Park, zum Open Air oder whatever. Und, wie war Shooting?, fragt er. (Klar, – Model!)
Sie erzählt von einem Job, den sie für Mac gemacht hat (sie sagt nicht Apple). Wie krass das war, und dass sie ihr fünfmal das Make-up runtergemacht haben und fünfmal wieder dick drauf, weil sie nochmal und nochmal was anderes wollten und am Ende konnte sie nicht mehr aus den Augen gucken, so viel Chemie war drin. Ich konnt echt nicht mehr schauen, sagt sie. Das war so krass. Da war echt mal wieder klar, warum die Gage so geil ist, die wollen einfach deinen Körper. Naja, aber jetzt hat sie die Überweisung, sagt sie und das ist schon geil. Zumal von Zalando grade nicht viel kommt. (Daher kenn ich sie!?)
Dann erzählt sie von einer Freundin, die jetzt auch Escort macht. Ohne Sex. Nur Begleitung.Der Typ wird unruhig, irgendwie passt ihm das nicht. Wieso, sagt sie, das sind dann halt so Männer, die wollen mit dir angeben. Und die wollen dann eben auch jemand, mit dem sie sich unterhalten können, jetzt eben keine normale Prostituierte, sag ich mal, die jetzt vielleicht eher son bisschen, also jemand der halt Abi hat und gepflegt ist und so. Die wollen dich rumzeigen, und angeben, dass sie so ne Frau haben können. Da brauchst du nicht für bezahlen, meint der Typ. Sie lacht, wenn du gut aussiehst, ja, aber wenn du halt mal leider nicht so gut aussiehst, dann musst du eben dafür bezahlen. Er schüttelt unwillig den Kopf. Ist doch auch nicht viel anders als das. was ich mach, sagt sie. Und nach ein so nem Wochenende hat sie sich einen Kleinwagen gekauft.
Vielleicht ist das der Moment in der Geschichte des Kapitalismus, in der alle, aber wirklich alle, von der Edeka-Kassiererin bis zum Top-Manager, vom Model bis zur Dunkin-Donuts-Verkäuferin vollkommen reflektiert darüber sind, sich komplett bewusst darüber sind, dass sie in perversen Zusammenhängen leben und arbeiten.
Vielleicht ist das das schlimmste Stadium von allen.
Mai 2016 – AfD
Seien wir froh, dass die AfD wirtschaftsliberal ist, das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass sie spitz kriegen, dass ihr Klientel das gar nicht gut findet, und das in Richtung einer antikapitalistischen Ausrichtung ändern. Dann gewinnen sie das nächste Mal nämlich die Bundestagswahl. Und sind von der NSDAP nicht mehr zu unterscheiden.
Mai 2016 – Sozialbox
kürzlich werfe ich Kleider in eine von diesen Sozial-Sammelboxen. Die Box steht schon so usselig rum, bisschen suspekt, dann fällt mir auch noch ein Schild auf, handgeschrieben: werfen sie hier nichts rein, die Box wurde illegal aufgestellt. Aha.
Ein paar Wochen später sehe ich einen silbergrauen Audi, der kommt leger von rechts angefahren, hält schräg quer über die Straße, die Audi-Nase Richtung Box am Wegesrand, steigt ein Typ aus – nichts da russischstämmiger Intensiv-Serbe – eher ich bin ein easy geiler Typ, 50 plus, Hipster Sonnenbrille, bisschen Friedrich Liechtenstein, aber arschlochmäßiger und ohne Bart. Macht der routiniert die Box auf und stopft die Klamotten in seinen Kofferraum! Wow.
Dann. Am selben Tag, Sonntag, schlendere ich über den Mauerpark. Wen seh ich: Alter, den Typ! Der verkauft da in aller Seelenruhe die Sozialklamotten der Mitte-Bevölkerung auf dem Mauerparkflohmarkt! Doppel-Wow.
Mai 2016 – Coffee Shops
So pervers wie meine Liebe zu Shopping Malls ist auch meine Liebe zu Coffee Shops. Ehrliche Ausbeuterbetriebe, die mit fair trade werben, unfassbar viel Geld für einen soliden Kaffee verlangen, im Konzept-Design gerne mit Kreidetafeln, Brauntönen, Fake-Kaminen, und vielen kleinen, im shabby-look gerahmten Bildern arbeiten, Motiv: MENSCHEN. Als großes Plus kommt dazu, dass sie immer unglaublich schmuddelig sind. Echt wahr, guck mal hin: Die Stühle sind abgeranzt, an den Tischen sind die Ecken ab, die Böden sind nicht gewischt, die Heizungsdeckel liegen nicht auf und sind staubig, überall liegen Croissant-Krümel herum, um die sich, wenn man Glück hat, eine Horde Spatzen kümmert, das dreckige Geschirr vom Vorgänger steht auf dem Tisch, der Milchschaum nackt abgelegter Löffel, die heruntergelaufene Karamelsauce und die Braunzuckerkrümel vermischen sich dort mit den frisch gepressten Orangensaft-Klecksen, und die Zeitung, die man zu lesen bekommt, heißt Die Welt und scheint extra für den Coffee Shop angefertigt worden zu sein. Faszinierend! Warum, zur Hölle, gehe ich, gehen alle da gerne hin?
Mai 2016 – böse Mami / Despot zum Tee
Böhmermann: Heul doch!
Erst Achtung Schmähgedicht vortragen, sich dann im Nachhinein beschweren, dass die Kanzlerin ihn einem Despoten zum Fraß vorgeworfen hat.
Ist Jan Böhmermann eins dieser Kinder, das ihren Eltern jedes Krakelbild zeigen konnte in der sicheren Erwartung, dass sie ausflippen vor Begeisterung? Und nun war Mami gar nicht begeistert, sondern hat das Krakelbild der Justiz übergeben. Ooooouuuuhhhhh, armes Böhmi.
– Sorry, Jan, nicht dein bester Auftritt, nicht dein bester Nachtritt.
Mai 2016 – Paketnachbarn
Frau Fürchtegott (Name von der Redaktion geändert, aber in Annäherung an den richtigen) nimmt gern die Pakete aus der Nachbarschaft an.
Der Postbote ist froh darüber. Der geht zu Frau Fürchtegott und lädt da den gesamten Paket-Mist der Straße ab, das geht schneller und bringt weniger Ärger. Jedenfalls ihm. Ich muss dann im Internet recherchieren, wo mein Paket abgeblieben ist oder im ganzen Haus rumlaufen und danach fragen und noch mehr Nachbarn kennen lernen, die ich gar nicht kennen lernen will. Einen Zettel kriegt man nämlich auch nicht mehr in den Briefkasten geworfen. Aber inzwischen, nach ein paar Wochen (ich bin ja neu hier!) ist eigentlich klar, wo das Paket ist, nämlich bei Frau Fürchtegott.
Bei Frau Fürchtegott steht N. + E. Fürchtegott an der Klingel. Ich weiß nicht, wer N. und wer E. ist, aber: Sie wohnt mit ihrem Sohn zusammen, der ungefähr Mitte vierzig ist und wahrscheinlich noch nie oder seit der Wende nicht mehr gearbeitet hat. Sie ist dick und hat schlechte Zähne, keine Überraschung. Die beiden haben einen Hund, der sehr sehr süß ist, so einen kleinen Mischling, der mir immer den Eindruck macht, dass er tendenziell genervt ist vom White Trash, der ihn umgibt, jedenfalls will er jedesmal, wenn ich mein Paket abgeholt habe, und den Rückzug antrete, unbedingt mit. Er läuft mit mir bis runter zur Haustür und ist nur sehr schwer zu bewegen, wieder zurück zu gehen zu den Anstrengenden Verrückten, die das Schicksal ihm als Herrchen zugespielt hat. Aber wie das so ist: Seine Herrchen sucht man sich nicht aus.
Erst auf mehrmaliges strenges Rufen von N. + E. Fürchtegott, und mein bedauerndes Achselzucken hin, gibt er klein bei, und hopst, plötzlich schwerfällig geworden, Stufe für Stufe zurück nach oben in den ersten Stock und verdreht dabei fürchtegottergeben die Augen, während ich mich mit meinem Paket durch die Plattenbau-Haustür aufatmend in die Freiheit entlasse.
Um an das Paket zu kommen musste ich zuvor an der Fürchtegott-Wohnungstür meinen Ausweis vorzeigen, woraufhin etwas aufgeregt ein kleiner Raum durchsucht wurde, der vom Fürchtegott-Flur abgeht (Ost-Plattenbau-Mini-Flur mit dickem Teppich und Wand-Schrank-Garderobe), der wirkt als wäre er extra konzpiert worden für die Aufbewahrung der Gesamt-Pakete der Straße, herumgesucht, von links nach rechts sortiert und unter Zuhilfenahme von Lesebrillen Namen vorgelesen, dich ich gar nicht hören will, und mit dem Namen auf meinem Ausweis verglichen.
Kürzlich klingelt es abends an meiner Tür. Ich hab ein Paket für sie, sagt die Gegensprechanlage. Ich zieh eilig Schuhe an und werf ne Jacke über die Jogginghose, steht da Frau Fürchtegott vor der Haustür mit meinem Paket. Sie erläutert, dass sie abends ihre Runde dreht und die Pakete ausliefert. Sie stellt ein paar indirekte Neugier-Fragen, die ich elegant nicht beantworte, finde dafür umso mehr über sie heraus, es ist ein netter freundlicher Schwatz, und ich bedanke mich bei ihr. Ob sie das stört, frage ich, wenn der Postbote die Pakete bei ihr abgibt – die reine Schleim-Höflichkeit, ich weiß ja längst, dass sie ihren Job liebt. Nein, nein, erklärt sie bescheiden, sie mache das gern. Nur einmal habe sie abgelehnt für jemand weiter Pakete anzunehmen, das wären so zwei – sie senkt die Stimme – „Ausländer“ gewesen, die hätten ihr ihren Ausweis nicht zeigen wollen und wer weiß, was in den Paketen drin gewesen wäre und am Ende wäre sie noch verantwortlich gewesen.
Interessant, denke ich. „Ausländer“ wird hier geflüstert.
In Berlin-Mitte, da ist das so. In Erfurt oder Jena würde das keiner flüstern, im Gegenteil. Ist schon richtig korrekt hier.
Zurück in der Wohnung versuche ich online einen Button zu finden, der sagt: Bitte nicht beim Nachbarn abgeben. Aber das ist bei DHL leider nicht möglich.
Mai 2016 – Traum
Im Traum sehe ich ein kleines Mädchen, etwa drei Jahre alt, ich weiß, es ist meine Tochter. Sie dreht sich zu mir um und lächelt. Die ist ja eigentlich ganz süß, denke ich.
Mai 2016 – Nicholas Sparks
Folgende Meldung:
Nicholas Sparks schreibt 2000 Wörter pro Tag. Damn it! Für die 2000 Wörter braucht er fünf bis sechs Stunden pro Tag, wenn’s schlecht läuft acht. Aber Nicholas Sparks (für Nixkenner: Liebesromane, erfolgreich, früher Wirtschaftswissenschaftler, pleite, dann Bestseller) weiß auch jede Sekunde, was er schreiben soll.
Ich hingegen brauche acht Stunden wenn’s gut läuft, verteilt auf fünf bis sechs Tage, und zwar für 2000 Zeichen. Und an den meisten Tagen hab ich keine Ahnung, was ich schreiben soll und gucke stattdessen fern. Oder bringe beim Einkaufen das Geld durch, das ich nicht habe.
Mai 2016 – nur einmal zum ersten Mal
Kürzlich mal wieder mit G. getroffen. Wir reden über Affären.
G. sagt, lieber nichts erzählen, wenn sich doch an den Gefühlen nichts ändert. Warum den anderen verletzen? Ich sage: Ich will immer die Wahrheit wissen. Und zwar schnell. Ich will die Chance haben darauf zu reagieren, Herr über meine Welt, meine Reaktionen und Entscheidungen zu sein. Außerdem: die Gefühle ändern sich immer. Bzw. haben sich geändert und dann gibt es die Affäre. Als Ausdruck.
Nehmen wir an, sage ich, du liegst auf dem Sterbebett und fragst deine Freundin, hast du mich je betrogen? Willst du dann, dass sie die Wahrheit sagt oder dich anlügt? Ich möchte eine schöne, eine richtig gute Lüge, sagt G.
Er zitiert einen Freund, der mal gesagt hat, man kann jemanden immer nur einmal zum ersten Mal ausziehen. Vielleicht ein bisschen männlich, diese Perspektive – rumrennen und (möglichst viele) Frauen ausziehen – aber ist ja nicht schlimm, jedenfalls catchy.
Da draußen laufen Leute rum, man guckt, man lernt die kennen, man kommt auf Ideen, die drücken und drängen und werden größer, wenn man sie lässt und nährt. Die werden zu Sehnsüchten und Bedürfnissen und dann entzünden sie sich. Erst will man spielen, man will jemanden rumkriegen, rumgekriegt werden, dann will man, dass es ernst wird, man will sich verlieben, Augen, Haare, Gerüche alles toll! Vielleicht ein bisschen wie Drogen nehmen.
Ich hatte das mal. Früher. Jetzt hab ich das nicht mehr. Vielleicht, weil ich‘s früher mal hatte. Ich hatte, was ich haben wollte. Und jetzt habe ich T. Den wollte ich immer. Und will ihn immer wieder nackt sehen. Nicht nur einmal oder zum ersten Mal. Ist ja auch dauernd was anderes los. Viele erste Male. Und viele xte Male. Ich mag das.
Man hat doch auch so viel Angst, wenn man jemanden zum ersten Mal auszieht, küsst, oh gott, küssen!, anschaut, anfasst. Alles ist hochkomplex und kann jeden Moment schief gehen. Man schämt sich, die Ablehnung liegt potentiell in jeder Bewegung, diese ganzen magenfeindlichen Unsicherheiten.
Ich erzähle G. von T. und mir. Dass es Affären gegeben hat (oder besser einen Betrug von meiner Seite), dass wir uns sehr unglücklich gemacht haben, dass wir wieder zueinander gefunden haben, dass wir durch sind, damit. Dass es nur ohne Affären geht und mit der Sicherheit, dass der andere weiß, dass er es sagen muss, wenn was passiert. Wenn es einem von uns das nächste Mal passiert, dann ist es, glaube ich, vorbei.
Mai 2016 – Allah Akhbar
Neulich in der U-Bahn.
Die Tür geht auf, ein Typ kommt rein, ich sehe ihn an, denke, jetzt ist es soweit: Allah Akhbar
was er aber sagt, ist: Die Fahrausweise bitte.
Mai 2016 – Therapie 1
Meine Therapeutin sagt, ich hätte so einen schwarzen Humor. Mit dem sollte ich was machen. Der käm gut.
Schön, wenn wenigstens die Therapeuten sich amüsieren.
April 2016 – Alt 2
Heute werde ich ein Jahr noch älter.
Folgende Zeitschriftentitel sprechen mich in der Bahnhofsbuchhandlung an (ich bin gerade dabei, einen Zug nach Nirgendwo zu nehmen):
- BRIGITTE Wir. Zeitschrift für die dritte Lebenshälfte. „Der Blick auf uns sollte nicht mit einer Zahl verbunden sein“
- ALLEGRA: „Lebe ich mein Leben?“
- Tagesspiegel GESUND. „Fit und gelassen älter werden in Berlin.“
Ich scheine nicht die einzige zu sein, die das Altern beschäftigt. Soziologisch/Demographisch sind wir immerhin schon so weit, dass der Zeitschriftenmarkt sich aktiv auf mich einstellt.



April 2016 – Panama Papers
Ich kanns nicht erklären, aber die Panama Papers sind für mich richtig schlimm. Ich gebe auf. Ich lasse alle Hoffnung fahren. Ich sehe keinen Sinn mehr, in gar nichts.
Journalismus macht wieder Sinn, okay. Wenn auch nur aufgrund von tapferen jungen Männern, die bereit sind, ihren Kopf, ihre Karriere, ihre Biographie hinzuhalten für ein Leak. Nicht der Journalismus ist bei Moussac reingelaufen. Aber er hat den Leak artig und in internationaler Zusammenarbeit ausgewertet. Okay.
Die Panama Papers sind schlimm, weil sie jeder Moral, jeder Überzeugung davon, dass es irgendwo in den Demokratien dieser Welt irgendein Rest-Funktionieren gibt, den Boden entzieht. Die Skrupellosigkeit ist so total, so global, und gleichzeitig so ausdrücklich ignoriert und damit gewollt, dass nichts mehr übrig bleibt. Niemand ist nichts mehr zu glauben, es gibt kein Vertrauen mehr, in gar nix. Nicht mal die Aufdeckung scheint das hervorzubringen, was sie hervorbringen könnte.
Man kann sagen, es sei naiv, von etwas anderem ausgegangen zu sein, das war doch klar und schon immer so, aber das stimmt nicht. Bei den Panama Papers geht es nicht um die Aufdeckung von irgendwelchem korruptem Herrschaftsscheiß. Bei den Panama Papers geht es um die Aufdeckung der völligen Sinnlosigkeit.
Was macht man da raus? Den Rückzug ins Private? Was soll das sein? Draußen scheint die Sonne, lass uns spazieren gehen und ein paar Leute treffen?
April 2016 – Zizek
In Zeiten zunehmender Ratlosigkeit in Positionierungfragen (links ist rechts und andersrum, also pass auf wie ein Luchs, was du denkst und sagst), greift der Mensch auf der Suche nach Orientierung zu Zizek-Büchern.
Hier zwei Zitate zum Hochhalten:
„Wir tendieren dazu, elementare westliche kulturelle Werte ausgerechnet in einer Zeit zu verwerfen, in der viele davon (bspw. Egalitarismus, Grundrechte, Sozialstaat) in einer neuen, kritischen Interpretation durchaus als Waffe gegen die kapitalistische Globalisierung dienen könnten.“
„Jedoch kann den Sorgen der einfachen Leute, die um die Bedrohung der eigenen Lebensweise kreisen, auch von einem linksliberalen Standpunkt aus begegnet werden – Bernie Sanders ist ein lebender Beweis dafür! Die wahre Bedrohung für unsere westliche Lebensweise sind nicht die Immigranten, sondern ist die Dynamik des globalen Kapitalismus.“
Hier noch was Gruselig-Interessantes:
„In einer düsteren Prophezeiung kurz vor seinem Tod sagte Staatschef Muammar al-Gaddafi: Hört zu, Völker der NATO! Ihr bombardiert eine Mauer, die den Weg der afrikanischen Migration nach Europa und den Weg der Terroristen von al-Quaida versperrt hat. Diese Mauer war Libyen. Ihr Idioten reiß sie nieder, und ihr werdet in der Hölle schmoren.“
alles aus: Der neue Klassenkampf. Die wahren Gründe für Flucht und Terror
April 2016 – Böhmermann
Der Pakt mit dem Teufel. Das ist klar.
Spielraum wäre gewesen für Merkel, die den Paragrafen ja eh abschaffen will,
und doch: Sie hat die Sache der Justiz übergeben (und dabei den schönen Satz gesagt: Vor der Justiz muss sich niemand fürchten, was ein bisschen witzig ist), also klassisch aufklärerisch agiert, und sich später folgerichtig für die Äußerung ihrer subjektiven Ansicht, das Gedicht sei verletzend, entschuldigt.
Und: Come on, Böhmermann. Sagen: Ich mach jetzt mal was Verbotenes, dann was Verbotenes machen, und dann soll es nicht verboten sein? Irgendwie bescheuert. Als mediale Guerilla-Aktion einfach schlecht und hinterher gelaufen (NDR). Sein Gelöt stinkt schlimm nach Döner, haha. Da musste auch beim Vortragen viel gelacht werden um zu überspielen, dass das keine Glanzleistung war. Nicht alles geht, nicht alles funktioniert, nicht alles ist gut, was provoziert. Keine gute Arbeit.
Fellatio mit Schafen? Ein junger Türke, schnappe ich irgendwo auf, erzählt, dass sein Vater sich aufgeregt hat: Es müssten wenn schon, dann ja wohl Esel sein!, wie kulturell ungebildet dieser Böhmermann eigentlich sei?
April 2016 – Bohren
Ich hasse bohren.
Das ist leider sehr weiblich, die meisten Männer, die ich kenne, bohren gern. Bis auf die 90er sozialisierten, die, gender studies und cultural studies und Strukturalismus und queer theory gut finden, die bohren alle nicht gern. Die lesbischen Frauen wiederum bohren alle gern. Quer durch die Bank.
Wie immer, wenn etwas leider sehr weiblich ist, hasse ich nicht nur die Sache, sondern leidenschaftlich mich. (und meine Mutter, und meinen Vater). Das muss auch mal aufhören (ersteres, letzteres von mir aus nicht).
Hier, im Plattenbau, ist Bohren eine Extra-Challenge. Hier kann man im Grunde nicht bohren. Die Wände sind aus Beton mit Stahleinlage. icht mal einen Nagel kriegste hier in die Wand! Hier ist kleben statt bohren angesagt, aber nicht jedes Regalbrett hält, wenn man es anklebt. Nur die ganz kleinen, winzigen Brettchen, die halten. Wenn man nichts auf sei draufstellt. Jedenfalls: herkömmliche Bohrmaschinen versagen hier, Bohrmaschinen, die nicht über nagelneue Bohrstäbe und über eine 1A-Schlagbohr-Qualität verfügen, kannste gleich wieder einpacken.
Am Ende (literally) bestelle ich einen Handwerker. Bzw. versuch’s. Ist nämlich gar nicht so einfach. Einen halben Tag irgendwo in die Wand bohren ist für einen Handwerker nicht besonders attraktiv, wenn er auch ne Woche Edelküche aufbauen haben kann. Der erste, den ich kontakte ist dementsprechend ein Arsch und führt mich zwei Wochen lang an der Nase rum, bis er den Auftrag mit der Edelküche hat.
Der zweite ist ein Schatz, sagt, das ist alles kein Problem, holt seine Bohrmaschine raus mit dem zufriedenen Gesichtsausdruck eines Mannes, der seinem Werkzeug vertraut, und bohrt Bohrloch für Bohrloch in Decken und Wände, die dabei plötzlich Geräusche von sich geben als wären sie williger Matsch.
März 2016 – vor sich hin wurschteln
Kürzlich treffe ich mich abends mit einem Freund auf einen Drink.
Wir unterhalten uns wie immer über alles was so los ist in unseren Leben. Am Ende, als wir noch gemeinsam zur Tram gehen, sagt er:
So wurschteln wir vor uns hin.
Genau, sage ich, und lache.
Sein Satz klingt nach. Ein bisschen melancholisch ist der, eine leise Frage vielleicht auch. Ist das richtig? Was wir hier machen? Mit uns und unseren Leben in dieser Welt? Auch ein Bedauern schwingt mit, dass es nicht besser geworden ist, mit uns und unseren Karrieren, dass sich das lowe Level hält, it came to stay, es wird nicht mehr weggehen, wir haben es nicht geschafft, wir werden weiter vor uns hin, wir werden uns weiter durchwurschteln.
So ist das. Es passiert nichts besonderes. Es geht nicht voran, es geht nicht zurück. Nur immer weiter. Es gibt keinen Paukenschlag. Nichts, was das Ruder rumreißt. Nichts, was dein Leben radikal verändert. Man muss froh sein darüber, denn das könnten Unfälle, Krankheiten, Terroranschläge sein. Jeden Tag fällen wir Entscheidungen. Die sind klein. Nicht groß. Nudeln oder Reis. Laufen oder fahren. Die Agentur kündigen oder nicht. Weitermachen mit dem Herzensprojekt oder klein beigeben. Diesen Rechner kaufen oder jenen. Die Socken waschen oder noch nicht.
Mein Leben ist so. Es ist ereignisarm. In meinem Leben werden nicht mal Kinder geboren oder Auslandsaufenthalte geplant. Mein Leben ist klein. Es ist mittelmäßig und bequem. Ich hangel mich von Tag zu Tag, von Hoffnung zu Enttäuschung, von Geld zu No-Geld, von Idee zu Lass mal besser. Ich wurschtel so vor mich hin.
Tue ich das womöglich, weil es mir gefällt? Hab ich mir das Wurschteln ausgesucht? Könnte ich das ändern, könnte ich raus aus dem Wurschteln? Ist das Wurschteln von außen bestimmt, hat man mich da hingedrückt, runtergedrückt ins Wurschteln? Hab ich die falschen Entscheidungen getroffen, zu viel Angst gehabt? Und was ist überhaupt das Nicht-Wurschteln, das Gegenteil vom Wurschteln?
Was?
März 2016 – Molenbeek
Ich sehe eine Video-Aufnahme aus Molenbeek, die Polizei dringt in ein Haus ein, um nach dem Terroristen des Terroranschlags zu suchen. Die Menschenansammlungen vor dem Haus beschimpft die Polizei.
Wie kann es sein, dass die Leute schimpfen? In diesem Fall. Wie kann es sein, dass ein Attentäter über Monate hier untertaucht, einkaufen geht und niemand ihn verrät? Als wäre er einer von ihnen, einer, mit dem man solidarisch sein muss, den man schützen muss, vor dem Zugriff von außen, vor den Unterdrückern.
Was ist da passiert?
Februar 2016 – Im Fenster sitzen
Am liebsten sitze ich im Fenster.
Nicht am Fenster, das ist nochmal was anderes und auch schon ganz schön, z.B. in der S-Bahn. Aber am liebsten sitze ich IM Fenster im Cafe.
An einem langen Tresen, der an diesem Fenster entlang führt, an dem man seinen Kaffee im Stehen (bandscheibengerecht), oder auf einem Barhocker sitzend, zu sich nehmen, und dazu eine Zeitung lesen kann. Eine gute Zeitung, die im Cafe 1. vorhanden und 2. nicht von anderen in Beschlag genommen ist. Ach, das ist das Paradies!
Ganz gezielt suche ich mir Cafes aus, in denen man im Fenster sitzen kann.
Ich bin nicht die einzige, die gern am Fenster sitzt. Im Fenster sitzen scheint geradezu eine urmenschliche Konstante zu sein, schon die Römer saßen gerne im Fenster, die Philosophen der Antike, Plato, Sokrates, Aristoteles, ja, Zeus und all die anderen griechischen Götter, sie alle saßen gerne im Fenster im Cafe, das ist überliefert und in vielen Texten und Anekdoten festgehalten .
Hätte ich ein Cafe, ich würde nur Fensterplätze einrichten. Alles andere bringt’s im Grunde nicht.
Und die Vorteile vom Im Fenster sitzen liegen auf der Hand:
1. Man kann rausgucken.
2. Man kann Leute beobachten.
3. Die Leute können reingucken, aber man ist auf der sicheren Seite.
Aber warum guckt man gerne raus? Warum macht man das alles?
Man sieht, wie das Wetter ist, wie der Straßenverkehr seinem Rhythmus nachgeht, man sieht wie die Stimmung so ist, in der Gesellschaft und beim Individuum.
Und das alles durch eine Glasscheibe. Eine Glasscheibe, die einen teilnehmen lässt ohne den Realitäten da draußen ausgesetzt zu sein. Man ist drinnen und draußen zur gleichen Zeit. Im Fenster sitzen ist wie Fernsehen. Es strömt mit seinen Geschichten durch mich hindurch und trägt mich dahin, während es beschäftigt ist mit sich selbst.
Man sieht Frisuren und Klamotten und Schicksale. Man sieht Hunde und Besitzer, Radfahrer und Schalträger. Man sieht Assis, Verrückte und Armut. Man sieht Dummheit und Ignoranz. Lieferwagenfahrer, Shopping-Mädels, Business-Jungs. Kollegen. Man sieht alles, was es so gibt, kranke Leute, alte Leute und die neusten Trends vom Straßenlaufsteg. High Heels und Funktionsklamotten. Bärte, Biere, Plastiktüten. Situationen. Angerempelt, angelächelt, ausgewichen, ins Telefon geredet, dreimal vorbeigelaufen, scheiße, nass geworden, Mütze auf, Schirm ab, Kind schreit, bei COS gewesen, Klassenfahrt, ohje, der Außenseiter, immer alle im Weg, Rollkoffer, lalülala, Rumpeltram, Rollator.
So kann ich arbeiten.
So kommt mir das Leben sinnvoll vor.
Ich bin sehr glücklich, wenn ich im Fenster sitze.
Januar 2016 – Stillen im Laufe der Jahrhunderte
Meine Lektüre von Die Clique, einem Buch über acht Frauen im New York der dreißiger Jahre, inspiriert mich zu einem Beitrag über Säuglings- und Kleinkindpflege im Laufe der Jahrhunderte. Gibts darüber schon ein Buch? Eine Diss, eine Habil? Wahrscheinlich. Falls nicht, sollte das jemand in Angriff nehmen.
In die Clique (noch aus ein paar anderen Gründen ein tolles Buch, aber dazu vielleicht später oder nie mehr mehr), gibt es eine tolle Episode rund um eine der Frauen, die in ihrem Freundeskreis dadurch Aufsehen erregt, dass sie ihr Kind stillt. Denn damals, so lässt sich deuten, war Stillen offenbar etwas, was man bei „den Hottentotten“ machte, also bei irgendwelchen Naturvölkern, die man als primitiv bezeichnete und im besten Fall aus dem Ethnologischen Museum kannte, das damals ganz sicher noch anders hieß. Oder von armen Fabrik- oder Landarbeiterinnen, die es nicht besser wussten oder aus ökonomischen Gründen nicht anders konnten. Jedenfalls war das Stillen offenbar weit außerhalb der bürgerlichen Sphäre der jungen Frauen, um die es im Buch geht. Doch die Freundinnen sind begeistert über dieses progressive Verhalten. Denn: der Ehemann der Frau, ein junger Arzt, (den sie sich geschnappt hat, denn das tun die college-gebildeten Frauen dieser Zeit, sie schnappen sich einen Mann, das klappt nicht immer und dann ists tragisch, mit Mann aber auch), hält das Stillen aus medizinischen Gründen für vorteilhaft fürs Kind – eine radikale, sehr moderne medizinische Ansicht, die sich zum Bedauern des ehrgeizigen, engagierten Arztes nur langsam gegen die konservativen, ältlichen Still-Gegner durchsetzt. Das Kind wird dabei aber nicht einfach gestillt, wenn es schreit, sondern nach einem peinlich genauen Zeitplan, den es unbedingt einzuhalten gilt. Abweichungen schaden! Dass die junge Frau im Grunde zum Opfer nicht nur ebendieses Zeitplans wird, dem sie sich mit aller Verzweiflung und allem Altruismus zum Wohle ihres Kindes aussetzt, sondern auch zum Opfer von kulturellen, gesellschaftlichen, ideologisch überformten Konzepten über Frau, Mutterschaft, Kindswohl und Wissenschaft, das zeigt die Episode auf brillante Weise.
Deutlich wird das vor allem einige Zeit später, als wir noch einmal zu ihr zurückkehren, zu einer Frau, die ihr inzwischen zum Toddler herangewachsenes Kind noch immer so stetig kontrolliert wie ihr Mann es wünscht, es aber mit Abscheu, Wut und Frustration beobachtet, weil es einfach nicht mit dem Einkoten aufhören will. Als sie eine der alten Freundinnen aus der Clique trifft, die ihr Kind auf eine Weise erzieht und ihm die Brust gibt, die die junge Frau nur als undiszipliniert und gefährlich ansehen kann, begegnet sie ihr gleichermaßen mit Faszination und Abscheu, und sorgt am Ende dafür, dass sie sich nie wieder treffen.
Dass jedenfalls Säuglings- und Kleinkindpflege und die Frage nach dem Ob und Wie des Stillens noch niemals frei war, und auch ganz sicher auch heute nicht im geringsten frei ist, was sich aber immer gerne eingebildet wird, so funktioniert Ideologie, von konstituierenden, diskursiven Verhandlungen über Frausein, Kindsein, Mutterschaft und Fürsorge, die von Fragen nach Klassenverhältnissen, Wissenschaft, Kultur, Psyche, Körper, Geschlechterverhältnis und Sozialstaat berühren, das ist da mal wieder glasklar geworden.
Das interessiert mich.
Januar 2016 – Wohnung
Ich wollte eine schöne Wohnung haben, eine Wohnung, in der es nicht durch die Fenster zieht oder die Nachbarn einen nachts um vier mit Psycho-Geschrei auf Trab halten oder Mäuse im Bad sitzen als wär’s ihre Eigentumswohnung oder die Klingel nicht funktioniert oder der Hinterhof ein Sammellager für Stinke-Kühlschränke und Mann-Mobilia-Regale ist.
Ich wollte eine Wohnung mit wenigstens einem Charme-Detail, zum Beispiel einer offenen Küche oder einem richtig großen Zimmer oder einer Aussicht auf den Fernsehturm oder einem Balkon, der nutzbar ist, kein Bierkasten-Balkon. Und dann wollte ich natürlich noch das übliche: das richtige Viertel, super verkehrsangebunden und trotzdem ruhig und billig – was ein Berliner halt so will.
Ich hab solche Wohnungen gesehen. Ich hab sie besichtigt, zusammen mit 150 bis 300 anderen. In Mitte, in Kreuzberg, Neukölln. Und nun hab ich diese hier genommen. Ich hab sie genommen, weil es die einzige war, die ich BEKOMMEN habe, bei allen anderen hatte ich keine Chance.
Diese Wohnung hier matched mit immerhin drei von vielen Wünschen: Sie ist günstig, (sofortige Erleichterung macht sich breit, also kein zu vernachlässigendes Kriterium), sie ist mitten in Mitte, und sie hat einen Balkon.
Trotzdem stehe ich jetzt in dieser Wohnung und denke: Das wars. Nach 12 Monaten Suche. Mehr war nicht drin. Mehr war einfach mal wieder nicht drin und mehr wird auch nie drin sein. Ich stehe in dieser Wohnung – 2 Zimmer, quadratisch, praktisch, gut, objektiv gibts nicht viel auszusetzen, wirft man alle Aspekte in die Waagschale – und denke:
Das ists, was auf meinem Grabstein stehen wird:
Mehr war leider nicht drin.
Die Wände kommen auf mich zu, nehmen mich von links und rechts in die Zange und ich denke:
In so einer Wohnung sterben verbitterte alte Frauen.
Januar 2016 – lesbisch als Option
Brüste verstehe ich. Also einigermaßen jedenfalls. Kommt natürlich immer auch drauf an, wie sie aussehen, es gibt sehr viele schöne Brüste – das weiß ich aus dem Fitnessstudio und der Sauna, interessanterweise eher nicht von den eh schon rar gesäten Freundinnen, die seh ich erstaunlich selten nackt, bin ja auch tendenziell raus aus dem Baggerseealter und da war man auch zuletzt in den 80ern nackt – aber es gibt auch ungefähr genau so viele nicht so schöne Brüste. Welche ich schön finde und welche nicht, weiß ich sehr genau. Da bin ich sehr klar. Aber mein Blick darauf ist weniger begehrlich, eher neugierig oder neidisch, gucken und anfassen sind ja auch zwei verschiedene Sachen. Küssen, das versteh ich, da sehe ich kein größeres Problem, wenn auch keinen großen Bedarf. Was ich allerdings überhaupt nicht verstehe, ist alles unterhalb der Gürtellinie. Aussehen, Geruch, alles da unten ist eine einzige Katastrophe, vollkommen reizlos, um nicht zu sagen, abstoßend. Ich kann die Begeisterung dafür nicht nachvollziehen, schon dann nicht, wenn Männern sich dafür begeistern. Nicht, dass ich was dagegen hätte, wenn jemand gesteigertes Interesse daran hat, sich mit meinem Aussehen und Geruch zu beschäftigen, voll abzugehen darauf, da wärs mir wahrscheinlich am Ende auch egal ob Mann oder Frau, da bin ich ganz Knast-Hete, orange is the new black, da hätte ich bestimmt auch jemand, der’s mir regelmäßig macht. Aber ich selbst könnte das bei anderen nur mit Würgereflex. In meinen Träumen kommen manchmal Frauen vor, klar, aber am Ende haben sie immer alle einen Penis. Und bei der üblichen Dreier-Fantasie sind es immer zwei Männer, nie eine Frau und ein Mann, dazu bin ich viel zu dominant, ich dulde keine anderen Frauen neben mir. Oder zu unsicher, wie man mag. Es hat Frauen gegeben, nach denen ich mich gesehnt habe, für die ich Gefühle hatte. Wer weiß schon, wie weit das gegangen wäre, wenn es gegangen wäre. Ich schließe nichts aus. Nicht mal was unter der Gürtellinie. Aber bis dahin: Nee.
Dezember 2015 – Herztöne
1 Es ist doch so. Irgendwann im Laufe dieses frühen Werdens, also ganz ganz am Anfang, so auf der Ebene Zellklumpen, muss es einen Moment geben, in dem ein menschliches Herz anfängt zu schlagen. Zum ersten Mal. Ein Muskel muss sich gebildet, ansatzweise in vier Kammern geteilt haben, Venen, Arterien müssen angelegt sein, die auf mirakulöse Weise wissen, was zu tun ist – von einem bestimmten Moment an. Was ist das für ein Moment? Warum fängt irgendetwas an, zu schlagen, zu pumpen, ein sonores Geräusch zu verursachen wie eine Uhr oder ein Getriebe? Und warum redet niemand darüber? Man spricht darüber, dass ein Herz aufhört zu schlagen. Dass es stehen geblieben ist. Ein ähnlich gruseliger Moment, aber medizinisch viel nachvollziehbarer. Ein Herz pumpt und pumpt und tut was es soll, ohne jede Motivation, ohne jedes Zutun von irgendwas oder irgendwem, jahrzehntelang, bis es älter wird, anfälliger, müder, aus dem Takt gerät , und eines Tages, bleibt es stehen. Einfach so. Aber keiner denkt an den Augenblick, in dem es angefangen hat, indem es wahrscheinlich eher ein Zucken war als ein Schlagen, ein rhythmisch pumpendes Zucken, ein kleiner Blutschub durch dünnwandiges Gewebe. Nicht mal in der Abtreibungsdiskussion spielt das ne Rolle.
2 Bei der Gynäkologin im Wartezimmer lassen sie immer die Tür offen, wenn im Hinterzimmer die Herztöne der Babys aufgezeichnet werden. Ich hasse das! Es ist ein lautes, manchmal kruschelndes Geräusch, fump fump fump, ähnlich dem, das man hört, wenn man sich mit dem Finger rhythmisch im Ohr bohrt. Es ist so intim, dass mir manchmal ganz schlecht davon wird und ich will, dass es aufhört. Ich finde es obszön und unpassend, dass man mir die Herzgeräusche anderer Lebewesen aufzwingt, ich finde das eine Grenzüberschreitung in alle Richtungen, in meine, in die der Babys, und die der Schwangeren. Ich halte meine eigenen Herzgeräusche schon kaum aus, und auch die von T. finde ich nicht immer einfach beruhigend oder schön, im Gegenteil, in mir erzeugt das Hören von Herztönen eine Unruhe, eine Nervosität, eine diffuse ANGST. Keine Ahnung warum. Kann es so unangenehm gewesen sein im Bauch meiner Mutter? Hat es mich da schon nervös gemacht? Oder macht es mir Angst, weil es aufhören könnte, das Geräusch? Weil durch das Schlagen klar wird, dass es sich um einen Muskel handelt, eine Innerei, ein Organ, so banal wie komplex, dem es egal ist, wie es dir geht oder was aus dir wird, es macht seinen Job, den Rest machst du oder auch nicht. Brutale Natur, kein Schischi, hier wird gelebt oder auch nicht. Wie es gelebt wird und warum und wer es lebt, ist dem Herz egal.
Ich fasse fest meine Zeitschrift an, da im Wartezimmer, und versuche keine schwitzigen Hände zu kriegen und mich auf was anderes zu konzentrieren, Rezepte, Portraits, die Fashion-Strecke. Manche Babys haben unregelmäßige Herztöne, so dass man sich schon Sorgen macht, manche zarte, schwache, andere schnelle, kräftige oder präzise. Die schwangeren Frauen kommen dann raus, aus diesem Hinterzimmer, und es ist komisch, sie zu sehen, weil man gehört hat, was in ihrem Bauch vor sich geht. Wer da so drin ist. Dabei geht mich das nichts an. Dabei will ich das gar nicht wissen! Aber es scheint niemanden zu stören, außer mich. Die Leute scheinen eher gerührt. Ich verstehe, dass Eltern weinen, wenn sie das Herz ihres Kindes im Ultraschall schlagen sehen, wirklich, ich verstehe das. Aber als ich aufgerufen werde, bin ich wieder mal so froh, dass ich nicht wegen Schwangerschaft da bin.
Dezember 2015 – der Nazi in dir
Kenne den Nazi in Dir,
sag ich immer.
Ich mags nicht, wenn die Leute denken, sie seien keine Nazis, keine Rassisten. Ich halte das sogar für gefährlich.
Ich bin beides, oft, ausgiebig und manchmal erschreckend gerne.
Wenn ich einen Schwarzen sehe, der neben einer dicken blonden Frau mit großem Hintern herläuft, die einen Buggy mit Kind drin schiebt, denke ich: Alles klar.
Wenn ich einen jungen Türken oder Araber sehe, der in der U-Bahn-Station rumcheckt, denke ich: Dealer. Und ich denke nicht: Junger, südländisch aussehender Mann mit dunklen Haaren, sondern ich denke: Türke oder Araber.
Wenn ich eine Sinti-Roma-Frau mit ihrem Kind in der U-Bahn betteln sehe, denke ich: Das ist doch scheiße, schick dein Kind in die Schule.
Wenn ich eine dicke, kleine Türkin mit Kopftuch und bodenlangem Mantel sehe, die mit zwei Hackenporsches auf dem Markt einkauft, und kaum Luft kriegt, dann denke ich, klar, dein einziger Lebensinhalt ist ja auch, die Familie zu füttern, kein Wunder dass du demnächst Diabetes und einen Herzinfarkt kriegst.
Wenn ich eine Frau mit Tschador sehe, die sich in der Parfüambteilung der Galeria Kaufhof versucht verständlich zu machen, denke ich, Alte, nimm den Lappen vom Gesicht, dann gehts besser.
Wenn ich einen Mann mit Siegelring und Gebetskette in der Hand breitbeinig und mit dickem Bauch inmitten von drei verhuschten Kopftuch-Frauen und einem Haufen Kinder sehe, denke ich: Ehrenmord.
So geht das den ganzen Tag. Aber ich weiß das.
Und das ist der Unterschied. Ich weiß, dass ich ein Nazi bin, ich kenne den Nazi in mir. Und der Nazi in mir, der hat Angst, dass die Flüchtlinge ihm die Wohnung wegnehmen, die er selber nicht findet, und den Job, z.B. dass sie Bücher schreiben oder Radiosendungen machen, weil sie im Gegensatz zu mir was zu erzählen haben, dass sie gefördert werden und man sich um sie kümmert, wo ich doch zuerst da war mit diesem Bedürfnis, und niemand darauf reagiert hat, Angst, alles noch schlimmer wird in unseren Schulen und auf unseren Straßen. Aber bloß weil ich ein Nazi bin, renn ich deswegen nicht gleich los und heul bei Pegida rum oder wähl die AfD.
Dezember 2015 – short story
An einem eintägigen Speed-Writing Kurs teilgenommen:
Um 9 Uhr bekam man fünf, sechs Fotos, zwei Musik-Clips zur Anregung. Bis 12 Uhr 30 war Zeit für den ersten Entwurf. Um 14 Uhr gab es Feedback der Dozentin. Bis 17 Uhr war Zeit zur Überarbeitung. Fertig, die Speed-Story.
Um 9 Uhr hab ich mir das Material angeschaut. Dann hab ich gefrühstückt und weiter das Material angeschaut, im Hirn hats geschoben und gebrutzelt. Dann hab ich angefangen zu schreiben. Bis 12 Uhr 30 war ich einmal durch. Hammer! Erstaunliches Gefühl. Dann Feedback – danke, sehr brauchbar! Einarbeitung, Verunsicherung, Umarbeitung – Schluss jetzt, mehr geht nicht.
Das Ergebnis: Meine erste Kurzgeschichte. Ich weiß nicht, ob ich und wie ich irgendjemand erklären kann, was das für mich bedeutet! Die Prosa-Angst ist überwunden!
Check it out:
Italien
„Susanna sitzt im Auto“, dachte Susanna. Sie hatte sich angewöhnt, ihre eigenen Zustände zu beschreiben wie kleine Nachrichten, die man über jemanden verbreitet. Kleine Sensationen. „Susanna kauft ein!“ „Susanna föhnt sich die Haare!“ War ihr Leben so langweilig, dass sie es für sich selbst interessant machen musste?, fragte sie sich. Lag es daran, dass sie wie alle begonnen hatte, die Welt in Form von Kurznachrichten wahrzunehmen? Oder lag es daran, dass es ihr das Gefühl gab, über sie werde gesprochen wie über ein Kind: „Susanna hat heute zum ersten Mal gelacht“. „Susanna läuft jetzt“.
Sie hätte mit dem Zug fahren können. Sie hätte den Flieger nehmen können. Kurz hatte sie sogar überlegt, die ganze Sache mit dem Rad anzugehen, sich Etappe für Etappe zu nähern, den Fokus auf den Weg zu legen, statt auf die Zeit vor Ort. Sie wäre mit einem angenehm erprobten Körper angekommen, gewappnet und voller Energie. Sie hatte sich fürs Auto entschieden.
Sie drückte unbestimmt auf den Knöpfen des High-Tech-Radios herum, das in den Mietwagen eingebaut war, bis es ansprang, und italienische Musik zu hören war. Sie musste lachen und an ihren Vater denken, von dem sie als Kind aus ihrer Rücksitz-Perspektive über Stunden nur die rechte Körperhälfte gesehen hatte, vor allem seinen kräftigen Unterarm am Steuer des VW Käfers. Auf ihre Fragerei, sind wir schon in Italien? Sind wir schon in Italien?, hatte er immer „den Radiotest“ mit ihr gemacht: Wenn italienische Musik kommt – dann sind wir in Italien! Er drehte am Knopf des Radios und schaltete gleich wieder aus, wenn etwas anderes zu hören war. Kam aber italienische Musik, schrien sie beide wie aus einem Mund: Itaalien!!! als sei das Schönste passiert, was passieren konnte. Dabei wandte er sich zu ihr um, löste für einen Moment seinen Arm vom Steuer, streckte ihn nach ihr aus und sie sah in seine lachenden, dunklen Augen. Meistens waren sie da erst in der Schweiz, aber bis zur Grenze wollte er sie und sich nicht warten lassen. Zumal sie da meistens schon schlief.
Susanna sah im Rückspiegel ein Auto auf sich zuschießen und wechselte rasch von der linken auf die rechte Spur, für einen Moment spürte sie die Panik in sich aufflackern, die sie bisher gut im Griff gehabt hatte. Seit dem Unfall ihres Vaters hatte sie sich nicht mehr an das Steuer eines Autos gesetzt. Das war jetzt drei Wochen her.
Sie setzte sich mit Kaffee, einer kleinen Flasche Wasser und einer Tüte voller Leckereien, die sie in einer Bäckerei gekauft hatte, an den kleinen Strand. Sie hatte den See, zu dem der Strand gehörte, vom Autofenster aus gesehen und gerade noch rechtzeitig die Abfahrt genommen.
Ein Kind spielte selbstvergessen im Sand und sprach vor sich hin. Seine Mutter las, wie Susanna auf dem Boden sitzend, die nackten Füße vor sich in den Sand gestellt, Zeitung. Die beiden lächelten sich kurz zu. Die Frau trug eine Sonnenbrille.
Susanna erinnerte sich, ihrer Mutter als Kind die Sonnenbrille oft vom Gesicht gezogen zu haben. Ihre Mutter trug ständig Sonnenbrillen, liebte Sonnenbrillen, hatte eine ganze Sammlung davon in verschiedenen Stilen, die ihr allesamt fantastisch standen.
Wenn Susanna, die genau wie ihr Vater ihre Mutter verzweifelt liebte, auf ihrem Schoß saß, hatte die Sonnenbrille immer einen Widerwillen in ihr ausgelöst. Wenn sie versuchte, sie ihr abzuziehen oder sie ihr spielerisch abzunehmen, wurde ihre Mutter ärgerlich. Sie stand auf, sodass Susanna von ihrem Schoß rutschte, setzte die Brille wieder auf, wandte ihr für einen Moment ihr schönes, verdunkeltes Gesicht zu, um sie dann stehen zu lassen und sich mit jemand anderem zu beschäftigen.
Der Sonnenbrillentick hatte erst aufgehört, als ihre Mutter Ilona kennen gelernt hatte.
Susanna nahm einen der beiden Rollkoffer aus dem Kofferraum des Autos und ging auf das kleine, weiß getünchte Haus zu, vor dem zwei Vespas parkten. Jeden Sommer hatte ihr Vater, während sie spielte oder las oder ihm half, an diesem Haus gebaut, auch dann noch, als ihre Mutter mit Ilona zusammen gekommen war, auch dann noch, als sie mit ihr nach Hamburg gezogen war und die beiden sich kaum noch sahen.
Sie wäre gerne noch einen Moment stehen geblieben und hätte sich Zeit gelassen, aber sie musste davon ausgehen, dass ihre Ankunft innen bereits bemerkt worden war. Also drückte sie auf die Klingel. Die Tür ging auf, und sie sah in das Gesicht ihrer Mutter. „Susanna“, sagte sie lächelnd, „ich freu mich so“. Sie ging auf sie zu, und umarmte sie.
Hinter ihrer Mutter stand Ilona im Türrahmen. Sie schaute ihr freundlich entgegen, und begrüßte sie mit Küsschen links rechts.
Wie geht es euch? fragte Susanna in der Küche und sah in die Gesichter der beiden Frauen, die älter geworden waren, so wie sie älter geworden war. Es geht uns gut, sagten sie, und nickten. Sie fragten, wonach ihr war, vielleicht nach einem Getränk, einem Snack, einer Dusche? Doch Susanna legte nur wortlos ihren Koffer auf die Seite, öffnete ihn, holte die Urne heraus, die sie mit Gaffertape zugeklebt hatte und stellte sie auf den Tisch.
Die beiden sahen sie erschrocken an.
Ilona ruderte das kleine Fischerboot, Susanna und ihre Mutter saßen sich schweigend gegenüber und sahen aufs Meer. Susanna hielt die Urne fest auf ihrem Schoß.
Warum bist du damals in das Haus gezogen, fragte Susanna und beugte sich ein wenig über den Rand des Bootes, um den Wellen zuzuschauen, die daran schlugen. Du wolltest doch früher nie mit uns nach Italien.
Deswegen, sagte ihre Mutter. Es klang wie eine Frage. Susanna sah sie an. Die Falten hatten ihren Gesichtsausdruck wärmer gemacht. Ihr dichtes Haar trug sie noch immer hochgesteckt, das helle Blond inzwischen von weiß durchzogen. Susanna dachte an das Foto von ihr als junger Frau, das ihr Vater von ihr gemacht haben musste, in dem Jahr, in dem sie sich bei ihrem Urlaub in Italien kennen gelernt hatten. Sie stand neben einer Vespa, die sie alleine hatte fahren wollen, darauf hatte sie bestanden. Nicht bei ihm hinten drauf. Ihr Vater hatte immer erzählt, wie sehr ihn das beeindruckt hatte.
Susanna bat Ilona anzuhalten. Sie küsste die Urne, öffnete sie, und verstreute die Asche ihres Vaters im Meer.
Als sie zurück waren, im Haus, und zusammen zu Abend aßen, eröffnete ihre Mutter ihr, dass sie und Ilona zurück nach Hamburg ziehen wollten. Was passiert mit dem Haus, fragte Susanna. Vielleicht möchtest du es ja haben, sagte ihre Mutter.
Susanna sah aus dem Fenster, das nun, da es schattiger geworden war, offen stand und das Licht herein ließ. Italien, dachte sie.
Und zum ersten Mal seit Wochen kam es ihr nicht in den Sinn, eine Nachricht daraus zu machen.
Berlin, den 19.12.2015
Dezember 2015 – Krankheit als Scheiße
Ich hasse es, wenn Leute sagen, Krankheit sei eine Chance.
Da liest man dann schöne Geschichten in Zeitschriften, von Menschen, die Manager waren oder Werbefuzzis oder Bankerinnen, und dann sind sie krank geworden und haben über ihr Leben nachgedacht und jetzt machen sie ein Cafe mit Bio-vegan oder verkaufen selbst gezüchteten Honig oder helfen Menschen in Flüchtlingsnot.
Krankheit als Scheiße.
Krankheit ist verlorene, vertane Zeit, Krankheit klaut kostbare Lebenszeit, Zeit, in der man gezwungen ist, sich rund um die Uhr mit etwas zu beschäftigen, mit dem man sich nicht beschäftigen will, nämlich mit ihr und ihren Bedürfnissen. Zeit, in der man Angst hat, dass man nie wieder in Freiheit wird leben können, dass sie einen auf ewig gängeln wird, die Krankheit, dass sie einen für immer unter der Rute halten wird, bestimmen wird, wer man ist, wie man aussieht, sich bewegt, was man isst und trinkt, wie oft man Sex hat und wie der Tag abläuft. Krankheit ist ein Ego-Monster. Krankheit ist ein Arschloch, das dir sagt, wo’s langgeht.
Möglich, dass Krankheit ne Chance ist für Leute, die vorher koksende Angeber-Arschlöcher waren, die dachten, ihnen kann nie was passieren, und wem was passiert, der ist ein Idiot und Versager. Für die ist Krankheit ne Chance, sich mal in Demut vor den anderen zu begeben. Aber nein, sie begeben sich wenn dann in Demut vor „dem Leben an sich“ oder „den kleinen Dingen“ und immer noch nicht vor den anderen. Und denken auf diese Weise sind sie wieder Herr im Haus.
Aber nur weil sie hinterher Honig züchten und ihre Leben entschleunigen und ein Buch über ihre Krankheit schreiben und zum ersten Mal ihren Kindern ins Gesicht sehen, sind sie noch lange nicht netter. Sie bilden sich immer noch voll was ein auf sich, und jetzt eben auch noch auf ihre Krankheit, denn es kommen ja Leute und schreiben Artikel über sie. Und wenn du am Ende immer noch krank bist, dann weil du im Gegensatz zu ihnen nicht kapiert hast, was die Krankheit dir sagen will. Weil du nichts draus gemacht hast. Krankheit als Leistung.
Krankheit als Chance my ass.
Dezember 2015 – Fensterputz
Heute ein Fensterputzer in unserem Hausflur. Krass. Das gab’s hier in den ganzen vier Jahren nicht, in denen ich hier wohne.
Wahrscheinlich gibt’s morgen ne Mieterhöhung.
November 2015 – Jessica Jones
In Bikerboots, Jeans und Lederjacke stiefelt Jessica Jones durch ein klassisches brick-building-New York, vorbei an den Anzugtypen, den Obdachlosen, den Hipster-ladies und den Food-truck-Immigranten, die die Stadt und ihre Vielfalt schon immer am besten repräsentiert haben. Die lights sind blurry, die tunes eher jazzy, nehmen dann aber auch gerne mal Fahrt auf. Jessica ist kein nettes Mädchen. Sie ist angry. Sad. Und ziemlich abgegessen.
Dass ihr ein Trauma widerfahren sein muss, merken wir schnell. Sie hat Flashbacks, ähnlich wie ein Soldat mit Posttraumatischen Belastungssyndrom. Ihren Job als PI – Private Investigator – erledigt sie von ihrer eher herunter gekommenen Wohnung aus, die gleichzeitig ihr Büro ist. Ein großer Schreibtisch, eine Film-Noir-Jalousie und eine Whiskyflasche in der Schublade, zu der Jessica gern greift, geben der Sache den richtigen Humphrey Look. Wenn sie ihre Füße in den Boots auf den Tisch legt, ist das ein Moment, in dem es ihr sichtlich Spaß macht, ein Mädchen in einem klassischen Männergenre zu sein. Das Milchglasfenster in der Eingangstür mit der Aufschrift „Alias Investigations“, ist zerbrochen, und nur notdürftig mit Karton abgeklebt, wird aber im Laufe der ersten Staffel ausgetauscht.
Ihr Jobs erledigt Jessica rasch und ohne große Empathie. Im Endeffekt wühlt sie ja doch immer nur im Dreck der anderen oder wühlt den Dreck der anderen auf.
Dass Jessica eine Superheldin ist, spielt für sie und die ersten Folgen zumindest auf der Action-Ebene so gut wie keine Rolle. Selten hat eine Superhelden-Comic Verfilmung so angenehm langsam und auf Augenhöhe mit dem zivilen Protagonisten gespielt. Jessica will keine Superheldin sein und auch mit ihren ehemaligen Kollegen nichts zu tun haben. Das Kostümchen, das sie früher mal getragen hat, kommt ihr und uns vor wie ein Witz, so als wolle man eine kampferprobte Amazone in ein rosa Tütü zwingen. Sie kann auch gar nicht viel Supermäßiges. Sie hat viel Kraft, und kein Problem, ein Auto festzuhalten oder ein paar Typen oder Sachen zusammen zu schlagen. was ihr in ihrem Job zugute kommt. Im großen und ganzen hält sie es aber diskret mit ihren Kräften und so wirkt das eher wie ein Teil ihrer Job Description. Jessica kann nicht mal fliegen, nur hoch springen. Und so kommt sie einem vor wie die Schmalspur-Version einer Superheldin, bei der mitten im Umbauprozess (wie meistens bei Superhelden ein Unfall, ihre Eltern und ihr Bruder sind dabei gestorben) was nicht zuende geführt worden ist. Das gibt ihr etwas angenehm dysfunktionales, und macht sie zu einem ungeheuer glaubwürdigen, modernen, sympathischen Mädchen.
Ihr großer Gegenspieler taucht lange nicht in persona auf. auch das erzählerisch eine kluge Entscheidung. Der Mann, der für ihr Trauma verantwortlich ist, nimmt über einen Fall zu ihr Kontakt auf. Als sie begreift, dass der Mind Fucker Kilgrave, der sie über Jahre im Griff hatte, und sie bis zu einem Mord manipuliert hat, zurück in der Stadt ist, will sie nichts anderes als: Weg! Nur weg, so weit wie möglich. Das Schicksal einer jungen Frau, die Kilgrave in einem Hotelzimmer festhält, missbraucht und sie am Ende dazu bringt, ihre Eltern zu erschießen, appelliert aber an ihr Verantwortungsgefühl. Sie folgt ihrem Ruf, denn sie und ihre Freundin Trish, eine erfolgreiche Radiomoderatorin, zu der sie ein schwesterliches Verhältnis hat, wissen: Wenn einer eine Chance hat, Kilgrave unschädlich zu machen, dann ist es Jessica.
Außerdem gibts noch tolle Nachbarn (einen Junkie und ein crazy Zwillingspaar), einen schwarzen Barkeeper – ihr love interest, einen Ken-artigen Polizisten, der zu militaristischem Übereifer neigt, eine beinharte lesbische Anwältin und natürlich so klassische Superhelden-Story-Zutaten wie Kraftverstärkung, wissenschafltiche Experimente, Föten und Potions.
November 2015 – Wohnungssuche
Unfassbar frustrierend.
Mein Sozialneid ist auf dem Höchststand seit Aufzeichnung.
Ich kann nicht anders als es persönlich nehmen.
Seit 16 Jahren bin ich in dieser Stadt. Was hab ich hier gekämpft. Um ein bisschen Anerkennung, um einen Job, der mich, gerade so, über die Runden bringt, der mir die Möglichkeit gibt, jetzt, endlich mal, eine Wohnung zu wollen, die hübsch ist, und hell, und renoviert und nach meinem Geschmack und mit Balkon, nicht groß, aber großzügig.
Und jetzt sehe ich an den Häusern hoch und denke, wieso wohn ich da nicht, oder da? Wieso hatte ich nicht das Talent, mich rechtzeitig irgendwo reinzusetzen und einfach nie wieder wegzugehen, so dass heute die WG-Mitglieder ausgezogen und ich als einzige übrig in einer Riesenwohnung mit Uralt-Mietvertrag bin? Wieso hab ich keine Eltern, die mir beizeiten Geld in den Arsch geschoben haben, um mir eine hübsche Eigentumswohnung in Mitte zu kaufen?
Plötzlich sehe ich Leute mit Geld aus diesen Häusern kommen. Junge Leute mit Zukunft, Eltern, Jobs aufgrund schneller, brauchbarer Ausbildungen. Selbstbewusste Frauen, die alles wollen, Kind, Kochen und Kunst. Leute, die alles richtig gemacht haben. Leute, die besser sind, unerreichbar besser sind, obwohl sie nicht besser sind. Oder doch?
Ich will verdammt nochmal eine schöne Wohnung in guter Lage, zum ersten Mal in meinem Leben.
Ja, ist das denn zu viel verlangt?
November 2015 – zwei
Sie hat viel Angst. Vor allem im Dunkeln. Sie will ein gutes Kind sein, aber ihre Enttäuschung und ihre Wut werden immer größer und sie weiß nicht mehr, warum sie noch länger gut sein soll. Sie muss immer nur warten. Vor dem Lageso, in der Unterkunft. In der nächsten Unterkunft. Die anderen ziehen an ihr vorbei, bei dem geht es schneller, die ist schon in einer Willkommensklasse, warum fangen alle ihr Leben an, nur sie nicht. Sie hat sich das anders vorgestellt, ihr Bruder hat sich das anders vorgestellt, der den Schleppern viel Geld bezahlt hat. Sie ist es nicht gewohnt, schlecht behandelt zu werden, z.B. von der Sozialarbeiterin der Unterkunft, sie ist eine Prinzessin. Sie ist was besonderes, das hat ihre familie ihr gesagt. Sie ist zur Schule gegangen, ein Großstadtkind, sie kann Englisch. Deutsch zu lernen fällt ihr leicht. Es gibt viele Menschen, die ihr helfen, sie in ihre Wohnung aufnehmen, ihr einen Computer schenken, ihr zeigen, wie man die Bibliothek benutzt. Sie ist in Berlin. Gemeldet. Sie kann nicht sehen, dass ihr viel Gutes passiert, dass sie einen Vorsprung hat. Sie weiß es, aber sie kann es nicht fühlen. Sie sagt nicht danke. Die ärztliche Untersuchung ergibt, dass sie volljährig ist. Sie sagt, sie ist 17 gewesen, als sie ankam. Si emag es nicht, eine Identifzierungskarte vorzuzeigen, auf der eine Lüge steht: ihr Geburtsdatum, das die Behörden eingetragen haben. Afghanistan wird demnächst vielleicht als sicheres Herkunftsland eingestuft. Sie besucht jetzt eine Willkommensklasse, aber das geht nur, weil sich jemand persönlich für sie eingesetzt und die Schule sich bereit erklärt hat.
Er ist aus einer ländlichen Gegend. Er kann kein Englisch, nur Dari. Er lernt zuerst das Alphabet. Dann Deutsch. Aber das ist schwierig für ihn, noch nie hat er einen Fremdsprache gelernt, andere Lernmethoden als zuhause, eine andere Sprachstruktur. Er ist ein junger Mann, Anfang zwanzig, er könnte in Kabul leben, untertauchen in der großen Stadt, die Taliban die seinen Vater ermordet haben, würden ihn dort nicht finden, sagen die Behörden. Noch ist er geduldet. Er darf nicht in Berlin sein, er muss in Brandenburg in der Unterkunft sein. Aber in Berlin sind die Helfer, die Mentoren. Also ist er trotzdem in Berlin. Er geht in eine Hauptschule, weil sich jemand dafür eingesetzt hat, und die Schule ihn genommen hat, aber er wird den Abschluss nicht schaffen, es ist alles zu viel. Die Helfer sind enttäuscht und versuchen es nicht zu sein. Er wird hier geduldet sein, auf lange Zeit. Eine lange Zeit in der er nicht arbeiten darf, in einer brandenburgischen Unterkunft leben soll, und keinen Deutschkurs finanziert bekommt.
Wir schaffen das!
November 2015 – Entscheidungen
BVG-Abo für 2016 kaufen oder nie mehr U-Bahn fahren wegen Terrorangst?
Wegen Terror sterben oder wegen Fahrradunfall?
Einkaufszentren meiden? Supermärkte? Bibiliotheken? Kirchen ist einfach.
Wo würdest du zuschlagen, wenn du Islamist wärst?
T. sagt: Im Berghain.
November 2015 – Maki
Ich sehe zu, wie die Sojasauce aus dem Kussmaul des mitgelieferten Plastikfischs in den mit Paprika, Gurke, Kürbis und Spinat gefüllten Maki-Röllchen versickert, als wären es kleine Blumentöpfe.
Der Gartenzaun, der den eingelegten Ingwer und den Wasabi-Tupfen von den Röllchen trennt, ist aus grünem Papier. Die Röllchen schmiegen sich eng aneinander in ihrem Verschlag und wollen auch nicht gerne voneinander lassen, als ich sie eins nach dem anderen, die hintere Reihe von links nach rechts, die vordere von rechts nach links, mit den Stäbchen hochnehme und verputze.
Ich könnte sie auch nach Farben sortiert essen, oder die Reihen abwechseln, aber mir ist nicht danach. Ich will mein Essen mechanisch und effektiv, in der Hoffnung, es könnte sich auf den Rest des Tages und meine Arbeit auswirken.
November 2015 – Paris
Wir würden z.B. in der Weserstraße sitzen, wie wir das manchmal tun, in einer Bar, draußen, weil es noch so schön ist. Ungewöhnlich warm für November.
Wir würden quatschen und lachen und was trinken, eine Zigarette rauchen und uns über die aktuelle Flüchtlingssituation oder die Wohnungssuche oder Beziehungsprobleme unterhalten. Die Passanten würden im Vorbeigehen auf unsere Tische gucken, ab und an würde ein Radfahrer vorbeifahren oder ein Auto versuchen sich in eine Parklücke zu quetschen.
Dann würden drei Leute herbeilaufen, plötzlich, wie aus dem Nichts kommend, und schon wegen ihrer Geschwindigkeit, wegen des Adrenalins, das sie verströmen, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, und ein absurdes Bild abgeben, denn sie sind mit Maschinengewehren bewaffnet.
Sie würden Allah Akbar brüllen und obwohl sich der ein oder andere hier doch gerade noch eine Zigarette angezündet oder einen Schluck seines Getränks genommen oder einen Satz oder Gedanken noch nicht beendet hat, würde eine ohrenbetäubende Salve an Schüssen aus ihren Gewehren kommen und du würdest den, der dir gegenüber sitzt, aufplatzen und zusammensacken sehen, das gleiche Staunen im Gesicht wie du, der du eine Sekunde später getroffen wirst.
Für einen Moment hast du noch Zeit, alle Angst dieser Welt zu haben, und vielleicht im Abklang sogar noch einen Funken Hass.
Und das war’s.
November 2015 – Miranda
Ich war bei Miranda July.
Ich war sogar oben bei ihr, auf dem Podium, um ein Buch signieren zu lassen, das mir gar nicht gehört. Ich bin in der langen Schlange angestanden, um sie zu sehen, um ihr dabei zuzusehen, wie sie in das Buch ihren Namen schreibt. Ich hab sie angeschaut, ein bisschen verstohlen von unten rauf wahrscheinlich, wie das so ist, wenn man jemand gerne anschauen will und es einem peinlich ist, weil es ist wie eine kleine Gier.
Ich hab gestaunt über ihre Schminke, die ihr Gesicht so flächig, präzise und puppenhaft japanisch wirken lässt, über ihre Konzentration und ihre typisch amerikanische Anstrengung mit Leichtigkeit professionell, sprich sozial, sprich witzig zu sein.
Erstaunlich auch: Sie hat dem Typen auf dem Podium, den der Veranstalter ihr als Moderator zur Seite gestellt hat, immer wieder die Handkante gegeben, ihn mehrfach abgewatscht, in einem offensichtlichen Gender-Kontext, anti die männliche Selbstgefälligkeit – was ich von ihr, trotz ihrer Texte, nicht vermutet hätte.
Und der ganze Laden voll mit Frauen. Frauen auch am Mikro, zu dem man vorlaufen muss, und in das man auf Englisch Fragen stellen muss. Und dann da oben sie. Eine Frau, allen voran. Ein VORBILD. Wann haben wir das zuletzt erlebt. Ich fand’s herrlich.
Die Amerikaner glauben an Vorbilder. Ich hab früher nie daran geglaubt, das liegt an meinem deutschen Autoritätsskeptizismus, heute tu ich das. Es ist gut, sich ab und an eine Frau anzugucken, die vorne oben ist, die Orientierung bietet, Trost, Halt, und ein bisschen Neidpotential, nicht so viel, dass es einen abwürgt, sondern so viel, dass es einen motiviert, und die ein Wissen darüber hat, was und dass es auf dieser Welt als Frau nicht einfach ist. (Zumal wenn man keine Mutter vor der Nase hat, die irgendetwas davon bietet).
Mutter, Schwester, Freundin, Geliebte, Miranda. Komm gut nach Hause! Und es tut mir leid, dass ich auf deine Frage: How are you? vor Aufregung nicht geantwortet habe. I’m good. Thank you.
November 2015 – irre gut
Heute großartiger Text von Rainald Goetz in der FAZ. Genauer: verschriftlichte Rede anlässlich des Georg Büchner Preises.
Einer, der anders als all die anderen immer wieder so wahnsinnig begeistert, wahnsinnig traurig, wahnsinnig wütend ist, über alles, was ihm begegnet.
Ein Brenner, Verbrenner. Einer um den man sich sorgt, aber um den man sich keine Sorgen machen muss, er ist ja am Leben.
Aktuell gehts um Jugend und Altern.
Ich zitiere a:
Diese gigantische Kaputtheit : entsteht aus lauter kleinen schlechten Erfahrungen, die man dauernd mit sich selbst und anderen macht, und es werden im Lauf des Lebens immer mehr. Das schlimmste an ihnen ist ihre totale Banalität. Das macht sie unerzählbar.
…und b:
Selten wird es gesagt: In welchem Ausmaß die Produktion von Kunst, die ein Element des Ekstatischen braucht, durch das Altern beschädigt, ruiniert, verunmöglicht wird. Das Leben zerstört die innere Stimme.
…
ich bin mir nicht sicher, ob letzteres auf mich zutrifft, ich hoffe noch immer, meine innere Stimme zu finden, auf dem Weg zu ihr zu sein und ich war ihr als Jugendliche sicher weniger nah als heute. Trotzdem kommt es mir sehr wahr vor, im Allgemeinen.
Der Text, in dem es auch noch um alle möglichen anderen Sachen geht, aber wie immer im Grunde die Frage stellt, wie muss mans machen, damits richtig ist, und geht das überhaupt, endet mit einem Zitat aus dem Song Bologna von Wanda:
Wenn jemand fragt, wofür du stehst, sag AMORE, Amore.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
November 2015 – Die Merkelisierung des eigenen Gesichts
Interessant, wie man sich altern sieht, im Angesicht der anderen.
Die gleichen stürzenden Falten von den Mundwinkeln zum Kinn, die gleichen, sich langsam tiefer grabenden Linien zwischen Nase und Mundwinkeln, die gleichen, matschigen Lider, die auf den Augen liegenbleiben wie Couch Potatoes auf dem Sofa, und zieht man die Augenbrauen noch so hoch.
Die schlaff werdende Haut am Kinn, die an ruckendes Geflügel denken lässt, die kommaförmigen, wie mit Kohlestift gemalten Schatten, die vom Augenwinkel Richtung Wange zeigen. Die Querfalten auf der Stirn, die Hochfalten zwischen den Brauen, die strahlenförmigen Falten an den Augen.
All das haben wir gemein, Frau Merkel und ich. Aber so ist das eben, denn auch ich erlebe ja schließlich Fukushima und die Flüchtlingskrise, auch ich reibe mich auf an der internationalen Klima- und Finanzpolitik, den Wirkweisen des globalen Kapitalismus, den Terroranschlägen und Korruptionsskandalen, dem NSU Prozess und der NSA Affäre, wenn auch meistens anders.
So kann man ihr zusehen, jeden Tag, in den Nachrichten, der langsamen Merkelisierung des eigenen Gesichts.
Oktober 2015 – gay fantasy
Ich erzähle T. vom Planeten Mars. Nicht, dass ich da war, aber ich habe viel darüber gelesen in letzter Zeit.
T. hört sinnierend zu.
Dann fällt ihm was dazu ein. Ein Freund von ihm hat vor Jahren mal gesagt, Männer und Frauen sollten besser auf verschiedenen Planeten wohnen.
Ich nehme an, sage ich, er wollte die Frauen zum Mond schießen, weil er das Gefühl hatte, sie kommen vom Mars.
Exactly.
Eine Welt voller Männer, sage ich, viel Spaß.
Wer sich jedenfalls freuen würde, überlegen wir weiter, sind die gays. Alle Hetero-Männer würden mit ihnen schlafen wollen. Natürlich würden die Hetero-Männer die gays nach kürzester Zeit zu Sklaven machen. Das machen die immer so. Am Anfang fänden die gays das noch ganz geil, und es gäbe wilde Parties. Aber dann nicht mehr. Die gays würden einen gay-Aufstand machen und die gay-Weltherrschaft übernehmen. Ab sofort bestimmen sie, wer wie mit ihnen schlafen darf. Und von nun an werden sie behandelt wie die Könige. Ralf Könige. – Falls er darüber einen Comic machen will, kann er die Idee haben.
Soviel zu T.s und meiner gay fantasy.
Oktober 2015 – Taschenwerbung
Die größte Künstlerin im Bereich Taschenwerbung ist Michelle Williams. Sie ist überhaupt eine große Künstlerin, aber in Sachen Taschenwerbung macht ihr keiner was vor.
Sie hält diese (meist sehr großen, und immer wieder überraschend scheußlichen) A-Liga-Designer-Taschen in einer derart komplexen Mischung aus Dokumentation, Verspieltheit, Dominanz und Pussy-Analogie vor ihren schmalen Körper, dass es eine Freude ist.
Ich blättere Fashion-Zeitschriften inzwischen gezielt auf Michelle Williamssche Taschenwerbung durch, um mir anzuschauen, was sie sich diesmal wieder ausgedacht hat. Manchmal versteckt sie sich dahinter, hält die Tasche vor sich wie ein Schild. Manchmal scheint sie alle Geheimnisse ihres Unterbewusstseins darin aufbewahrt zu haben, selbst verwirrt und verstört davon, aber ohne Möglichkeit, sich davon zu trennen. Manchmal ist die Tasche eine Waffe. Manchmal etwas, auf dem man sich ausruhen kann, in der Not. Etwas, woran man sich klammern kann, wenn man im dunklen Wald verloren geht.
Eine Tasche ist eine stabile Sache für eine verletzliche Person, wie Michelle eine ist. Sie spendet Trost und gibt Selbstvertrauen. Hast du eine Tasche dabei, kann dir nichts passieren. Taschen sind treu. Sie verlassen dich nicht. Eine Tasche hängt an dir und du an ihr, Tasche und Frau stützen sich gegenseitig. Wie Haustiere können sie süß sein und klein, oder edel und groß, oder stolz und arrogant.
Die Taschen werden nie geöffnet. Das ist eine Grundregel der Hochglanz-Magazin-Taschenwerbung und wird auch von Michelle niemals durchbrochen. Der innere Taschenaufbau wird nicht gezeigt. Das ist tabu.
Und natürlich kann Michelle alles sein, was sie will, mit so einer Tasche. Eine Konkurrentin, der keiner so leicht die Tasche wegnimmt. Eine Geliebte, die immer alles parat hat, was man für einen One-Night-Stand braucht. Eine Jägerin. Eine Sammlerin. Eine Kriegerin. Ein Kind.
Eine Tasche ist ein großes Versprechen, wenn Michelle sie präsentiert. Sie verweist auf all die kleinen Dinge, die sich in ihr befinden, und von denen wir niemals erfahren werden, die Michelle, die Taschenträgerin, aber braucht, um sie selbst zu sein. Um für einen kleinen Moment in eine Privatheit zu schlüpfen, im Taxi oder auf der Toilette. Um die Kreditkarten zu sortieren, ein Telefonat zu führen, einen Spiegel aufzuklappen, Haar, Make-up, Lippenstift zu kontrollieren, sich einen Tampon reinzuschieben, eine Ersatzstrumpfhose anzuziehen, in Münzen zu kramen. Um dann wieder raus zu gehen, und dem Wind zu trotzen und sich der Öffentlichkeit zu stellen, genannt die Welt und das Leben.
Nie will ich die Taschen haben, wenn ich die Werbung sehe.
Immer will ich Michelle Williams haben.
Oder sein.
September 2015 – tapfer
Meine Physiotherapeutin sagt mir heute, ich sei tapfer.
Eine tapfere Frau.
Was ist das, tapfer? Was genau meint das?
Früher waren Krieger tapfer. Oder Ritter. Prinz Eisenherz wurde als tapfer bezeichnet. Winnetou, der tapfere Indianer. Heute ist das aus der Mode. In Game of Thrones ist niemand mehr tapfer. Die würden sich allesamt verbitten, sich als tapfer bezeichnen zu lassen. Tapfer ist was für Schwächlinge. Für Kinder, die nachher ein Spielzeug kriegen oder ein Eis. Wer tapfer ist, lässt sich was gefallen. Wer tapfer ist, handelt nicht. Er erduldet sein Schicksal, erträgt seine Schmerzen, akzeptiert seine Pein. Er opfert sich auf. Und das ausdauernd. Statt sein Schicksal in die Hand zu nehmen! Es zu wenden! – Wer tapfer ist, wehrt sich nicht. Tapfer ist reaktiv, depressiv.
Wie muss man umgehen, mit Krankheit? Ich weiß es nicht.
Muss man sie annehmen, hinnehmen, aushalten, durchstehen, auf sie hören, muss man ihr etwas entgegnen, gegen sie ankämpfen, sie ignorieren? Und wenn ja, was heißt das alles? Muss man das Beste draus machen? Muss man zufrieden sein, mit dem was noch geht? – Ich kann nicht mehr im Kino sitzen, aber dafür kann ich in der letzten Reihe stehen. Ich kann nicht mehr reisen, dafür suche ich mir ne Wohnung mit Balkon. Die Einschränkungen austricksen. (Wie erbärmlich das ist. Wem reicht das schon. Niemandem. Und trotzdem machen alle weiter. Weil man so hängt, am Leben, ein Trick der Natur). Oder muss man die Krankheit herausfordern, an die Grenze gehen des noch Möglichen oder viel weiter (Paralympics, Selbstmord)?
Ich weiß es nicht.
Meine Erfahrung: Der Krankheit ist es egal, wie du mit ihr umgehst. Es ist eine dieser billigen menschlichen Überhöhungen zu glauben, man habe Einfluss auf sie. Die Krankheit ist, wie alles andere in diesem Universum auch, brutal. Sie hat nichts mit dir zu tun. Sie verteilt sich nach Gutdünken, agiert nach Gutdünken, mordet und brandschatzt nach Gutdünken. Sie ist dein Feind, aber auch das ist ihr egal. Sie hat nichts mit Psycho zu tun oder mit Schuld oder Stress. Kein Medikament, keine Operation beeindrucken sie nachhaltig. Sie ist einfach da, und wenn man Glück hat, geht sie wieder weg. Du bist ihr egal. Dein Verhalten ihr gegenüber ist ihr egal. Das hat auch was Tröstliches: Du bist nicht gemeint.
Aber ich bin ein Mensch und ich muss mich verhalten. Wie also verhalte ich mich? Kann ich wenigstens das frei entscheiden? (Natürlich nicht.)
Wenn ich nachts in meiner Wohnung herumstehe, weil ich vor Schmerzen nicht schlafen kann, was mache ich dann? Wie verhalte ich mich zu diesem Diktat?
Ich weiß es nicht.
September 2015 – Zufall
Ich treffe T. auf der Straße. Zufällig. Er kommt mit seinem Fahrrad die Torstraße hochgeschossen, weißes T-Shirt, rot-schwarzer Helm, im üblichen Straßenverkehrs-Kampfsport-Modus. Ich hetze zu Fuß die Torstraße runter, das Handy in der Hand, bin spät dran für meinen ersten Gebärdensprachkurs, und finde die Scheißhausnummer nicht. Als wir uns entdecken, brauchen wir jeder eine überraschte Millisekunde, um uns einzuordnen. Wir müssen lachen. Kurzer Austausch: Du hier, achja, ich dort. Wir stehen auf dem Gehweg, umarmen uns kurz, küssen uns, und rennen jeder wieder seiner Wege. Ein witziger, schöner Moment.
Ein bisschen seltsam, peinlich aber auch. Warum?
Weil wir Fremde sind. Zwei Fremde in einer Stadt.
Weil wir auch aneinander vorbeifahren könnten. Hier, jetzt, in diesem Moment, ohne uns überhaupt zu registrieren. Irgendein Typ auf dem Rad, irgendeine Frau mit dem Handy, millionenfach passiert das am Tag.
Wir könnten uns auch nicht kennen.
Alles könnte ganz anders sein.
Nicht in einem Parallel-Leben, im selben Leben!
Wir könnten uns noch nie gesehen haben oder gerade jetzt zum ersten Mal. Vielleicht hätten uns Zeit und Raum für genau diese selbe Millisekunde zusammengebracht, und wir wären achtlos aneinander vorbei gegangen. Vielleicht hätten wir uns in dieser Millisekunde angeschaut, und nicht mal ansatzweise sympathisch oder interessant gefunden, geschweige denn attraktiv.
Wir könnten auch andere Leben haben. In denen wir mit anderen zusammen wären, andere Freunde hätten, andere Berufe, andere Lebensgeschichten. Wir hätten Gefühle für andere entwickelt.
All die Verbindungen – die Erlebnisse, Dramen, Streits, der Sex, die Reisen, das Glück, der Ärger, der Kummer, die Wut, das Durchhalten, das Weitermachen, das Dranbleiben, das Lachen, das Schreien, sprich: die Liebe – von einer Sekunde auf die andere ist klar, das hat sich zufällig ergeben. Wir sind austauschbar. Wir könnten uns austauschen. Alles könnte auch anders sein. Wir sind zwei Monaden, die unabhängig voneinander existieren und sterben. Wir haben jeder ein eigenes Leben. Wir werden zurückkehren, in diese eigenen Leben, wenn wir uns trennen.
Wir wissen nicht immer und zu jeder Zeit, wo der andere ist. Er ist auf einem anderen Weg. Und man kann nie wissen, wann der vom eigenen Weg wegführt.
Das ist es, wobei wir uns so seltsam ertappt, weswegen wir uns ein bisschen peinlich berührt fühlen.
Dass unsere Leben uns zusammengeführt haben, dass wir die Verbindung herstellen konnten:
Für einen Moment, ist das alles ein großer Zufall.
Es ist ein Wunder.
Ein Glück.
September 2015 – Schluckbeschwerden
Ich kann keine Tabletten schlucken. Schrecklich. Und ich muss seit Monaten viele Tabletten schlucken, so viele wie noch nie in meinem Leben. Was ist das wieder für ein Psycho-Kack. Wie viele Tabletten ich schon angeschwitzt in den Ausguss gespuckt habe! Ich bin praktisch der Hauptgrund für die Zunahme der Resistenzen aufgrund von zuviel Medikamenten in der Kanalisation/dem Leitungswasser. Aber es geht nicht, ich krieg sie nicht runter. Sie schwimmen in meinem Mund herum, mit ihren kratzigen Oberflächen oder ihren kokonartigen Konsistenzen; sie schwappen von links nach rechts, unterstützt vom üblichen Schluck Wasser, aber wenn ich zum Schlucken ansetze, landen sie in meiner Nase oder drängen seitlich zum Mund raus wie bei einem Halbseitengelähmten.
Seufz.
Also trickse ich mich aus.
Ich mache das, was man mit Tieren macht: Ich mische mir die Tabletten ins Futter.
Ich kaue eine Banane und stopfe die Tablette zum entstehenden Brei in den Mund. Man muss den richtigen Moment abpassen, die Banane darf noch nicht zu breiig sein, aber auch nicht zu fest. Man muss sie ordentlich hin und her schieben, die Bananenbröckchen, im Mund, sonst beißt man auf die Tablette und dann ist es vorbei. Aber so gehts. Nur so. Runter mit dem Ding. Und nur mit Banane. Und im Moment des Runterschluckens wendet man am besten ein verbales Tätscheln an, und sagt: Tablette gut, Tablette guuut für dich.
August 2015 – Amtsgericht
Ich muss vor Gericht.
Als Zeugin.
Die Hausverwaltung hat dem crazy guy (siehe vorn) gekündigt.
Ich bin ein bisschen aufgeregt. Aber, das muss man sagen, auch sehr gut vorbereitet. Schließlich sehe ich seit frühster Kindheit Gerichtsserien. Zuerst das Bayrische Amtsgericht. Später dann Ally McBeel, Für alle Fälle Amy, Richterin Barbara Salesch, Boston Legal, The Good Wife, Suits, usw. Also wenn einer weiß, wies bei Gericht läuft, dann ich. Ich weiß sehr genau, was passieren kann, mit Zeugen wie mir.
Sie werden unter Druck gesetzt. Sie werden von der gegnerischen Seite bloßgestellt, in Widersprüche verwickelt, ihre Glaubwürdigkeit wird in Frage gestellt. Sie fallen durch geschickte Manipulation der gegnerischen Anwälte ihrem eigenen Narzissmus zum Opfer oder ihrer Naivität und werden somit nutzlos für den Anwalt. Sie brechen heulend im Zeugenstand zusammen oder schlagen schamvoll die Augen nieder, wenn sie am Ende am Anwalt vorbeigehen, dem sie doch eigentlich helfen wollten.
Aber nicht mit mir. Ich versichere mich vorsichtshalber nochmal mithilfe meines Mietvertrags, wo ich eigentlich wohne. Da bin ich mir nämlich nicht so sicher und ich möchte nicht, dass der Anwalt der Gegenseite höhnisch äußert, Entschuldigung, Herr Kollege, aber ihre Zeugin, die weiß ja noch nicht mal wo sie wohnt. Die Sache ist nämlich die: Da es in unserem Haus ein Hochparterre gibt, denke ich immer, ich wohne im fünften Stock. Stimmt aber nicht: Laut Vertrag wohne ich im vierten. Außerdem wohne ich rechts, würde ich sagen. Jedenfalls aus der Subjektive betrachtet,also wenn man den Treppenaufgang zur Wohnung hochgeht. Aber ist die subjektive die offizielle Perspektive? Oder ist die offizielle die, die man hat, wenn man vor dem Haus steht? Dann wohne ich nämlich links.
4.OG re ergibt die Recherche im Mietvertrag. Da kann mir also schon mal keiner was. Und seit wann wohne ich eigentlich hier? Oh Gott, auch das weiß ich nicht. 3 Jahre, 4 Jahre? Auch hier gibt der Vertrag Auskunft: 2011. 4 Jahre?! Ich muss endlich raus aus diesem Loch.
Ein zweites Problem scheint mir zu sein, dass ich nicht Buch geführt habe. Über die Schreierei vom crazy guy. Auf scharfe Nachfragen nach Dauer, Art, Häufigkeit und konkrete Daten der Schreierei kann ich keine adäquate Auskunft geben. Ab und zu mal, manchmal mehr, manchmal weniger, dann mal wieder ne Weile nicht – das sind keine soliden Antworten für ein Gericht. „Ich habe nicht Buch geführt“, höre ich mich trotzig auf die entsprechende Frage antworten, und Trotz kommt gar nicht gut an, vor Gericht. „So? Warum haben Sie denn nicht Buch geführt? Dann kanns ja nicht so schlimm gewesen sein“ Ein wiederkehrendes: Ich kann mich nicht erinnern, ich kann mich nicht erinnern, der Zeugin spielt der Gegenseite in die Hände und lässt die Zeugin, also mich, unzurechnungsfähig wirken. So langsam mach ich mir Sorgen.
Ich scrolle meine alten Mails durch. Da. Vor einem Jahr ist mir tatsächlich mal der Kragen geplatzt. Ich habe eine Mail an den Hausverwalter geschrieben, die Situation geschildert, die so aussah, dass der Schreier 24 Stunden durchgeschrien hatte, und ich (zuhause) arbeiten musste. Außerdem erkläre ich darin, dass die Stimmung im Haus gereizt ist, und dass es zwar verständlich, aber wenig hilfreich ist, dass ein anderer Nachbar jetzt immer über den Hof zurück schreit. Ich habe die Mail mit der Frage beendet, ob er schon mal was unternommen, zum Beispiel den psychosozialen Dienst angerufen hätte. Ach, Herzchen. Gekündigt ham Se ihm. Und das hier ist ne Beschwerde-Mail, mach dir nichts vor. Vielleicht haben sie mich deswegen eingeladen? Und ich muss jetzt den armen Psycho da unten denunzieren? Eine nie abgeschickte Mail an den P.soz.Dienst finde ich auch noch.
Das Amtsgericht an der Littenstraße entpuppt sich zu meiner Überraschug als Riesengebäude mit ehrwürdiger Innenhalle, Böden, die jedem Schritt eine erhabene Wichtigkeit verleihen, und jedes Gespräch zu einem Murmelton herunterdimmen. Außerdem gibts ellenlange Gänge zum Verlaufen. Ich komme gerade noch pünktlich und trete ein. (Steht auf dem Schild an der Tür, dass man das soll).
Es geht um eine Dachrinne. Du liebe Zeit. Da studiert man Jura und dann wälzt man Maschendrahtzaunstreitigkeitsakten zu Dachrinnen. Da hätte ich ja keinen Bock drauf. Trotzdem gefällt mir das alles ganz gut. Die Bänke. Die Robe. Die noch recht junge Richterin mit ihrer strengen Attitüde. Schwarze lange Haare nach hinten. Hager im Gesicht. Vor nicht allzu langer Zeit bestimmt noch eine saugute, ehrgeizige Studentin. Jetzt proud to be a judge. Die Abstraktion. Der Fall. Die Wahrheit. Hier werden die Dinge auf eine andere Ebene gehoben. Man nimmt den Dampf raus. Den emotionalen. Man bezieht sich auf Regeln, auf andere Urteile, auf Kommentare. Am Ende vergleicht man sich meistens. Man strebt eine Einigung vor Gericht an. Auch ein bisschen gesunder Menschenverstand spielt eine Rolle. Aber nach Möglichkeit nicht.
Dann sind wir dran. Zu meiner Überraschung ist auch mein Hausverwalter als Zeuge geladen. Aber klar, er ist ja nicht der Vermieter. Er hat nur die ganzen Beschwerdemails, -anrufe, -whatsapp-Nachrichten und sms bekommen, mit den Schimpfereien, Hetzereien, Mahnungen, Drohungen der Nachbarn.
Die Richterin klärt uns Zeugen auf. Wir müssen die Wahrheit sagen. Ich nicke verständig. Dann schickt sie uns raus, zuerst will sie sich mit den beiden Anwälten besprechen.
Auf der Holzbank (es ist immer eine Holzbank) erzählt mir der Hausverwalter genervt, dass der crazy guy neulich das Fenster im seiner Wohnung eingeschlagen hat, deshalb muss er jetzt nachher auch noch zur Polizei. Ich erschrecke. Hat er sich weh getan? Der HVW zuckt mit den Achseln, scheint die Frage eher irritierend zu finden. Ich denke, vielleicht ist er ja doch gefährlich, der Schreihals. Haben Sie schon mal mit ihm geredet?, frag er mich. Nein, sag ich. Und habe ein schlechtes Gewissen. Guten Tag gesagt hab ich, und er hat immer zurück Guten Tag gesagt. Aber ich hab nie mit ihm geredet. Warum schreist du eigentlich immer so?, hätte ich sagen können. Aber ich fand das nicht angebracht. Was soll er sagen? Weil ich ne Meise hab. Muss ich jemanden dazu zwingen, das zu sagen? Oder ist das nur ein bürgerlicher verkrampfter Scheiß und ein bisschen mehr impulsive Direktheit hätte der Sache gut getan?
Wir werden wieder reingerufen. Es geht los. Ich bin bereit, auszusagen. Ich finde jetzt, in diesem Moment, es steht in keinem Verhältnis, dass 30 Leute leiden, weil einer leidet. ich werde alles erzählen, was ich weiß, meine Eindrücke schildern, offen und ehrlich. Sagen, dass es mir unangenehm ist, gegen so einen armen Tropf auszusagen, aber dass ich es für richtig halte, wenn die Situation geändert wird. Das alles werde ich sagen, in ruhigem Ton, mit kompetenter Stimme.
Die Anwältin bedankt sich bei mir fürs Kommen und erklärt, dass meine Dienste nicht mehr notwendig sind.
Später, auf dem Gang, sprech ich den Anwalt vom crazy guy an. Er ist eine gerichtliche, vom gesetzlichen Betreuer bestellte Vertretung, erklärt er mir. Er hat also einen Betreuer, der Schreihals. Der hat aber einen schlechten Job gemacht bis jetzt. Noch nie habe ich jemanden bei ihm gesehen, nur den Pizza-Jungen oder den Drogendealer. Was passiert jetzt mit ihm? will ich wissen. Er wird geräumt und dann kommt er ins betreute Wohnen. Das ist gut, sage ich. Das ist doch gut. Ich bin erleichtert. Er braucht doch jemanden, der sich um ihn kümmert. Damit er isst und sich wäscht. Er ist nicht mehr allein und man zwingt ihn ein bisschen zu seinem Glück. change can be good. Right?
Alles Gute, crazy guy.
August 2015 – true quotes 2
Do you wanna know a secret about depression? – It’s all in your head.
(Mr. Healy in Orange ist the New Black zu Soso).
August 2015 – Narkolepsie
So langsam fühl ich mich Guantanamo. Folter durch Schlafentzug. 3:45. 2:30 oder mit viel Glück auch mal 4:50. wecken mich die Schmerzen auf.
Der Schlaf kämpft gegen die Schmerzen, die Schmerzen gegen den Schlaf. Kampf der Giganten. Wer schläft, der büßt mit Schmerzen.
also stehe, gehe, stehe, gehe, sitze ich ein bisschen. schalte das blaue Licht ein, das für die Nachbarn aussehen muss wie entferntes Schützenfeuer. Mir erzählt es tröstliche Geschichten. Ablenkungsmanöver auf Netflix, Youtube. Unter anderem – kann das Zufall sein? – sehe ich ein Video über Narkolepsie.
eine junge Frau, ein gestandener Mann, fallen in Schlaf. fall asleep. einfach so. ganz plötzlich, von einer Sekunde auf die andere.
mehrmals täglich: Schlaf.
sacken in sich zusammen, im Stehen, im Sitzen,
und schlafen, schlafen. schlafen.
im Moment größter Ekstase, größter Anspannung, verabschieden sie sich in eine Tiefschlafphase, stundenlang, zu den ungehörigsten Zeiten, an den ungehörigsten Orten, in den unpassendsten Momenten.
übermannt von Schlaf.
(Ich weiß, das ist kein Spaß, aber) jetzt, hier, in diesem Moment, denke ich:
Wie herrlich muss das sein!
Wie sehr ich sie beneide!
August 2015 – Wildkräutersalat
Neulich am Alex. Ein attraktiver junger Mann drückt mir eine schöne, große Packpapier-Tüte in die Hand, oben verschlossen. Da haben Sie was zu essen! strahlt er mich an. Okay, ich weiß, sowieso schon „born with rings under my eyes“, in letzter Zeit wenig Schlaf, was die Sache nicht besser macht, insgesamt eher junkiehaftes Aussehen – aber dass man mir jetzt schon Care-Pakete auf der Straße überreicht, in der Annahme ich sei bedürftig und obdachlos, schockiert mich doch.
Ich mach die Tüte auf und da ist das ein dickes Promotion-Paket einer Firma, die ich hier aus Gründen der Diskretion nicht nenne werde. Darin: Wildkräutersalat mit Dressing, Nektarinen, Pfifferlingen, Kartoffeln, alles frisch, in abgestimmter Menge und ökologisch sinnvoll verpackt, plus ein übersichtlich gestaltetes, leicht verständliches Rezept. Toll! Ich gehe nach Hause, koche, esse alles auf, obwohl es für zwei Personen ist und habe ein schlechtes Gewissen.
Hätte ich die Tüte nicht einfach direkt an jemanden weitergeben sollen, der bedürftig und obdachlos ist? Aber ein Obdachloser kann keine Kartoffeln im Backofen brutzeln und keine Pfifferlinge mit Nektarinen in der Pfanne anschmoren, weil es auf der Straße keinen Strom gibt. Aber den Wildkräutersalat! Den hätte er essen können. Gut, einen Schuss Olivenöl fürs Dressing hätte er gebraucht, aber sonst? Essen Obdachlose Wildkräutersalat mit Balsamicoessig oder sagen die, lass mal, Fleischsalat mit Majo vom Lidl wär mir lieber, ich brauch schließlich Kraft. Oder ist das ein unverschämtes Vorurteil? Vielleicht ist ihnen egal, was sie essen, hauptsache Essen, na gut, dann halt Wildkräutersalat. Vielleicht hätte ich den Obdachlosen einladen sollen. Guck mal, ich hab hier ne Tüte, schön was kochen, für den Obdachlosen und mich, schließlich war es für zwei. Damit er eine warme Mahlzeit hat.
Ach, herrje.
Juli 2015 – Selbstgespräche
ich bin ein großer fan von selbstgesprächen. ich unterhalte mich wirklich sehr gerne mit mir. das einzige, was mich dabei stört, sind die anderen.
wenn ich auf der straße lang laufe, und das tue ich oft und gerne, dann rede ich gerne vor mich hin. da bin ich so im flow, da fließts. ich diskutiere mit anderen, vervollständige situationen, lache, vor allem aber wüte ich vor mich hin. kommen andere vorbei, wird’s peinlich, wobei mir das mit zunehmendem alter zunehmend egal ist. ich hoffe immer nur, dass niemand dabei ist, den ich kenne, denn das macht mir bis jetzt immerhin noch was aus.
neulich mal wieder: ich spreche beherzt vor mich hin, fühle mich gestört, weil mir jemand entgegen kommt – in solchen fällen senke ich die stimme oder verstumme kurz, und setze wieder ein, kaum ist die person an mir vorbei. in berlin kommt ja dauernd jemand vorbei, das nervt dann manchmal so, dass ich nicht die klappe halte, man will ja nicht dauernd unterbrochen werden, wenn man gerade im gespräch ist. red ich also weiter wie gehabt. wenn ich jemanden schon von etwas weiter sehe, halte ich manchmal zur Tarnung die hand ans ohr und mache kurz mhm, ja, mhm – dann denken manche noch, ich halte ein handy ans ohr oder hab nen kopfhörer drin, (bild ich mir ein, dass die das denken) – jedenfalls, ich bin gerade in fahrt, keine lust, die klappe zu halten, ich rede weiter und im vorbeigehen sehe ich, scheiße, den kenn ich. er guckt pikiert. ein netter mensch, grüßt aber besser nicht, man möchte ja auch nicht stören, ich versteh schon. man möchte ja auch niemanden beschämen, das ist nett, danke.
ich stell mir vor, wie er es anderen erzählt: neulich hab ich die auf der straße gesehen, da hat sie vor sich hingeredet. naja, er weiß ja, dass ich schreibe, solche leute ham ja gern mal ein bisschen kopfkino am laufen. wie gesagt, je älter ich werde und je mehr ich meine selbstgespräche genieße, umso mehr bin ich bereit, zu akzeptieren, dass ich ne verrückte alte bin.
ich erinnere mich, dass mein vater mal angesichts einer passantin, die vor sich hinlächelte, gesagt hat: das könnte ich nicht. das fand ich interessant. hätte ich nicht gedacht, dass für ihn diese kontrolle im sozialen raum so ne rolle spielt. wie unterschiedlich man das wahrnimmt. herrndorf hat das auch irgendwo geschrieben, dass er, wenn er mit der ubahn falsch ausgestiegen ist, irgendwas macht, um das zu vertuschen. ist mir scheißegal, ich geh einfach auf die andere seite und steig in die andere ein. das ist ne großstadt, das verliert sich, denke ich mir, mich registriert sowieso keiner.
außerdem, mit irgendjemand muss man ja reden.
Juli 2015 – true quotes 1
I need help reacting to something
(Abed in „Community“ hilfesuchend zu seinen Freunden, da konfrontiert mit einer für ihn komplizierten sozialen Situation)
Juni 2015 – Reha 13 – Frau Dr.
Frau Dr. S mag ich sofort. Sie ist Ende fünfzig, heißt Katja (alle Namen von der Redaktion gefälscht) mit Vornamen, und erinnert mich an eine SBahn-Abfertigungsfrau, die ich neulich beobachtet habe, weil sie aussah wie aus einem russischen Film der 70er Jahre und ihren Arm um ihre Kollegin gelegt hat. Sie war klein, ein bisschen gestaucht in der post-menopausalen Taille, die Kinder längst groß und aus dem haus, einen Beruf ausübt, an dem sie hängt, weil es ein guter Beruf ist. So ist Frau Dr. S. Acuh sie würde einer langjährigen Kollegin sicher kumpelhaft den Arm um den Hals legen wäre sie hier als osteuropäische Migrantin nicht allein unter deutschen Männerärzten.
Sie redet mit mir und untersucht mich eine Stunde lang.
Der Computer ist nicht ihr Freund. Immer was Neues, sagt sie zu mir, und zu ihm, mit ihrem starken Akzent, und schüttelt ihren Kurzhaarkopf.
Sie fragt, ob ich Kinder habe. Nein. Oh, warum nicht? fragt sie mit ehrlichem Bedauern in der Stimme. Jetzt mag ich sie noch mehr als vorher. Selten ist mir so eine aufrichtige spontane Emotion entgegen gekommen bei diesem Thema und ich freue mich für den Sohn, den sie höchstwahrscheinlich hat und der höchstwahrscheinlich Alexander heißt und aus dem was geworden ist, bei allen Sorgen, die sie mit ihm auch gehabt hat.
Armes Ding sagt sie, als ich ihr von meinen Schmerzen erzähle und all den idiotischen Unverträglichkeiten. Auch das hab ich noch nie gehört. Ein offenes, geradeaus erteiltes Mitleid, eine Art von Sorge, die zu äußern sich kein Arzt einen Zacken aus der Krone brechen würde, und den sie als selbstverständlichen Teil ihres Berufes sieht.
Sie könnte auch Chemikerin sein, in ihrem weißen Kittel, oder in der Küche einer Kantine arbeiten, man würde ihr all das abnehmen und all das würde sie gut machen.
Sie lacht, als ich sage, dass ich nicht mit meinem Freund zusammen wohne, weil wir uns dann besser vertragen.
Sie staunt, als ich ihr sage, ich hätte mir zum Arbeiten eine Art Stehtisch gebaut.
Sie ist nicht zufrieden, als ich das rechte Bein gerade mal 40 Grad hochkriege.
Sie findet, ich hätte mich operieren lassen sollen. (Anders als ihr Chefarzt).
Ich liebe diese Pragmatik.
Wir sind so weit entfernt voneinander, aber sie mag mich. Und ich mag sie.
Als ich die Klinik verlasse, sage ich ihr, dass sie gut auf sich aufpassen soll.
Juni 2015 – Reha 12 – Bandscheibis
Alle, die hier zwischen 30 und 50 sind, hams an der Bandscheibe. Sie sind die Bandscheibis. Eine verschworene Gemeinschaft von hier als jung wahrgenommenen Menschen, die zusammen halten, auch mal einen trinken gehen, und sich über ihre schrecklichen, von der Umwelt nicht nachvollziehbaren Schmerzen, ihre nutzlosen Medikamente und in Sebastians Fall offen über ihre darniederliegende Fick-Kapazität austauschen. Alle haben Ängste und sind gefrustet. Wie soll das weitergehen? Jetzt schon so kaputt? Will man so leben? Die Banscheibis haben eine Tendenz, da draußen einsam und depressiv zu werden, das versteht man hier untereinander.
Der kleine Rest der Jungen hat Knie, Sportunfall. (Fußball, Ski). Die Knie sind uninteressant für die Bandscheibis, die Knie sind heilbar, ne einmalige Sache, die Bandscheibe hingegen ist etwas grundlegend Lebensphilosophisches, die mit den Knien können da nicht mitreden.
Alle anderen, also die Alten, haben das, was die Knie und die Bandscheibis mal kriegen, wenn die Jahre weiter ins Land gezogen sind. Das kann man sich hier schon mal schön angucken: Versteifte Wirbel, verkrümmte Wirbelsäulen, künstliche Hüften, künstliche Bandscheiben, künstliche Kniegelenke, Osteoporose-Brüche an Schulter, Oberarm, Oberschenkel – um jetzt nur mal von den orthopädischen Problemen zu sprechen und nicht die Gefäß-Herz-Hirn-all-over-Krebs-Gastro-Diabetes-Rheuma-Krankheiten zu erwähnen oder auch einfach nur die Gebisse, die hier beim Essen auch mal rausfallen oder im Briefkasten deponiert werden. (Den hier jeder bekommt und in den jeder fünfmal am Tag reinguckt, weils so langweilig ist).
– Als Frau Juni-Schmidt sich beim Essen beklagt, dass die Ärztin ihr das Tramal (Opiat) weggenommen hat, frage ich sie, wie viel sie denn davon genommen hat. 200 Milligramm, sagt sie. What the ?!! In dem Moment wird mir klar, dass die Alten hier alle auf Drogen sind.
– Und was mir auch nicht klar war: Viele Patienten wollen gar nicht als gesund entlassen werden, sie wollen eine Bescheinigung, dass sie krank sind, arbeitsunfähig, berufsunfähig, damit der Job, der sie krank gemacht hat, endlich vorbei ist.
Juni 2015 – Reha 11 – Allein unter Ossis
Ich bin hier praktisch allein unter Ossis. Das ist sehr interessant. Zumal die meisten Patienten ab 70 aufwärts sind, die „Wende“ also in den Biographien unmittelbar ein Rolle gespielt hat. Das ist hier auch ständig Thema. Alle erzählen vom Osten. Im Osten war das ja so. Und nach der Wende hab ich dann. Mein Trabi. 5000 Leute am Ende noch 50. Die Treuhand. Der Westen. Betrieb geschlossen.
Es gibt einen Boden der Gemeinsamkeit auf dem die Ostler sich bewegen: Es geht doch nur noch um Profit. Der Mensch zählt doch nicht mehr. Sie haben uns viel Mist erzählt, aber das war nicht gelogen.
– Eine neue Dame kommt an den Kantinentisch (70, Kardio), an dem Frau Juni-Schmidt und ich schon die alten Hasen sind. Irgendwann während der Unterhaltung berichtet Frau Juni-Schmidt, dass sie Spandauerin ist. Ach, Sie sind aus dem Westen? fragt die Dame. (Sie hatte sich unter Gleichgesinnten gewähnt). Frau Juni-Schmidt spürt die Distanzierung, um nicht zu sagen den eisernen Vorhang der augenblicklich runter geht, und beeilt sich zu sagen, dass sie eigentlich auch Ossi ist. Bis 1958 hat sie in der DDR gelebt. Und dann ist sie geflohen. Zweimal in ihrem Leben ist sie geflohen! Zuerst als Kind mit ihren Eltern aus Pommern. Und dann nochmal 1958, mit ihrem Mann, den Kindern und ihrer „rechten Hand“. Alles stehen und liegen gelassen haben sie, das Haus, die Gärtnerei, und haben in Berlin Spandau wieder von vorne angefangen. Die Dame scheint der Annäherungsversuch nicht zu beeindrucken. Sie schweigt. Vielleicht findet sie, dass es keinen Grund gab aus ihrem Land zu fliehen. Vielleicht findet sie es unsolidarisch in den Westen abzuhauen und Unternehmer zu werden.
Ich hake nochmal nach. Also vor dem Mauerbau sind Sie geflohen? frage ich (und stelle mich damit ebenfalls in Opposition zu Frau Juni-Schmidt – meine Ost-Mimikry funktioniert bisher perfekt, hat noch keiner gemerkt, dass ich ein West-Kind bin). Mich irritiert nämlich die Sache mit der Flucht. Kann man aus einem Land fliehen, das einen doch zumindest 1958 noch nicht dazu gezwungen hat, da zu bleiben? Ist das nicht einfach ein Umzug? Eine freie Lebensentscheidung, seine Existenz lieber in einen anderen Staat zu verlegen? Sie haben alles zurück gelassen. Klingt dramatisch, aber was bedeutet das? – Will ich nach Brasilien auswandern, verkaufe ich meine Möbel, kaufe mir ein Ticket und sobald ich da drüben ne Wohnung hab, kauf ich mir neue Möbel. Ist das eine Flucht? Konnte man das Haus in der DDR nicht verkaufen, die Gärtnerei nicht übergeben? Hat das der Staat einkassiert? Und wenn schon. Was ist die Definition von Flucht? Sorry, irgendwie finde ich, das gildet nicht. Und unterm Strich heißt das doch: Zweimal vor „den Kommunisten“ geflohen. (Die uns je nach Kontext, by the way, befreit haben). Ich würde das niemandem verübeln wollen, und trotzdem liegt bei dieser großen Erzählung ja auch die Nazi-Frage um die Ecke – die keiner mehr stellt, weil die DDR/Mauerfall-Geschichte die Sicht versperrt auf dem linearen historischen Zeitstrahl der allgemeinen Wahrnehmung.
– Diese Kantinen-Unterhaltung spielt sich übrigens vor der Kulisse der Waldsiedlung Bernau ab, in der Honecker und andere ZK-Mitglieder haben hier bis zum Mauerfall abgeschottet vom Rest der Welt gewohnt haben. Heute liegt die Reha-Klinik auf diesem Gelände. Einmal die Woche kommt der ehemalige Förster vorbei und macht eine Führung durch die Siedlung und erzählt Dönekes über die Altvorderen und ihre Sperenzchen. (Ein anderesmal erzählt er über das Rotwild in der Schorfheide, das ist politisch aber doppelt so interessant, weil Leute wie Gaddafi und Strauß gerne hierher gekommen sind, um zu jagen).
– Was mir fehlt, komplett fehlt, und ich nehme an, dass das etwas ist, was alle Ossis haben, ist der Stasi-dar – also der Radar für eifrige Stasi-Mitarbeiter und Polit-Karrieristen. ich verstehe die Signale nicht, kann die Nuancen nicht deuten, die Bemerkungen, Erzählungen nicht einordnen. Da fehlt mir komplett die Kommunikationskompetenz. Nur ein Mann, der mich mit seinen diversen beruflichen Positionen volllabert, und der einen nicht unsympathischen Brechtschen Arbeiterlook mit Schiebermütze und Lederjacke kultiviert, der kommt mir so vor. Aber was weiß ich schon. Vielleicht ist ja auch alles ganz anders.
– Als ich Sebastian (38, Bandscheibe), frage, ob er ein Ostkind ist, zieht er die Augenbrauen hoch als habe man ihn beleidigt. Stolzer Ossi, sagt er, immer gewesen. Er will mit seiner Freundin aufs Konzert von Jan Josef Liefers‘ Band Radio Doria, kann er aber nicht, wegen der Schmerzen. Als ich ihm erzähle, dass ich fürs ZDF Kinderfernsehen arbeite, freut er sich, er kennt die Sendung. Achja? frage ich erstaunt. Klar, sagt er, wir hatten ja auch Westfernsehen, und grinst. (Er kommt aus Oranienburg, nicht aus Dresden.)
Juni 2015 – Reha 10 – Ententeich
Hier gibt’s viele Tiere. Die Menschen haben Freude an Tieren.
Man sitzt auf den Bänken am Ententeich und schaut. Es summt, es brummt, was macht das Tier? Das Highlight des Tages für viele: Enten füttern.
Ein Kind im Rollstuhl jauchzt als die Enten sich um die Brotstückchen kloppen (Hier gibt es ein Haus voll mit Reha-Kindern, Krebs und andere schreckliche Sachen, allein das Schild makes me cry.).
Eine Frau vergisst nicht, eine abseits im Gras gebliebene Ente zu füttern, erklärt, die werde immer von den anderen weggebissen. (Die Frau ist sehr dünn. Ich tippe: anorektisch, aus der Psychosomatik.)
Jeder denkt, er hat die einzigartige Idee, die Enten zu füttern. Die Enten pupsen den ganzen See voll. Oder drehen den tief enttäuschten Brotreinwerfern ihren desinteressierten Arsch zu.
Ansonsten Vögel, die ich noch nie gesehen habe. Eichhörnchen. Ein Kranich sitzt manchmal im Baum über dem Ententeich. Man deutet, man zeigt. Er sieht zu groß aus für den Baum, stakt da raus. Hätte gerne seine Perspektive. Auf uns bewegliche Punkte zum Vollkacken. Ach, und Ratten, die die Brotstückchen auffressen, die am Teichrand liegen geblieben sind.
Die Menschen haben Freude an Tieren. Dann gehen sie in die Kantine und essen sie.
Juni 2015 – Reha 9 – Aussichten
Alle haben Schmerzen. Alle sind traurig und verzweifelt und weinen heimlich in ihren Zimmern. Oder auch mal am Tisch wie Frau Juni-Schmidt.
Die Dinge werden nicht besser. Alles dauert lang und kommt wieder. Manches wird schlimmer. Zum einen kommt noch was anderes dazu. So sind die Aussichten.
Juni 2015 – Reha 8 – Frau Juni-Schmidt
Frau Juni-Schmidt ist 87 und sitzt beim Essen neben mir. Sie hat ihren ersten Namen vom ersten Mann und den zweiten vom zweiten. Seit der gestorben ist, hat sie 5 Kilo zugenommen. Das ärgert sie.
Sie können ja jeden Tag Kuchen essen. Mit Sahne drauf! Sagt sie zu mir. Und Eis. Mein Essen beschäftigt sie. Sie waren ja gar nicht beim Frühstück. Ich hab sie heute im Cafe gesehen, sie haben sich ein Eis geholt. Essen sie nur ein Brot zum Abend? Ich esse ja auch jeden Tag Salat. (Ich hasse Kommentare über mein Essverhalten zu dem sich Frauen Zeit meines Lebens bemüßigt gefühlt haben, aber bei Frau Juni-Schmidt nehm ichs mit Humor).
Sie kommt mit einer erstaunlichen Erkenntnis vom Vortrag der Diätassistentin. (Also das war jetzt mal interessant!). Endlich versteht sie, wieso ihre Schwester, 7 Jahre jünger als sie (also 80), inzwischen aussieht wie eine Gewitterhexe, „also Entschuldigung, ich muss es so sagen“. – Sie ernährt sich falsch! Jeden Tag eine Dosensuppe. Frau Juni-Schmidt hingegen isst jeden Tag frische Petersilie, Gemüse aus dem Garten, also wenn’s danach geht müsste sie hundert werden!
Sie erzählt mir von ihrem zweiten Mann. Den hat sie ja, erzählt sie mir mit leicht gesenkter Stimme, über Anzeige kennen gelernt. Sie hat das Gefühl, das erklären zu müssen. (Für einen Moment überlege ich, ob ich ihr von Tinder erzähle, aber das lass ich lieber). Sie war ja erst Ende fünfzig als der erste gestorben ist. Und immer allein, das war nichts für sie. Sie gibt mir einen Rat mit auf den Weg: Die Chemie muss stimmen. Ich nicke zustimmend. (jetzt vielleicht, Tinder?) Mit dem zweiten hat sie schöne Reisen gemacht, Kreuzfahrten, überall hin, schöne 12 Jahre hat sie mit dem noch gehabt (12, die Rechnung geht irgendwie nicht auf, aber wer mit dem Alter flunkert, hat mein volles Verständnis. Tinder?). Die Kinder haben ihn gemocht. Dann wurde er krank. Sie hat sich ne Polin geholt. So sagt sie das. Die hat bei ihr gewohnt, in dem kleinen Zimmer oben. Mit der hat sie auch Kaffee getrunken. Die hat jeden Tag ihre Mittagspause gemacht, immer von 12 ab, da gabs nix, da ist sie auf ihr Zimmer. Aber sonst war sie immer da, Tag und Nacht. Und man konnte sie bezahlen. Pflege ist so teuer, das ist ihre größte Sorge vorm Heimkommen. Denn ohne Hilfe wird es nicht mehr gehen.
Juni 2015 – Reha 7 – Herr P.
Herr P. geht an Krücken. Und auch das nur mit Mühe. Er wirkt für seine Anfang 70 sehr jung, trainiert, fit, aber sein Bein zieht er hinter sich her, steif, die Hüfte leicht verdreht, es sieht ein bisschen aus wie man das von der Kinderlähmung noch kennt.
Als er mich auf dem Laufband sieht, stellt er sich neben mich und fragt, wie schnell ich denn laufe. 5 km/h. Er sei doppelt so schnell gelaufen, erklärt er mir. Aha? Er war österreichischer Meister im Walking, und Österreich, das bedeutet Berge, schiebt er noch nach. Aber das war bevor der Schlaganfall ihn zum Krüppel gemacht hat. Das Wort spuckt er aus, die Verachtung wird klar. Da ist jemand sehr gekränkt, bitter, dunkel. Ich kann ihn in den nächsten Tagen nur in vorsichtigen Dosen ertragen, obwohl er immer wieder meine Nähe sucht. Wahrscheinlich merkt er, dass ich ihn verstehe.
Er ist kein leichter Kandidat für die Therapeuten. Er langweilt sich, kommt deshalb zu früh in die Mucki-Bude, setzt sich einfach auf Geräte und legt übertrieben los ohne Einführung. Im Bewegungsbad muss der Therapeut ihn zurück aufs Zimmer schicken, weil er unvernünftigerweise gekommen ist, statt mit seinen starken Wadenkrämpfen im Bett zu bleiben. Er hält gerne das knapp getimte Prozedere in den Abläufen auf. Er macht gerne anzügliche Bemerkungen.
Ein paar Tage später begegne ich ihm auf dem Flur, frage ihn, wie es ihm geht.
Sagen Sie es niemand, sagt er zu mir, aber am liebsten würde ich mich einschläfern lassen.
Juni 2015 – Reha 6 – Hüfte 2
Heute in der Mattengruppe. Eine Frau ächzt sich stöhnend auf die Matte am Boden. Der Physiotherapeutin kommt sie irgendwie bekannt vor. Sie runzelt die Stirn. Dann: „Moment mal, sie sind doch ne Hüfte!“ Die Frau nickt schuldbewusst. Die Physiotherapeutin reißt die Tür zum Flur auf, brüllt: „Ich hab hier ne Hüfte in der Wirbelsäulengruppe! Wem gehört denn die?“
Juni 2015 – Reha 5 – Hüfte 1
Heute in der Massenabfertigungsabteilung (Strom, Rad, Motomed), ich höre aus der Nebenkabine: „So. (Vorhang: ratsch), Sie gehen mal da rein und machen das linke Knie frei.“ Protest: „Das Knie? Aber ich bin doch ne Hüfte!“ „Achgott, ich bin schon ganz… Sie sind ne Hüfte. – Hose runter!“
Juni 2015 – Reha 4 – dont believe the hype
Hier sind alle alt und krank oder haben so wie ich Krankheiten, die man erst haben sollte, wenn man alt und krank ist. Das ist sehr interessant. Da verschiebt sich die subjektive Statistik. Man denkt ja immer, wenn man so die Straße runterläuft, alle sind gesund, aber das stimmt nicht, eigentlich sind alle krank. Jeder hat was. Und ziemlich viele ziemlich doll und mehrfach. Die Krankheit ist wie ein Geheimnis, das alle mit sich herumschleppen. Und wenn sie noch nicht offensichtlich ist, dann brütet sie sich gerade aus. Und im Krankenhaus wird sie dann sichtbar gemacht. Da lässt man die Hosen runter, beim Arzt, im MRT, und am Mittagstisch. Vom Fußpilz über Diabetes bis zur versteiften Wirbelsäule ist alles geboten. Nur die Ärzte sehen unsere Welt wie sie ist. Ich misstraue ab sofort den Gesunden, jedem, der mir auf der Straße entgegenkommt. Dont believe the hype.
Reha-Lesson Number 1: Man sieht den Leuten ihre Krankheiten nicht an.
Juni 2015 – Reha 3 – Nike Air vs. Rollator
Der große junge Pfleger, blond, kräftig, sympathisch, mit weicher Haut, fast noch Babyspeck, und der kleine Herr K, knochig, knotig und so krumm, dass er immer auf den Boden schaut, gehen nebeneinander her. Der eine in seinen federleichten, super ergonomischen Nike Airs, der andere auf seinen Rollator gestützt. Ich sehe sie von oben, aus meinem Fenster, wie sie den Weg entlang laufen. Ganz langsam. Im Schneckentempo. Einmal ums Haus, so lautet die Aufgabe. Für Herrn K., aber auch für den Pfleger. Der junge Mann federt, tänzelt, beherrscht sich, dem alten Mann nicht das Gefühl zu geben, er würde am liebsten auf und davon rennen, drei, ach was, zehn Runden hätte er schon geschafft, der Sportjunge, wenn Herr K. nicht wäre. Aber darum gehts hier nicht. Nein. Ein Fuß vor den anderen, das ist Geschwindigkeit genug. Ab und an bleibt Herr K. stehen, und verschnauft. Wendet seinen Kopf in Richtung Pfleger, von unten hoch dreht er sich schildkrötenartig raus, aus seiner verkrümmten Wirbelsäule, und schaut ihn an, ein bisschen verschmitzt wirkt das, und sagt etwas. Der Pfleger lacht dann. Antwortet. Herr K. ist witzig. Die beiden verstehen sich prächtig. Zwischen ihnen ein ganzes Leben, der eine war mal, was der andere ist, der andere wird sein, was der eine ist. Ein rührendes Bild.
Juni 2015 – Reha 2 – 2 und 2
Frau M. ist neunzig Jahre alt, hat ein sehr hübsches, hell strahlendes Gesicht und ganz weiße Haare. Die trägt sie in einem coolen, fedrigen Kurzhaarschnitt, das zusammen mit den Hemden, die sie in ihre Jeanshosen steckt, gibt ihr ein insgesamt apartes, leicht lesbisches Aussehen. Jaja!, sagt sie, wenn man ihr was erzählt, Jaja! In so einem bestätigenden Ton von wegen Natürlich ist das so, klar!
Sie war Mathelehrerin, erst unter Hitler, dann unter Ulbricht. Bis 58 hat sie hier in der Waldsiedlung gewohnt, also noch bevor Honecker und Konsorten da eingezogen sind. Dann ist sie nach Berlin-Ost, um ihre Mutter zu unterstützen, und nach der Wende zu ihrer Tochter nach Franken, wo sie als Versicherungsmathematikerin gearbeitet hat.
2 und 2 bleibt immer 4, sagt sie, egal wer grade dran ist.
Ich bin mir nicht sicher, ob sie recht hat. Aber ich mag sie trotzdem.
Juni 2015 – Reha 1 – die Nudel
Bewegungsbad.
Der Physiotherapeut wirft vom Beckenrand aus meterlange Styropornudeln in Quietschfarben ins Wasser, ein Tiertrainer am Seehundbecken. „Und jetzt klemmen sie sich die Nudel zwischen die Beine: So.“ Der Physiotherapeut macht‘s vor, 10 Erwachsene im Pool machen‘s nach. Die Nudel quietscht, man kämpft mit dem Auftrieb. Dann sitzen alle und dümpeln dahin, eine Gruppe artig paddelnder Seepferdchen mit überdimensionalen, erigiert aus dem Wasser ragenden, pinkfarbenen Penissen – wissend, dass ihre Schamgrenze sich in diesem Moment auf ewig nach unten erweitert hat.
Da geht dann plötzlich auch Nordic Walking.
Juni 2015 – Ameisenleben
ich verstehs nicht.
ich versteh nicht, was das soll.
das lebt und atmet und macht vor sich hin,
bis es dann krank wird oder gleich zerquetscht.
wenn man ein kind ist, und glück hat, dann macht es spaß und dann macht es vielleicht auch im folgenden ab und an mal spaß,
aber so im großen und ganzen – reicht das? dass das wetter gut ist oder das essen? dass das kämpfen keinen unterschied macht, oder der anstand, dass es egal ist, so oder so.
was für eine macht, energie, warp-antrieb! nur am lichter an- und ausknipsen und in der mitte ein bisschen am laufen halten, ein bisschen gerödel und gebange und gefühle fürs lebewesen.
was für ein abrieb im laufe der jahre.
ein ableben.
in den gesichtern und körpern. immer kleiner wird der radius. „immerhin kann ich noch“. „man muss froh sein, dass“.
und dann die eingebaute angst vor dem nichts. vor dem nicht-leben. dem nicht rödeln, bangen, fühlen. damit man sich nicht auflehnt, gegen die macht.
fuck you, universe.
Juni 2015 – Winnetou
Er hing an meiner Zimmertür (medi&zini-Poster), die 70er hindurch, die Silberbüchse im Arm, und war gut. Gut und vertrauenerweckend. Sicher auch, weil er da so lange verlässlich hing, ein Bleichgesicht am Ende beinahe.
Ein Mann mit Werten, den richtigen Werten. Aufrecht, ein Unterdrückter, der nicht bereit war, diese Rolle anzunehmen, jemand, der zu viel wusste und trotzdem zur Freundschaft mit dem Feind fähig war. Sanft, dunkel, langhaarig, ein bisschen fremd, ein bisschen erotisch auch, aber doch eher ein Freund – nicht jemand, den man haben wollte, jemand, der man sein wollte.
Pierre Briece ist tot. Ich bin ein bisschen traurig heute, wie bestimmt viele andere 70er West-Kinder.
.
Juni 2015 – Spritze
Gestern Spritze in den Rücken bekommen: Betäubungsmittel plus Cortison. Die Idee: Schmerzfreiheit des Nervs und Abschwellung der Bandscheibenregion. Da die Cortison-Abgabe nicht von den Kassen bezahlt wird, kostet die Spritze als Privatleistung 60 Euro. (was ich schon GELD ausgegeben habe für diese Krankheit!)
Den Arzt kenne ich vom Beratungsgespräch, er ist irgendwas ostmäßiges, Pole, Russe, Tscheche? Er ist sehr groß und hat ein sehr breites, kastiges, aber doch teigiges Gesicht und meine Hand verschwindet in seiner riesigen Tatze. (Ein Handgeber noch). Warum haben Chirurgen, die die feinsten Arbeiten ausführen, die größten Hände? Ich weiß nicht, warum, aber das ist das, was ich an ihm vertrauenswürdig finde.
Als er in die Tagesklinik kommt, die er sich mit vielen anderen Neurochirurgen teilt, um dort operieren und spritzen zu können, ist das Wartezimmer voll mit ca. 10 Leuten. Er läuft grußlos in seinem weißen Kittel, Ledermappe mit Tablet unterm Arm an ihnen vorbei.
T. und ich sitzen ca. 10 Minuten, dann werde ich von einer Roboter-Schwester aufgerufen (die sind hier alle sehr gut organisiert, alles sitzt, leider deshalb auch etwas sehr unbeteiligt). Ich ziehe Schuhe und Hose in einer Kabine aus. Ich werde von der nächsten Schwester um die Ecke auf Socken im Pulli in den Behandlungsraum geführt, wo ich im Hintergrund vor einem Bildschirm (ich hoffe, es ist ein Bildschirm, das ganze Setting soll eigentlich ein Röntgengerät sein, auf dem man zumindest die Wirbel sieht, zwischen die man sticht, aber alles geht so schnell, dass ich nichts kapiere) den Arzt sehe, der mir zunickt. Ich liege, er tritt heran, pustet großzügig Desinfektionsmittel auf meinen unteren Rücken, sagt:“Zuerst Betäubungsspritze“ mit seinem herrlichen Akzent, und sticht. Es tut kurz weh, ich mache Miau. Das wars, sagt die Schwester. Das wars? frage ich. Sie klebt das Pflaster drauf, das wars, oder Herr Doktor? sagt die Schwester, für eine Millisekunde selbst irritiert im Ablauf. Das wars, sagt er . Ich muss lachen. Sie haben mich ausgetrickst! Das war die Spritze? Ich hab gesehen, dass sie Angst haben, sagt er.
Mai 2015 – Tchibo
Ich übe alt sein.
Ich gehe zu Tchibo und bestelle Kaffee und setze mich ins Fenster und guck raus. Raus bedeutet in die Shopping Mall am Gesundbrunnen-Center, Erdgeschoss. Man hat einen Blick auf Douglas, ein paar Bänke und eine Palme im Riesentopf mit Hydrokultur. Der Wedding läuft vorbei. Da hat man was zu gucken.
Eine Frau setzt sich neben mich, vielleicht 68, und findet das auch.
Kurze Haare, flott gekleidet. Ich bin nett zu ihr, vertraulich. Sie kommt aus Hennigsdorf (Randberlin, wie sie sagt).
Wir reden ein bisschen über die S-Bahn, die wieder fährt, dass man bei Tchibo noch guten Kaffee kriegt (ihre Formulierung), dass man im Hofladen Falkensee Erdbeeren pflücken kann (mein Beitrag), dass sie praktisch von hinter der Mauer kommt (ihr Beitrag).
Als sie sich auf den Hocker hochhievt macht sie eine Bemerkung, dass ich ja noch beweglicher wäre als sie. Sie denkt, ich bin jung und habe andere Probleme als sie, aber das stimmt nicht. Ich bin genauso alt wie sie. Sie sieht nicht, was ich sehe: Zwei ältere Frauen am Tresen bei Tchibo, ein paar nette Worte, eine Begegnung, gegen die Schmerzen in den Gliedern, gegen die Einsamkeit. Darum gehts doch im Leben älterer Menschen, um ein bisschen Trost.
(Als ich gehe fällt mein Blick auf das Mobilfunkangebot von Tchibo, da kann fancy O2 aber preis-leistungsmäßig sowas von gegen abstinken. Ich beschließe, mich ab sofort mit Tchibo einzuloggen, ist ja eh schon altersgemäß. Und der Kaffe ist gut. )
Mai 2015 – Traum
T. sagt, er hat geträumt, ich hätte vier Brüste.
Ich verstehe, aber das ist mir zuviel.
Vielleicht ein dritte, aber nicht in der Mitte zwischen den beiden anderen.
Eher in weiter unter gelegenen Regionen, vielleicht etwas oberhalb der Hüfte, keck in die Beuge zwischen Bauch und Becken gesetzt. Gut erreichbar, für jemand, der unten zugange ist. Und noch kleiner als die anderen müsste sie sein.
Damit könnte ich mich anfreunden.
Mai 2015 – Touri-Italiener
ich stehe an der bushaltestelle.
neben der bushaltestelle, etwas erhöht, auf einer empore, ein touri-italiener, stühle im außenbereich.
ein mann, mitte dreißig, abgerissen aussehend, hält sich am geländer fest. es geht ihm nicht gut.
der kellner (mitte dreißig, gut aussehend) kommt, fragt ihn, ober ihm helfen kann. der mann schüttelt den kopf, winkt ab, redet leise in einer fremden sprache, was ostiges?, eher seltenes, serbo-kroatisch?, sowas.
der kellner insistiert, ambulance? trägt der wind bis zu mir, der kellner beugt seinen kopf, weil der mann so leise redet. „water“ wiederholt er schließlich, was der mann gesagt hat.
er bietet ihm einen platz an einem der tische an (touri-italiener, wohlgemerkt). der mann winkt ab, der kellner bietet ihm nochmal einen platz an, der mann schüttelt den kopf, no money, sagt er, der kellner geht zum tisch, zieht den stuhl auf, die rot-weiß karierte tischdecke flattert.
der kellner verschwindet, der mann setzt sich langsam.
der mann sitzt quer zum tisch, lehnt sich an die wand des restaurants. er atmet, atmet, nimmt den zuckerstreuer vom tisch, schüttet sich den zucker mit gehörigem abstand direkt in den mund, einen dicken, vollen strahl, vielleicht diabetiker?, frage ich mich. er stöhnt, lutscht am zucker.
der kellner kommt, gibt ihm ein glas wasser. er trinkt. der kellner fragt etwas. der mann winkt ab.
der kellner verschwindet. der mann und sein wasser. er streicht sich mit den händen über die oberschenkel, immer wieder.
der kellner kommt zurück, einen teller voll mit brot, ein paar dingen aus der küche in der hand.
der mann sieht den teller an. no money, sagt er. der kellner winkt ab, stellt ihm den teller hin.
in diesem moment, und es liegt sicher daran, dass ich gerade etwas nah am wasser gebaut bin, fange ich an zu weinen.
wie kommt in einer abgefuckten stadt, mit tausenden von abgeschossenen, abgewrackten leuten, die einem hundert mal am tag begegnen, einen mit ihrer je eigenen überlebens-agenda angehen, auf die man, als teil der eigenen überlebens-agenda, in routinierter choreografie reagiert, die attacken abfängt, wie einen ball mit einem lacrosse-schläger, ein junger kellner im italienischen touri-restaurant in einer der übleren abzock-gegenden berlins dazu, diesem mann, schlicht einen platz, etwas zu essen und zu trinken anzubieten, statt zu denken, ach, noch so einer? ist er religiös (barmherzigkeit, weihnachtsgeschichte)? ist er naiv (neu hier, vom dorf)? was stimmt nicht mit dieser stadt, dieser welt, was stimmt nicht mit mir, die das so außergewöhnlich findet und selbst wahrscheinlich niemals getan hätte?!
April 2015 – Laktose
Jetzt gehöre ich auch zu diesen Tussis! Die im Cafe nach laktosefreier Milch fragen. Die im Supermarkt jedes Produkt umdrehen, und misstrauisch die Zutatenliste beäugen. Ich HASSE diese Vergiftungs- Anorexiehaltung, so viele Jahre hat es mich gekostet, das abzutrainieren! So viele Jahre hat es mich gekostet, gern zu essen, den Supermarkt als Schatzkiste zu sehen, in der ich mich bedienen, in der ich tun und lassen kann, was ich will, ein saftiger Ort, der Spaß macht, Lust macht, Impulse zulässt, ein Ort an dem ich den Arm ausstrecken kann, nach etwas greifen kann, mit meinen Händen, weil ich es haben will, weil ich Bock! drauf habe, und es mir zueigen machen kann. Inzwischen auch mal was nehmen kann, was eigentlich schwachsinnig teuer ist. Hart erarbeitet, glücklich etabliert, das Essen als Genuss, als positive Verbindung zum Leben in den letzten 10, 15 Jahren. Und jetzt das. Ich bin frustriert. Wenn alles scheiße ist, sage ich, sagt man: Wenigstens war das Wetter gut oder wenigstens war das Essen lecker!
Joghurt, Käse, Milchkaffee, Kekse, Schokolade, Chips, alles voller Lactose. Nicht mehr, was will ich essen, worauf hab ich Lust, sondern: was kann ich essen, was darf ich essen. Und dann dieses eingeschriebene Konzept des „Sündigens“ – kannst ja was essen mit Lactose, aber dann büßt du, mit Schmerzen. (Wie leicht dreht sich das ins Perverse, wird katholisch, nicht der Genuss ist der Genuss, das Sündigen wird zum Genuss, das Büßen, das schlechte Gewissen, die Bestrafung.) Zu sehr ist mir das der ewige Kampf der Essgestörten, ihrem inneren Schweinehund, eine ständige Ebene im Hirn.
ein paar Tage später: Fructose-Test.
Positiv.
what the fuck, universe?
April 2015 – Die Plakat-Frau
T. erzählt, dass er kürzlich vor einem Plakat stand, in der U-Bahn.
Auf dem Plakat war eine junge Frau, die hat ihm so gut gefallen, dass es gut war, dass die U-Bahn gekommen ist, sonst hätte er sich in sie verliebt.
Der Witz ist: Ich weiß sofort genau, welches Plakat er meint.
Es ist von einer Wohnungsbaugesellschaft und verkündet, dass gebaut wird, 5000 neue Wohnungen sollen entstehen.
Man sieht einen Mann mit Helm und eine junge Frau mit Helm und im Hintergrund eine Baustelle, und wenn das Ganze in schwarz-weiß wäre, dann könnte das ein Foto aus der DDR sein, von sagen wir 1953, als die DDR noch in Ordnung war und für ein paar Jahre vielleicht wirklich das bessere Deutschland. Ein Deutschland zumindest mit Stadtplanungsprojekten, die aus besseren Ideen bestanden als einer Ringautobahn und genau wie die jungen, sympathischen Alltagsmenschen auf den alten DDR-Fotos mit ihren Gesichten und ihren Handbewegungen in eine Zukunft wiesen, die den Menschen gehören sollte und nicht dem Profit oder dem Faschismus. (So jedenfalls die linkswestlich-ostalgische Sicht der Dinge.)
Das Mädchen hat eine Brille auf. Sie ist schlau. Sie hat Architektur studiert oder Stadtplanung, also keinen so ganz typischen Frauenberuf gewählt, wofür man ihr zusätzlich Respekt zollen muss und was ihr eine Aura des soliden Handschlags einbringt. Sie liebt ihre Arbeit, denn die macht Sinn, und so macht sie sie mit Engagement, Freude und aus Überzeugung. Eine Frau, mit der man was aufbauen kann.
Ich verstehe, dass T. sich in sie verliebt.
Ich will nicht, dass T. sich in sie verliebt.
Als ich sie das nächste Mal sehe, finde ich, ihre Brille sieht doof aus und ihr Mund ist klein und komisch. Vielleicht guckt er besser nochmal genauer hin.
Gut, dass er eigentlich immer mit dem Fahrrad fährt.
März 2015 – Lyrik der Schmerzen
Novaminsulfon Ortoton Ibuflam
Milligramm, Milligramm
Tramadol!
Tilidin!!
Arcoxia, Arcoxia
Pantoprazol Omeprazol Prednisolon –
Retard.
März 2015 – Söne Ballon
Gestern im Wartezimmer ein Kind mit einem roten Ballon.
„Ballon“, „Ballon“, feiert es, in tausendfacher Wiederholung, die Herrlichkeit des Ballons, Gemache, Gefummel, Gequietsche, dann kommts, wies kommen muss: Peng, der Ballon ist kaputt. Das Kind, ein Mädchen, vielleicht drei: Unendliches Bedauern. „Hab is puttemacht, de Ballon, kaputtemacht.“ Das Kind jammert und klagt, weint nicht, trauert aber herzzerreißend um den „Söne Ballon“, „söne, söne, Ballon“, während es die elenden Einzelteile vom Boden zupft und eins nach dem anderen in den mannshohen Mülleimer wirft, ein mühevolles und längeres Unterfangen. Als die letzte Klappe fällt, sagt es: „War is nist“ – und läuft davon.
Wow.
Betroffenheit, Schuld, Trauer, noch mehr Schuld, und dann: Abspaltung.
März 2015 – Die Maus
In meinem Bad sitzt eine Maus.
Zuerst ist sie ein Schatten auf meinem Wohnzimmerboden, so schnell und huschig, fumm, fumm, wie ein zweimal auftreffendes Hovercraft auf weißem Fußbodenmeer, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich überhaupt was gesehen habe. Also geh ich dem Schatten nach, ins Bad.
Sie sitzt hinter der Toilette.
Okay… Und jetzt?
Ich bin gleich mit G. auf einen Drink verabredet. Ich überlege, sie im Bad einzusperren, da weiß ich wenigstens wo sie ist. Auch wenn das wahrscheinlich lächerlich ist und sie unter der Tür durchkommt, die wie alles in meiner Wohnung schief und scheckig ist. Ich stopfe eine Decke vor die Badtür, so fest es geht. (Quatsch)
Mit G. gehe ich noch schnell zu Rossmann, der macht nämlich gleich zu. Silberfischchenköder, Mottenpapier, Insektenspray. – wie süß. Bei Obi, meint die Verkäuferin, da kriegen sie ne Mausefalle. Obi macht aber erst morgen wieder auf. Ich gehe was trinken mit G. und dann heim zu meiner Maus.
ich steh vor der geschlossenen Badezimmertür rum.Ich muss aufs Klo und Zähne putzen.Ich kann mir nicht von einer Maus mein Leben diktieren lassen.
Ich öffne die Tür, schließe sie schnell hinter mir. Ich sehe mich um, keine Maus. Setze mich aufs Klo, keine Maus, putze mir die Zähne, keine Maus, sehe nach links – direkt ins Gesicht der Maus. Da sitzt sie, auf Augenhöhe, unter meinem Boiler, auf dem Klettergerüst aus Rohren, etwa drei Zentimeter von dort entfernt, wo gerade noch mein Kopf war, als ich auf der Toilette saß. Sie scheint nicht im mindesten beunruhigt.
Ich verlasse das Bad und hole mein Handy.
Ich mache ungefähr zehn Fotos von der Maus. Kriegt die mich eigentlich mit oder lebt die in einer Parallelwelt? Sie ist hübsch. Grau. Putzt sich. Im Internet steht, Mäuse sind Krankheitsüberträger. Sie muss weg. Vielleicht ist sie ja abgehauen? Vielleicht gehört sie einer Familie und lebt normalerweise im Käfig. Vielleicht bring ich sie morgen mit meiner Obi-Falle um und dann hängt ein Zettel im Hausflur Der kleine Lenni vermisst seine Maus!.Mir egal. ich mach die Tür zu so fest es geht und auch alle anderen zwischen mir und ihr und gehe ins Bett.
Nachts wache ich auf, weil es hinter mir in der Wand kruschelt. Der Rest der Familie ist auf dem Dachboden? Können sie durch das Loch durch aus dem das Heizungsrohr direkt hinterm Kopfkissen entlang läuft? Angeblich können sie durch kugelschreibergroße Löcher schlüpfen, bewegliche Wirbelsäulen, Plattmachgenies.
Am nächsten Morgen kaufe ich bei Obi eine Mausefalle. Das ist interessant. Lebendfallen kosten mehr als Killerfallen. ich entscheide mich nicht nur, aber auch aus Kostengründen für die klassische Genickbruchfalle. Ich finde, ich muss lernen, meine Feinde zu töten. Zumal als Frau. Ich will auch nicht ne lebendige Maus nach unten in den Hof tragen, ich hätte Angst, dass sie mich durch die Gitterstäbe beißt. Außerdem hat die Lebendfalle keinen Ausgang, soll ich sie da mit den Händen rausholen oder wie? Und wenn nicht, dann verhungert sie da elend drin oder wird von einem Fressfeind durch die Gitterstäbe zu Tode gefoltert? Gut, die ganz teure Lebendfalle hat eine Klappe zum Rauslassen – aber sie ist eben auch die ganz teure und come on am Ende ist sie wieder bei mir in der Wohnung?
Der Obi-Mann Gartenbauabteilung zeigt mir gut gelaunt, wie man die Killerfalle spannt. Er hat dicke Gartenhandwerkerfinger und als er die Falle auslöst, macht es ihm gar nichts, dass sein Finger drin ist, warnt mich aber in den höchsten Tönen bloß aufzpassen, dass mir das nicht passiert. Er empfiehlt mir, Schokolade reinzutun oder Speck. Und den Speck, meint er, soll ich anräuchern, da stehen die voll drauf.
Ich präpariere die Falle, kokele mit dem Feuerzeug den Speck an. Es riecht wirklich lecker. (soviel zu wenn ich ne Maus wär)
G., der die Sache nach gestern Abend weiter per Whatsapp mit verfolgt hat, kommentiert mein Fallenfoto mit Oh wie gemein und Ist das Sushi?.
Die Maus verpatzt mir meinen Dreiakter (1: Maus im Bad 2: Mausfalle. 3: gekillte Matschmaus mit Blut aus Röchelmund) und lässt sich nicht fangen.
In den nächsten Tagen schlafe ich unruhig, lausche auf Geräusche, sehe den Schatten am Boden, wenn ich durch mein Wohnzimmer laufe, gehe nicht gerne ins Bad, räume alle Lebensmittel penibel in den Schrank und esse lieber auswärts.
Ein paar Tage später kommt noch der Schädlingsbekämpfer, ein netter, junger Mann mit Rockabilly-Tolle (ach, Berlin, und: wie kommt ein junger Man dazu, so eine Ausbildung zu machen), der Giftköder in umweltfreundlichen Pappfallen auslegt. Das Futter darin ist auf die Jahreszeit abgestimmt, sagt er. Körner und Fett. Nach einer Woche holt er die leeren Fallen enttäuscht wieder ab.
Ich hab die Maus nie wieder gesehen. Nur ein paar Wochen später ihre Schwester, im Hausflur. Vielleicht such ich mir doch mal langsam ne neue Wohnung.

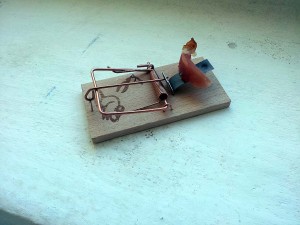
Februar 2015 – Ärzte
Der Schmerz muss weg.
Bewegen sie sich so viel wie möglich.
Manche Leute merken gar nichts, da hat man Befunde, die sehen übel aus, aber die Leute haben keine Beschwerden.
Keine OP! Konservativ behandeln.Wenn Sie was anderes wollen, brauchen sie gar nicht mehr zu mir zu kommen.
OP! Sie haben jetzt seit vier Monaten Schmerzen. Worauf wollen sie noch warten? Darauf dass es besser wird?
Ich kann nicht in sie reingucken, sie müssen die Medikamente ausprobieren. Dann sehen wir, was passiert.
Wer hat ihnen das verschrieben?
Der Nerv ist leicht geschädigt.
Sie müssen den Rücken wieder integrieren in ihr Leben.
Sie sollten sich jetzt nicht so viel bewegen wie sonst.
Stellen sie sich auf die Zehen. Stellen sie sich auf die Fersen.
Ich habe sie jetzt wieder eingerenkt.
Legen sie sich mal hin. 90 Grad links. 40 Grad rechts.
Wir machen mal Ultraschall.
Das Bein wird schwächer.
Das, was ich da gerade in der Hand habe, ist ihre Gebärmutter.
Das ist eigentlich nicht das Mittel der Wahl.
Wir haben drei Möglichkeiten: Spritzen, operieren, oder konservativ behandeln.
Wärme ist gut.
Manche vertragen Wärme nicht, wegen der Entzündung.
Sie haben eine Schmerzerkrankung. Da gibt man immer auch Anti-Depressiva.
Wir hätten in vier Wochen einen Termin.
Ende Mai. Ende Juni.
Februar 2015 – Schmerz
Im Flieger nach Spanien denke ich, ich muss kotzen vor Schmerzen.
Im Auto, im Bett, im Stehen, im Liegen, im Sitzen, ich muss kotzen vor Schmerzen.
Oder muss ich kotzen vor lauter Schmerzmedikamenten?
Ich hab Angst, ich breche entzwei.
Mein Geist: demütig. Ich dulde, erdulde. Warum? Auf der Suche nach der richtigen Haltung.
Schon wieder bin ich hier, Malaga round the corner, runtergedrückt, auf den Boden mit dir!
Warum mach ich das? Gegen Wände rennen.
Der Flug war gebucht. Es war ein Geschenk für P. Ich dachte, das Meer sehen hilft.
Dumme, dumme Hoffnungsimpulse.
Februar 2015 – Zähne
Immer wenn ich depressiv bin, vernachlässige ich meine Zähne. Wie so ein Obdachloser. Ich putze nicht, abends nicht, morgens kurz, Zahnseide ab und zu, aber im großen und ganzen: Säure, Fäulnis, Faulheit, was bringt’s noch, lassen wir’s gären, über Nacht. Ich bin so müde, so erschöpft, ich muss JETZT ins Bett, ich muss hier liegen bleiben, auf dem Sofa, und schlafen, schlafen, Zähne putzen schaff ich nicht mehr, das schaff ich nicht, schaff jetzt ich einfach nicht mehr.
Dann Blut. Panikattacken, es wird zurückgeputzt, viermal am Tag, nachts träume ich vom Zahnausfall, alle Zähne spucke ich in meine Hand, kleine weiße, sandige Krümel, ich fahre im Traum mit der Zunge über die gummierten Kieferknochen, horror. Ich will zur Zahnreinigung, aber die kostet zu viel Geld. Der ewige Kreislauf.
Als ich sie mir dann leiste, bin ich so erleichtert. Genieße das Unangenehme, das Gekratze und Geschabe, den Gestank nach Zahnstein und die ausliefernde Behandlung durch die saubere Schwester im Hygienehandschuh, die mir ihren Busen an die Schulter drückt.
Ein paar Tage wird’s halten.
Januar 2015 – Religion

Gleichzeitigkeiten
4. Januar:
Religion ist Wellness. Sagt die Welt am Sonntag, das Werbeblättchen. Jeder braucht doch was Spirituelles, ein paar Werte, Yoga, Flat White, glutenfreie Nahrungsmittel. Ein bisschen Religion gehört zum guten Ton. Vom Hipster bis zur Oma. Jeder kann mitmachen.
Religion ist (zivilisatorisch-kulturelle) Bedrohung. Siehe oben rechts. Houellebecq spricht über sein neues Buch: Die Unterwerfung. Der Titel spielt mit dem islamischen Glaubenskonzept der Unterwerfung einerseits, andererseits mit der Frage nach „unserer“, also der westlichen Unterwerfung unter den Islam, der in Europa ja bekanntlich „auf dem Vormarsch“ ist. Sind wir schon unterworfen, werden wir unterworfen sein – wenn nur der richtige charismatische Politiker daher kommt, der es schafft, die richtigen Gruppierungen unter einen Hut zu bringen. (Das ist die gute near-topia Idee des Buchs). Und: Vielleicht ist das gar nicht so schlimm? Gut, die Frauen werden nicht mehr so leicht zu haben sein, aber vielleicht trägt ja auch das zur Entspannung bei. So sinniert/lässt Houellebecq weiter sinnieren.
15. Januar:
Religion ist Mord. Zwölf Tote bei Charlie Hebdo. Reingelaufen, Leute erschossen.
Religion ist Wahnsinn.
16. Januar:
Religion ist Politik. Nicht nur Al Kaida, nein,vor allem der IS war’s. Wer zur Hölle ist der IS? Woher hat er seine Waffen? Wieso hören wir zum ersten Mal von denen?
Januar 2015 – Fernweh
Am ersten Abend des neuen Jahres gehe ich ins Kino (Am. Indep. Filmfestival, Babylon Mitte).
Zwei Rentner in Island. Beide natürlich ein bisschen angeschlagen, vom Alter im allgemeinen, vom Renteneintritt, der kürzlichen Scheidung im besonderen. Jeder auf seine Weise, melancholisch der eine, bacchantisch der andere. Wer könnte das nicht verstehen.
Der Film ist ein bisschen schwach auf der Brust, aber das macht nichts, man lehnt sich zurück und guckt Island. Karstige Landschaften, Irland kommt mir in den Sinn, ohne je da gewesen zu sein (ist ja auch nur r und s vertauscht), viel Wasser, Kälte, Diesigkeit, Dunkelheit, Greyness, aber auch saftiges Grün, selbsttätige Erde, kletternde, mit Fell bepackte, dampfatmende Tiere.
Ich kriege Fernweh.
Fernweh ist das Heimweh der Heimatlosen.
Die Endjahresbilanz fällt eher trocken aus. Mutig gewesen, nicht belohnt worden. Geld verlangt, nicht bekommen. Neue Jobs versucht, nicht bekommen. Im Ausland gewesen, zurück gekrochen.
Also gut, Leben, Universum, machen wir einfach weiter, ohne was zu wollen. Wenn es das ist, was du willst.
Und hauen ab, büchsen aus, tauchen ab, drunter weg, schlagen Schnippchen, so oft es geht. Denn Glück gab’s im Urlaub.
Dezember 2014 – L.
Treffe mich mit L.
Freu mich immer sehr über sie und dennoch ist es nie eine gute Idee. Danach gehts mir immer schlecht. Ich denke an das erste Mal als ich sie gesehen habe. Da war schon alles klar. Da war klar, dass sie es schafft, und ich nicht. Dass sie schön ist und ich nicht. Dass sie anders ist als ich und ich nicht. Dass sie jung ist und alles vor sich hat und ich nicht. Dass sie Talent hat und ich ein bisschen was kann. Ich weiß, dass sie es manchmal nicht sieht, und es ihr nicht gut geht, aber das macht die Sache nicht besser, nicht einen Deut. Ich bin ihr nie böse, das kann man gar nicht, dazu ist sie bei allem jung und schön viel zu schlau, aber es tut mir nicht gut, wenn ich sie sehe, und dann denke ich, ich sollte sie nicht mehr treffen. Das macht mich dann traurig.
November 2014 – Fundstück 13

girl under the influence
November 2014 – Fundstück 12

Spatzennovember
November 2014 – Aura
Im Spielzeugladen in den Schönhauser Allee Arkaden, ich stehe, Mission Geschenk kaufen, vertieft ins Angebot vor einem Regal. Spricht mich eine Frau an. Sie ist jung, Mitte 20, hat lange braune, gut frisierte Haare, ein ansprechendes Gesicht. Sie trägt enge blaue Jeans und eine taillierte Steppjacke:
Entschuldigen Sie, wissen Sie, wo die hier Brettspiele haben.
Nein, tut mir leid,, sage ich und lächle sie an.
Sie haben eine sehr positive Aura, sagt die junge Frau.
Einfach so. sagt sie das. Ich bin total überrascht. Danke, sage ich und lache. Ich freu mich.
Nein, wirklich, sagt sie, das sieht man, das ist schön.
Danke, sage ich. Es ist nett, sowas zu hören.
Möchten sie mehr darüber wissen?
Jetzt, aber wirklich jetzt erst, fällt bei mir der Groschen.
Ich könnte Ihnen aus der Hand lesen, sagt sie wie zur Bestätigung.
Wow. Ich bin total perplex. Nie hätte ich gedacht, nie, dass das darauf hinausläuft. Dabei halte ich mich in Sachen Streetstyle-Anmache für relativ abgebrüht, begegne diesen Dingen alltagsroutiniert Berlin flow eben, unterwegs in der Stadt.
Nein, danke, sage ich.
Zwei Tage später, Schönhauser Allee Arkaden.Ein junge Frau, Mitte zwanzig, lange schwarze Haare, gut gekleidet, von Altenpflege-Ausbildung bis Wirtschaftsschule ist alles drin, fragt mich im Vorbeigehen: Möchten Sie, dass ich Ihnen aus der Hand lese?
Okay!, ein neues Konzept, eine neue Ära in der Geschichte der Straßenverkaufsmethodik. Junge, vom Schmuddelimage so weit wie möglich entfernte Sinti- und Romafrauen, die den Laufkundinnen in den Schönhauser Allee Arkaden anbieten, aus der Hand zu lesen. Wie oft klappt das, was kostet das, wo geht man hin mit denen, macht man‘s gleich hier vor Ort oder geht man hinters Haus? Damn, ich bin zu feige, das auszuprobieren. Denn natürlich frage ich mich: Was hätte sie in meiner Hand gelesen? Und was hätte sie gesagt, wenn sie mit einem Blick in meine Hand gesehen hätte, dass meine Aura alles andere als positiv ist?
Well, das hat sie längst gewusst.
November 2014 – Licht schlucken
Johanniskraut gibts jetzt auch verschreibungspflichtig und deshalb hochdosiert oder andersrum. Letztes Jahr hat mir die Therapeutin bei der ich dann nicht war, Laif 900 aufgeschrieben,
dieses Jahr nehm ichs.
Meine Schluckhemmung (idiotischer Tick, ich kann keine Tabletten schlucken) bekämpfe ich mit Selbstsuggestion. Ich schlucke das Licht, sage ich in meinem Kopf und schubse dabei die Tablette von unter der Zunge mit Flüssigkeit nach oben und dann gehts meistens in einem Rutsch runter.
Aber ein paar von den teuren Dingern hab ich auch schon verschwendet und wieder ausgespuckt, wenn sie zu lange im Mund rumschwimmen fangen sie an, sich aufzulösen, das schmeckt zum Kotzen bitter. Und dann klebt das braune Innere in der Spüle und das Gelbe wird blass, aber mit dem Mantra krieg ich sie jetzt meistens runter.
Also Licht schlucken dieses Jahr, mal schauen. Keine Belastung sein. Und doch nicht gleich mit Citalopram die Blut-Hirnschranke durchbrechen und FETT werden, meine Nebenwirkungs-Hauptangst, zu meiner ehrlichen Überraschung .
November 2014 – Fundstück 11

Kastanienallee, 16 Uhr.
Oktober 2014 – für Mae
Ich will bei Netflix nach einem Job, bzw. Ansprechpartner für einen Job fragen – ganz naiv, initiativ und auf Englisch. Mein Profil passt zu keinem der auf der Website veröffentlichten Job Opportunities.(Kann mich nicht erinnern, je eine solche gesehen zu haben, irgendwo, jemals. Möglicherweise existiere ich gar nicht…) Außerdem sind sie alle in Amäärika.
Die brandneue, Mitte September in der Deutschen Oper eröffnete deutsche Website bringt mich in fiesen Schleifen immer wieder zurück zu einer einzigen Kontakt-Möglichkeit – dem Customer Support USA.
Call or Chat?
Ich wähle den Chat, damit ich meine englische Anfrage schön vorbereiten kann. Ich bin nervös als ich auf den Button klicke.
Hier das Protokoll der Kommunikation, das man am Ende anfordern kann:
Thank you for contacting Netflix customer support.
Here is the transcript from your recent chat with customer support:
Netflix Nicholas the Hulk
Hello there ! My name is Nicholas the Hulk. How can I help you today?
You (also ich) Sorry for bothering you with this, but I don’t know how else to find out: as a big fan of netflix and writer for television I would love to send an application to your recently opened agency in my home country Germany. Could you name me an email address and a contact person I could send my resume to? Thank you so much for your efforts!
Die Antwort kommt prompt (die haben bestimmt so vorgefertigte Anfangsfloskeln/Textbausteine, die man einfach ins Chatfenster ziehen kann):
Netflix Nicholas the Hulk: No problem I am happy to help let me look into this for you.
Für Interpunktion, Groß- und Kleinschreibung ist hier keine Zeit. Das mag ich, wie die Sätze trotzdem funktionieren, das ist so ein eigener literarischer Stil, der da entsteht. Es dauert einen Moment (30 sec), dann sieht man im Chatfenster den Satz:
Nicholas the Hulk is typing…
So machen die das. Der Kunde sieht, da passiert was, der Typ ist dran.
Netflix Nicholas the Hulk: And I am grateful that you want to join our company that is the same feeling I had as well 🙂
Also gut. Small talk. Er will mir die Wartezeit versüßen. Ich bin zwar müde, aber warum nicht.
You ja, great company, so happy that you came to Germany
Noch zuviel Interpunktion, ich digital Oma, aber mit der Kleinschreibung klappts, und schon gut schleimi with the enthusiastic American flow.
Netflix Nicholas the Hulk: Can I tell you and we are trying to go world wide 🙂
Der ist aber auch kein native, also digital klar, aber nicht nicht speaking, oder? Yeah, begeistert vom territorialen Ausbreitungswillen seines global agierenden Großkonzerns. Lernt man das oder glaubt man das oder lernt man das zu glauben? Man fragts sich immer wieder. Es vergehen ein paar Minuten. Knappe höchstens zwei. Mein Eindruck verstärkt sich, dass Nicholas the Hulk noch ein paar andere Screens offen hat. Ich schätze fünf, wie Mae aus The Circle. Dass er noch ein paar andere Anfragen nebenher beantwortet, um die Zwischenzeiten zu füllen. Dass sein Supervisor ihm von seinem Bildschirm aus auf den Bildschirm guckt und ihn motiviert, später im Meeting, ihm zeigt, wie man die Leute noch besser bei der Stange halten kann. Mehr awesome, z.B. Da sitzt er, der Hulk, irgendwo im Silicon Valley oder in Mumbai, und hackt in seinen Computer. Eine Schreibkraft wie ich, halb so alt wie ich und auf dem besten Wege sich aus seinem Studi-Job zu einer großen Karriere bei einem Super-Mega-Unternehmen aufzuschwingen. Flieg, Hulk, flieg.
Netflix Nicholas the Hulk: Are you still with me my friend?
Hab ihn nervös gemacht. Weil ich nicht antworte. Aber was soll ich auch sagen? Yeah, awesome? Oder wow worldwide. Oder amazing, im sure its going to be a great success.
You: yes, I am! no worries, I wait patiently, take your time!
Zwei Minuten. Dann: Nicolas is typing…
Und:
Netflix Nicholas the Hulk: Hahaha..No worries I just look into this for you and I am seeing that we don’t have any job opportunities in Germany as yet due to we just start the opening and getting everything in place no worries you can check back in a little later also you can Click Here for job oppotunities if you should move to the US because I really want you to be apart of our Netflix team.
Warum findet er das so witzig mit „no worries“? Ist das irgendwie ein culture clash? Sagt man das nicht zu einem Servicemitarbeiter? Ich bin verunsichert. Und denkt er, ich bin ein Mann? Würde man: are you still with me my friend auch zu einer Frau sagen? Vielleicht weil ich in der Anfrage erwähnt habe, dass ich ein TV writer bin?
You: Okay, ill check again later. All the best with everything. worldwide sounds awesome. thank you so much, nicholas the hulk!
Netflix Nicholas the Hulk: No problem my friend I am happy to help and thank you so much for chatting in your great!..You’ve been really nice today and I appreciate that, you’re the best! Have a great day, thanks for chatting in with us And one more thing, if you wouldn’t mind, please stay online for a one question survey.
In der survey gebe ich ihm ein excellent.
Are you still with me my friend? Jetzt liege ich manchmal nachts wach und denke an den Hulk. Wie er da sitzt, blau beleuchtet vor seinen Screens, am anderen Ende des digitalen Ozeans. Vielleicht bin ich ein bisschen verliebt in ihn. Weil er das gefragt hat und weil er bestimmt starke Arme hat. Oder ein Kostüm mit starken Armen. Oder zumindest den Wunsch nach starken Armen. Und weil er gesagt hat, dass ich nach Amäärika kommen soll und dass er will, dass ich die company joinen soll, wann hört man sowas schon mal.
Are you still with me my friend?
Ach, Hulk, Hulk, nur in meinen Träumen.
Oktober 2014 – Fundstück 10 (Wurst II)
auf einer Kundentoilette:

Oktober 2014 – Fundstück 9
also entschuldigung, aber ist das witzig oder was? das dritte Auge und dann ne Sonnenbrille drauf? hilarious.

Oktober 2014 – Wurst
Manchmal ess ich gerne Wurst.
Ich meine Wurst im Sinne von Landjäger, Pfefferbeißer, Schinkenknacker. Nicht im Sinne von Aufschnitt.
Wurst, in die man beißt, Wurst, die man reißt,
mit den Zähnen, dem Kiefer, wie ein Wolf oder ein Urmensch.
Die Wurst knackt und platzt auf und verbreitet ihren lauten Geschmack nach Fett, nach Tier und chipsmäßigen Übergewürzen in Sekundenschnelle in deiner gesamten Mundhöhle. Du kaust, du zermalmst sie, und merkst schon, da ist was in dir, das geht richtig mit.
Das kommt hoch aus dem Bauch und ist eine Gier, da ist ein Tier in dir, das mit isst. Das die Wurst begrüßt. Das aufwacht von ihr. So eine Wurst ist geil. Pervers auch, das merkst du natürlich und schämst dich, und auch so ein bisschen verachtenswert unterschichtsmäßig. Die Wurst breitet sich aus mit ihrem Gestank, dringt in deinen Kopf und benebelt deine Sinne, dein Bauch streckt sich ihr entgegen und du weißt schon, nachher musst du Zähne putzen und alles wieder in Ordnung bringen, aber jetzt gerade
ists ne geile Wurst.
Du erledigst da gerade was, im jägerischen Sinne, erlegst was, du holst dir was ab, und du verleibst dir was ein, das du dir verdient hast. Du beißt da rein, und überlebst. Weil dein Tier stärker ist als das andere. Und du bist hungrig! Das hattest du vergessen. Jetzt fällt es dir wieder ein, du hast alles Recht der Welt, hungrig zu sein und deine Zähne in diese platzende Masse zu hauen und sie durch deinen Schlund zu pressen, und sie deinem Körper zu überlassen, der sich darauf stürzt, weil er leben will.
So kann Wurst sein.
Ganz schnell kippt das dann, und wird eklig, und wenn man dann die Fettaugen sieht und die Knorpelteile, die jemand in den Darm gequetscht hat, und die Bilder aus der gnadenlosen Kette der kapitalistischen Tierverarbeitungsmaschinerie vor dem inneren Auge auftauchen, dann denkt man wieder drüber nach Vegetarier zu werden. Aber für einen Moment
wars ne geile Wurst.
Oktober 2014 – Googoosh
Gestern habe ich (aus Recherche-Gründen) eine Frau besucht, die aus dem Iran kommt. Ich wollte was über alte Leute im Iran wissen.
Sie hat gesagt, die alten Leute, die die heute 70 sind, sind cool. Sie hatten eine gute Jugend, dann wurds scheiße – deshalb sind sie frisch und jung im Herzen. Genau andersrum wie bei den Deutschen, da war alles scheiße, dann wurds besser – deshalb sind sie so grau und gedrückt.
Im Iran hat diese Generation was zu sagen, sie ist anerkannt, man behandelt sie respektvoll, will wissen was sie denkt. Hier nicht. Hier sind die Alten am Rand der Gesellschaft, man nimmt sie nicht ernst.
Wir haben Googoosh gehört, aus den 70ern. watch this: https://www.youtube.com/watch?v=XI11Cnr1nzk
Oktober 2014 – Berghain (1 – 3)
1) Gesprächsfetzen hinter mir:
Er: Hast du n boyfriend, oder ein girlfriend… ?
Sie: I dont know
2) Ich hab ein halbwegs rückenfreies Shirt an. Jemand berührt mich mit der Hand, weil er durch will. I love that. Das ist typisch Berghain. Dieses respektvolle, zärtliche Hand-Auflegen, nur für einen Moment, den gibt’s nur hier. Du tanzt, sagt es, ich will dich nicht allzusehr stören, Süße, aber ich komm jetzt mal hier durch, Achtung. Das bettet sich ein, in die Choreographien, die notwendig sind, weil immer alles so eng ist, man tanzt und bewegt sich höflich umeinander rum, damit die anderen Platz haben und man selber Raum.
Später eine andere Variante: Jemand klatscht mit seinem nassen Oberkörper gegen meinen Rücken, wurde da hingedrückt, geschoben, Schweiß schmatzt gegeneinander, für einen Moment verbinden sich zwei Menschen mit ihren Flüssigkeiten, eher eklig. Sowieso Gerüche noch und nöcher. Die Frauen immer mit ihren Deos, Parfüms, die Junge mit ihrem Waschmittel.
Keine Ahnung übrigens, wer behauptet hat, Sex auf der Toilette kein Problem – kaum geht man mit jemandem drauf, lassen die Wartenden draußen blöde Sprüche los oder gucken sogar über die Zwischenwände. Ich kann da nicht. Will da nicht. Finde auch die Kombination dunkle Toilette und Sex nicht allzu reizvoll, helle Toilette und Sex auch nicht. Wenn man’s in einer Ecke versucht, kommt auch immer jemand dazwischen. Ich bin nicht abgebrüht genug dafür, dass mir das nicht peinlich wäre. Aber ich nehm auch keine Drogen. Aber auch wenn, glaub ich nicht, dass ich das hinkriegen würde, im Berghain gibt’s immer so viel zu verarbeiten, da kann ich mich nicht noch auf Sex konzentrieren.
3) Was geil ist, echt geil ist, ist, dass man im Berghain nicht runtergeht, in die Höhle des Löwen, man geht hoch. Man steigt nicht ab, in dunkle Gefilde, man steigt auf. Man läuft hoch in den Nebel und das Blau und die Musik und die Halle, den Tempel. Und nicht runter in die Abgründe. Sondern hoch. Und dann ist da alles, die harte Musik und der Nebel und blaue Säulen und die Body-builder Gays mit ihren in Hitze und Dampf entblößten Oberkörpern, die man nur schemenhaft wahrnimmt, also eigentlich voll das Klischee, aber weil man hochgegangen ist, ist das alles irgendwie auch witzig und leicht und durchreflektiert und dann geht man noch eins höher und da ist es dann hell, gerne auch mal auf Kommando Sonne reinlassen, durch die Jalousien, und die Musik ist sweeter und die Jungs sind queerer und alles ist peacig, sowieso, auch unten und es ist echt ne tolerant ausgewählte Crowd, die da zusammen kommt, im ganzen Haus, das ist schon schön und da ist auch mal jemand mit Dreads oder alt oder proll-Tussi oder als Engelchen verkleidet, und auch wenn schwarz Hipster überwiegt, da geht schon alles. Süß auch, wenn die Leute sich verkleiden, so richtig was überlegen, was sie tolles anziehen könnten, das geht bei Jungs ja immer super, bei Mädchen eher nicht.
Oktober 2014 – Fundstück 8

Spiegel-Ei
September 2014 – Toilette I
Es ist Samstag und T. regt sich auf. Wir kommen gerade aus dem Café, in dem wir uns getroffen und einen Frühstückskaffee getrunken haben. Jetzt wollen wir spazieren gehen, bestes Oktober-Wetter, in den Wedding. Er regt sich auf, weil ich sage, lass uns noch schnell bei mir vorbei, ich muss mal aufs Klo. T. setzt zu einer Großklage über die weibliche Blase im Allgemeinen, den Umgang mit Toiletten-Ansagen von Frauen im Besonderen und mein persönliches, ihn in seiner Freiheit einschränkendes Toiletten-Verhalten im Spezifischen an.
Den ständigen Toilettendrang der Frau hält er für eine weibliche Irrationalität, die ergo abgeschafft werden muss. Erwiesenermaßen, so führt T. an, hat die Blase der Frau ein weitaus größeres Fassungsvermögen als die der Männer (ich bereue, dass ich ihm dieses tatsächlich interessante Faktum, von dem mir meine Medizinerfreundin C. mal erzählt hat, aufgetischt habe. Jetzt krieg ich‘s ständig aufs Beweisbutterbrot geschmiert). Der ständige Harndrang der Frau sei also psychisch bedingt, meint T., und psychisch ist in T.s Universum gleichbedeutend mit Bullshit und fauler Ausrede. Psychisch heißt, da stellt sich jemand an. Männer, meint er im Übrigen, haben wenigstens den Anstand kurz mal irgendwo aufs Klo zu gehen, in einer Kneipe, einem Café, aber Frauen wollen dann immer gleich ins Café. Ständig, meint T., müssen die Männer aus diesem Grunde Kaffee trinken, obwohl sie gar keinen wollen oder gar – wie jetzt – mit der Frau nach Hause laufen, obwohl es ein riesen Umweg ist und stundenlang vor der Tür rumwarten, bis die Frau ihre Badezimmergeschäfte erledigt hat. Männer, so T., haben den Anstand die Restwelt nicht mit ihren Toilettenbedürfnissen zu belästigen, belasten, sagt er. Sie regeln sie diskret und schnell, ohne Einschränkungen für die anderen Menschen auf diesem Planeten. Männer, sagt T., reden auch nicht die ganze Zeit darüber, dass sie auf Toilette müssen, weil sie davon ausgehen, dass niemanden das interessiert. Frauen, sagt T., liegen einem ständig damit in den Ohren, als wäre es so richtig interessant, dass sie auf Toilette müssen. Und wie es eigentlich sein kann, dass Frauen, er meint mich, drei Minuten nachdem sie aus einem Café raus sind, in dem sie easy hätten aufs Klo gehen können, auf ein eben solches müssen?!
Ich verteidige mich tapfer, im Namen aller Frauen. Ich spreche über das weit verbreitete Problem des schwachen Bindegewebes der Frau, das zu höherem Druck auf den Schließmuskel führt. Über spezifisch harndrängende Getränke wie Kaffee und Tee. Wasser, Cola, Apfelschorle, Wein. Und Bier. Ich untermauere unter Zuhilfename von Google Maps meine These, dass meine Wohnung auf direktem Wege in den Wedding liegt und keinen Umweg darstellt, und wenn dann höchstens einen von zwei, drei Minuten, okay fünf inklusive Toilettengangs. Ich preise mich als Zwarhäufigmüsserin, dafür aber Schnellpinklerin. Ich weise auf meinen unverschuldeten Penismangel hin, der mir (oh, wie oft zu meinem eigenen Ärger!) nunmal per DNA verweigert wurde und mich nun zum Opfer einer schwächlichen, irrationalen, weiblichen Blase macht, einer im Grunde doch rein diskursiven Konstruktion, die mich mangels gesellschaftlicher Akzeptanz alles Weiblichen, um nicht zu sagen durch strukturelle, offene wie subtile gesellschaftliche Diskriminierung dazu bringt, mich nicht hier und jetzt, einfach so in einem Hauseingang oder an einem Baum zu entleeren. Wie er, als Mann, das jederzeit tun kann! Oder sollen wir mal ausprobieren, was passiert, wenn ich hier und jetzt – (ich greife mir theatralisch an den Gürtel ) – einfach mal so, die Hose runter? Wäre ihm das lieber? (Die Prenzlberger bleiben jetzt schon stehen, ich lasse vom Gürtel ab.) Außerdem trinke ich nun mal gerne Kaffee, führe ich noch ins Feld. Warum soll man nicht das Unangenehme mit dem Angenehmen verbinden, und wenn ich schon drin bin, in so einem gastronomischen Etablissement, kann ich doch auch gleich noch einen kleinen Kaffee trinken. Es ist mir einfach peinlich, die privatunternehmerische Toilette als öffentliche Pinkelanstalt zu missbrauchen, ein für mich nachvollziehbares Ärgernis für jeden Cafébesitzer.
Ich entleere meine Blase in meiner Wohnung . T. wartet mit verschränkten Armen unten auf der Straße. Nach ungefähr dreißig Metern Richtung Wedding muss ich schon wieder. Und zwar echt richtig dringend.
Vielleicht ist es ja doch psychisch.
September 2014 – (Greece) turtles and rainbows
Wir haben in Griechenland – ohne Scheiß – ich schwöre –
– Zwei Schildkröten gesehen, die sich geküsst haben.
– Und einen Regenbogen, der einmal rum ging, ganz und gar rumging, von links nach rechts, dick und satt, wie man ihn als Kind gemalt hat.
Und beides mal war ich mit T. allein.
September 2014 – (Greece) cross dressing
Ich frage N. ob er eigentlich schon mal Frauenkleider getragen hat.
Mich interessiert das gerade, denn ich hab hier in Griechenland gerade in Alison Bechdels Comicroman Fun Home die Szene gelesen, in der sie als Kind zusammen mit einer Freundin Männerklamotten anzieht. Hemden, Krawatten, Schuhe und Anzug von Dad. Sie geben sich Männernamen (Billy McKean und Bobby McCool!) und spielen Betrüger und Versicherungsvertreter (!).
Ich finde das total abgefahren. Die Szene verblüfft mich. So kenne ich das nicht.
Ich meine, Frauen verkleiden sich doch die ganze Zeit als Männer. Inzwischen schon so lange und so häufig, dass es weder ihnen noch irgendjemand wie eine Verkleidung vorkommt. Ist ja kein Cross-Dressing, wenn Frauen Hosen anhaben. Ist selbstverständlich. Die Frau hat einen langen, fast vergessenen, blutigen Kampf um die Hose geführt. Sie hat ihren Wunsch nach Aufwertung, nach Gleichstellung ausgedrückt, als sie sich das Recht auf die Hose erkämpft hat. Der spätere Kampf um den Minirock war dann einer gegen die Abwertung. Des Weiblichen. Hose und Rock, längst geht beides.
Aber Cross-Dressing ist darauf angewiesen, dass es eine Hierarchie gibt zwischen dem Weiblichen und dem Männlichen. Es setzt sie voraus. Sonst funktioniert das nicht.
Bei Männern funktioniert es dementsprechend immer noch. Wenn Männer Frauenklamotten anziehen, ist das sofort erkennbar. Das ist Verkleidung.
Der Mann hat nie darum gekämpft, einen Rock tragen zu dürfen. Warum soll er auch, wer kämpft schon um gesellschaftliche Abwertung. (Schwule kämpfen um Anerkennung trotz ihrer weiblichen Seite, also genau wie die Frauen. Obwohl die Schwulen selbst oft genug Probleme mit ihrer Weiblichkeit haben. Was nochmal was anderes ist als mit der Zuschreibung ein Problem zu haben.).
Hosen sind cool. Jungs sind cool. Turnschuhe sind cool. Mädchen, die Jungs sein wollten, oder ihnen zumindest nah sein wollten, so wie ich, wollten Hosen und Turnschuhe. Aber genau das ist es. Da steckt‘s drin. Jungs sind besser. Wer sich anzieht wie sie, ist ihnen nah. Aber niemals gleich. Mädchen, die Jungs cool finden, sehen herab auf das Weibliche. Um sie herum und in ihnen drin. Sie werten sich selbst auf, in dem sie sich in der Nähe des Throns aufhalten. Rock war für mich okay – aber immer auch ein bisschen peinlich, weil ausgestellt, von Außenwahrnehmung betroffen. Hose war besser – weil cooler, tougher. Im Grunde ist das bis heute so. Fühlt sich noch immer genauso an.
Die Szene bei Bechdel (die ihre Zurechtdrapierung zum süßen kleinen Mädchen durch ihren Vater gehasst hat) ist anders. Sie verkleidet sich als Mann. Und sie kann das. Bei ihr funktioniert das mit dem Cross-Dressing. Weil ihr Begehren anders funktioniert als das der heterosexuellen Frau. Weil was anderes drinsteckt. Nicht das Begehren, zu sein wie ein Mann. Oder der Wunsch, dem Mann nah zu sein. Sondern das Begehren, ausdrücken zu können, dass sie ein Mann ist. Dass sie sich wie einer fühlt. Das ist was ganz anderes. Sich zu fühlen wie ein Mann oder eine Frau sein, die gerne ein Mann wäre – das sind zwei völlig verschiedene Dinge.
Ich hab mich immer gefühlt, wie ne Scheißfrau und mich darüber geärgert, dass ich dem Frausein so ausgeliefert war. Dass ich da nicht raus konnte. Darauf reduziert war. Die schlechte der beiden Geschlechterkarten gezogen hatte. Da haben auch alle Hosen und Turnschuhe nichts genützt. Deswegen bin ich dann irgendwann auf den Rockzug aufgesprungen und hab versucht, mir beizubringen, dass die weibliche Seite einen Wert an sich hat. Dass man als Frau nicht den Fehler machen sollte, die gesellschaftliche Hierarchie zwischen den Geschlechtern fort zu schreiben, in dem man sich und die anderen Frauen fertig macht. Dass das Weibliche und das Männliche Spielwiesen sind mit unendlich vielen individuellen Zwischentönen. Ja, ja, die 90er. Als man noch gekreischt hat auf der Betriebsfeier, wenn die bärtigen, haarigen Jungs im Dirndl aufgetreten sind, an der Uni aber schon viel weiter war. Und heute haben wir den metrosexuellen Mann, der Frauen liebt und ihre Haarpflegeprodukte (Zitat von Raj aus the Big Bang Theory). Und Conchita Wurst. Aber Drags sind noch mal ein Thema für sich.
Meine Cross-Dressing-Erfahrung jedenfalls ist eine ganz andere. Ich wäre nie auf die Idee kommen, mich als Mann zu verkleiden. Ich erinnere mich, dass ich mich als Frau verkleidet habe. Genauer gesagt, als Prostituierte. Zusammen mit einer Freundin habe ich mir Lederstiefel meiner Mutter angezogen und bin nur in Unterhosen durchs Zimmer spaziert. Abgesehen von der Auto-Erotik, die in der Szene steckte, und der schlichten Faszination für einen außergewöhnlichen Beruf, stellt sich mir das als Versuch dar, sich das Konzept Frau anzueignen. Es zu imitieren, einzuüben. Das war meine Idee von Frau. Es war etwas Fremdes, das man ausprobieren, aber zu werden nicht ernsthaft in Betracht ziehen konnte. Wie soll man von da aus weitermachen?
Vielleicht stimmt es auch gar nicht, was ich über Al. Bechdel bzw. Lesben sage. Die meisten können mit Männern ja gar nix anfangen und fühlen sich voll als Frau. Frau frau frau, ganz toll. Ganz anders als ich. Von außen ist das absurd. Die sind solche Kerle, ich son Mädchen.
N. erzählt übrigens, dass er die Kleider von seinen Schwestern angezogen hat. Er mochte das. Und dennoch gab es einen Moment von Gefahr. Irgendwo in diesem Spiel gab es eine Grenze. Die man nicht überschreiten sollte.
Er beklagt im Übrigen, dass 80 Prozent aller Klamotten in den Läden für Frauen sind. Da hat er Recht. Die Männerabteilung ist im Allgemeinen einen traurige. Ein Stiefkind der Modeindustrie. Die Bandbreite an Möglichkeiten ist viel kleiner. Die Frau kann eine Hose anziehen oder einen Rock oder ein Kleid. Und unendlich viele Varianten davon. Der Mann kann einen Anzug anziehen oder eine Hose. Das war‘s.
Männer, die aussehen wie Frauen, gehen ja ganz gut inzwischen. Popkulturell sowieso. Schwule Jungs mit ihren Schals und weichen Gesichtszügen und kleinen Mädchenhintern, wer könnte denen böse sein. Kein Problem, sagen wir da. So einen süßen schwulen Jungen hätten wir doch alle gern. Aber Lesben, butch-Lesben, so im Baumarkt- oder Bikerstil? Eher nicht. Das ist schnell unangenehm. Weil wir Machomänner nicht leiden können? Really? Oder doch eher weil es eben was anderes ist als die Hosensache bei der Heterofrau. Da ist jemand Mann, und kratzt nicht nur an der Tür. Das ist ne Unverschämtheit. Ne Kränkung auch. Ein Affront. Gegenüber dem Mann. Das ist schwerer zu knacken, scheint mir. Ham jetzt alle mal the LWord gesehen oder Ellen De Generis? Wer ist nochmal lesbisch bei uns hier in Germany? Ahja, die Talkmoderatorin. Sehr gut. Der Trend geht glücklicherweise zur komplett-Individualisierung. Alles überschneidet, überlagert sich, wird uneindeutiger, individuell verhandelbarer.
Es lebe die cross-Freiheit.
September 2014 – (Greece) beliebig
T. sitzt neben einer Frau auf einer Terrasse mit Blick aufs Meer. Die Unterhaltung ist sanft, kreist um gemeinsame Pläne. Ab und an wird leise gelacht. Das könnte auch seine Freundin sein. Das könnte auch seine Freundin sein. Sie passen gut zusammen, so von hinten. Größe, Typ, alles stimmt. Er würde mit ihr schlafen, mit ihr in Urlaub fahren, leise flüstern und laut streiten. Er wäre genervt von ihr. Das wäre schön. Sie wären auf Fotos drauf. Wie sie da so nebeneinander sitzen. Jemand würde die Fotos zeigen und sagen: Und das sind A. und B., die waren auch dabei. Im Grunde ist es also egal. Es könnte auch jemand anders sein. Ist das bei mir auch so? Ist das bei allen Menschen so? Ist es einfach egal, beliebig, austauschbar? Schon jemand, der passt, das ist klar. Aber es passen viele. Oder? Oder passen nur wenige? Passt nur ein einziger? Die Meinungen gehen auseinander, andauernd, in den Ambivalenzen der Moderne. Parship, das Liebestool unserer Zeit, hat das Konzept der romantischen Liebe auf den Punkt gebracht. Man hat Wünsche und Vorstellungen, einen ganzen Katalog davon und einen Algorithmus. Und mit dem findet man dann die große Liebe, den einen. Den einen, der passt.
Ich pass nur zu einem. Das ist ein Erfahrungswert. Und es hat wenig mit passen zu tun. Herzlich relativ wenig mit passen zu tun. Soviel steht fest.
September 2014 – Warholias
Mal wieder in Andy Warhols Philosophie von A bis Z geblättert.
Abgesehen von äußerster Witzigkeit:
Ausbeute 1:
Zitat: „Ich habe schon immer gewusst, dass ich nie heiraten werde, weil ich keine Kinder will,
ich will nicht, dass sie einmal dieselben Probleme haben wie ich.
Ich glaube nicht, dass jemand das verdient.
(Besser auf den Punkt bringen kann mans nicht.)
Ausbeute 2:
Die Erwähnung des „Reuben Sandwiches“.
Ich recherchiere und hier kommt’s:
Man nimmt Roggenbrot.
Belegt es mit Pastrami, Appenzellerkäse (kräftig), Sauerkraut (abgetropft).
Gibt ein Dressing aus Creme Fraiche (Basis), Meerrettich und Sojasauce dazu.
Gibt das Ganze in die Grillpfanne (Butter auf die Außenseiten der Brotklappen schmieren! – damit’s nicht klebt kann man Backpapier benutzen),
und serviert es mit Cornichons und körnigem Senf.
New York, New York!
August 2014 – mein Verrückter
hab ich schon mal von meinem Verrückten erzählt?
In Berlin wohnt ja bekanntlich in jedem Haus einer. In meinem auch. (Das liegt an der Armut in dieser Stadt. Und an der Unmöglichkeit aus der Armut rauszukommen. Das ist wie ein Knast. Deshalb macht die Armut verrückt. Ich bin auch schon mal fast verrückt geworden vor Armut.)
Mein Verrückter schreit.
Er schreit laut und durchdringend und so, als sei er vom Dämon besessen.
Als ich ihn das erste Mal gehört habe, vor ungefähr zwei Jahren, kurz nachdem ich eingezogen war, dachte ich, jemand guckt den Exorzist. So klingt das. Man versteht nicht, was er sagt, aber er sagt immer den einen gleichen Satz. Scheint also wichtig zu sein. Immer wieder und wieder den gleichen Satz in der gleichen Intonation. Man weiß nicht, ist es eine Botschaft, ist es ein Fluch, ist es ein Ritual, um den Teufel abzuwehren? Am Anfang hab ich mich furchtbar gegruselt. Das war bevor ich ihn zum ersten Mal gesehen hatte. Danach wurde es besser. Aber bevor ich ihn gesehen hatte, dachte ich – denken alle, die ihn zum ersten Mal hinter seiner Tür wüten hören – er ist groß und kräftig, und wenn man an seiner Tür vorbei läuft und er kommt raus und hat ne Axt in der Hand, weil er denkt, man selbst ist der Dämon, dann siehts schlecht aus. Ich hab schon große kerlige Handwerker sich ihre Bohrmaschine zurecht legen sehen, wegen dem.
Bei Licht betrachtet ist er ein verstörter junger Mann, abgemagert, ungepflegt, mit irrem Blick und weiteren Ticks (zum Beispiel dem, dass er sich an Straßenecken immer rückwärts eindreht wie so ein FBI-Agent). Es gibt so einen Rest in ihm, von dem jungen Mann, der er gewesen wäre. Das ist traurig. Da sieht man noch, was er mal war, was er noch sein könnte, wenn er nicht krank wäre. Ein sanfter, schüchterner, mit sich und der Welt hadernder Junge. Jemand, den man von früher kennen könnte, mit dem man vielleicht befreundet gewesen wäre. Den man dann aus den Augen verloren hätte, von dem man gehört hätte, was ihm widerfahren ist. Eine tragische Existenz. Und doch. Wenn er schreit, scheint er unberechenbar. Man weiß nicht,was er sieht, was in ihm ist, welche Kräfte da toben. Manchmal schreit er monatelang gar nicht. Dann schreit er wochenlang andauernd. Tag und Nacht. Um 4 Uhr morgens oder um 10 Uhr abends oder von 15 Uhr 20 bis 17 Uhr 30. Dann hat er einen Schub und so ziemlich jeder im Haus würde ihn gerne killen. Ich auch. Dann bollert er gegen seine Tür, und die Haustür, mit einer Wucht, dass man staunt, dass er sich nicht die Knöchel bricht. Es ist gruselig und ängstigend wenn er schreit. Und einschränkend. Er setzt in meinem Kopf was frei. Dsa gefällt mri nicht. Er setzt scih rein in meinen Kopf und macht mir Gedanken. Er dringt mit seinem Geschrei bis in meine Träume vor und ich denke, hoffentlich schreit er nicht, wenn ich nachts nach Hause komme, wenn ich an seiner tür vorbei muss, wenn ich arabeiten muss. ich weiß, dass ich ein bisschen bin wie er, ein kleines bisschen. ich kenne diese Verrückt-Hirn-Schranke in meinem Kopf. ich bin selber manchmal unbalanced. Und er steckt mich an, er zieht mich zu sich hin, in seinen Teufelskreis. „Mein Verrückter schreit wieder“, sage ich manchmal. WEnn man ihn öfter sagt, klingt auch dieser Satz gruselig. Ich nehme es sportlich. Ich bin stärker als er. Ich bin auf der sicheren Seite.
Mein Vermieter sagt, er hat ihm gekündigt, Aber „ein Verfahren ist anhängig“. Ich stelle mir vor, ich wäre seine Psychiaterin, seine Anwältin. Sie müssen da nicht raus, Herr B. Sie haben ein Recht auf ihr selbständiges Leben. Machen sie sich keine Sorgen, wir gewinnen den Prozess.
Seit kurzem schreit ein Nachbar von der anderen Seite zurück. Anfangen hat er mit Halts Maul, du Assi. Dann hat er ihn bei seinem vollen Namen genannt, Vorname und Nachname plus Halts Maul und Mach dein Fenster zu. So ging es hin und her über den Hof. Dämon versus gesunder Menschenstammtisch. En Verrückter schreit den anderen Verrückten an. Meine Nachbarin hat irgendwann mal zuraück geschrien: Der ist krank, Mann. Da hat der mit dem gesunden Menschenstammtisch geschrien: Wieso gehstn du nicht zum Arzt, voller Name?
Ist nicht so, dass ich nicht ausziehen würde. Aber Wohnungen für Einpersonenhaushalte sind schwer zu finden und sie sind alle 200 Euro teurer als ich es mir leisten kann.
Seit kurzem hat er den Satz gewechselt. Als es das erste Mal passiert ist, war ich schockiert. In meinem Kopf hab ich nach dem alten Satz gesucht, nach dem Endes des Satzes, denn der neue ist kurz, ganz kurz, vielleicht nur ein Wort, nur noch ein abgehacktes Bruchstück aus dem alten Satz. Das macht mich wahnsinnig. Der Sound stimmt nicht. Da fehlt was. Und ich kann mich nicht mehr an den alten Satz erinnern, obwohl ich ihn zwei Jahre lang so oft gehört habe. Was bedeutet es, dass er jetzt einen anderen benutzt? Braucht er Abwechslung? Hat er den Dämon besiegt und jetzt ist ein anderer dran wie in einem zwei Jahre währenden computerspiel, das nächste Level? Ist er auf dem Weg der Besserung? Ist er auf dem Weg in ein großes Schweigen? In eine Implosion nach innen, statt nach außen?
Manchmal, wenn ich ihm begegne, im Hof oder im Hausflur, grüße ich ihn. Hallo, sage ich. Klar und deutlich. Hallo, sagt er. als wenn nichts wäre.
Wie gesagt, in jedem Haus in Berlin wohnt ein Verrückter. Vielleicht bin’s ja ich.
August 2014 – Drohnen
Google arbeitet an einem Paketversand mit Drohnen. Ich finde das so SciFi mäßig geil, dass ich fast durchdrehe. Da fliegen dann überall diese fleißigen kleine Bienchen rum und kommen zu dir und sagen noch was Witziges und lassen dein Paket ab und in der Luft ist alles voller Straßen und manchmal gibts Unfälle, und die kleinen fleißigen Drohnen knallen aneinander und was ist, wenn sie Kühlschränke transportieren und sie haben einen Bug oder eine Wildgans fliegt in ihren Rotor und der Kühlschrank fällt runter und erschlägt einen? Es geht wohl eher um Bücher, aber auch so ein Hardcoverbuch im richtigen Winkel gegen den Schädel… Ich lese, dass Google sich im Gegensatz zu Amazon, die da AUCH schon längst dran arbeiten und ERSTERr waren, hatte ich gar nicht mitgekriegt!!, die Pakete an Seilen ablässt, denn der Mensch neigt dazu, impulsiv nach seinem Paket zu greifen und dann kriegt er die Hand in die Rotorblätter und endet ähnlich wie die Wildgans. Wie groß sind die überhaupt? Und dann könnte man sich einen Spaß draus machen, die abzufangen und andrer Leuts Pakete zu bekommen oder die Drohnen im großen Stil zu hacken und in geheime Lagerhallen umzuleiten, von wo aus man die Pakete dann weiter verkauft, ist ja manchmal vielleicht doch ein gewisser Warenwert unterwegs, ach nein, die werden bestimmt überwacht, aber wie gesagt: Hacker. Und kommen sie an die Haustür, in den Hof, oder in die Straße? Wahrscheinlich muss ich mich gegenüber der Drohne identifizieren und eine Pin eintippen oder redet sie ein bisschen mit mir? Macht sie ein Foto von mir, der glücklichen Person am Wegesrand, die erfreut die Arme nach ihrem Paket ausstreckt, wie ein Kind sein Geburtstagsgeschenk. Die Drohne wird all diese Bilder sammeln und es wird Personen geben, die sie mehr mag und andere weniger. vielleicht trödelt sie auch mal oder fährt einen Umweg. Für manche wird sie der einzige menschliche Kontakt sein, den sie haben.
Landen sie oder bleiben sie immer in der Luft? Sind sie Google-bunt oder eher so metallisch-R2D2? Sind sie laut? Die Prototypen vielleicht noch, aber da wird sicher schon dran gearbeitet. Werden wir uns belästigt fühlen, vom ständigen Luftverkehr? Besonders die ländlichen Regionen, so Google, werden davon profitieren. Und natürlich werden sich die Lieferzeiten verkürzen wie Sau. Ich freu mich drauf! Ich finds super! Wenn die erste Drohne kommt, werden wir aufgeregt sein wie die Kinder und nach ein paar Monaten ist alles normal. So ist das immer mit der Zukunft. Und irgendwann ist alles was mal war so weit weg wie die Zukunft es immer sein wird und man fühlt sich alt, im Sumpf wie seine Omi.
August 2014 – Fields
In der SZ lese ich einen Artikel über eine Frau, 36, Iranerin, verheiratet, eine dreijährige Tochter, die die Fields Medaille für Mathematik bekommen hat. Als erste Frau überhaupt.
Sie sieht wahnsinnig sympathisch aus und ich liebe sie augenblicklich, weil ich so stolz und gerührt über ihre Tapferkeit und Klugheit bin. Es hat damit zu tun, dass ich an all die Kämpfe denke, die sie ausgestanden haben muss, um das zu sein, was sie ist und kann. Es liegt an meiner Sehnsucht, so eine Frau vor mir gehabt zu haben (eine Lehrerin, eine Dozentin, eine Mutter verdammt nochmal), jemanden, der stark ist und etwas kann und will und mir das Gefühl gibt, etwas verstehen und erreichen zu können, was mir verschlossen oder ängstigend erscheint. Ein Vorbild.
In ihrer Rede hat sie gesagt, dass sie hofft, dass viele junge Wissenschaftlerinnen und Mathematikerinnen durch den Preis bestärkt werden. Klug genug also auch noch, zu wissen, dass es nicht selbstverständlich ist. Dass es was mit Repräsentation zu tun hat. Andere sagen dann gerne mal, sie persönlich hätten sich nie unterdrückt gefühlt.
Dazu kommt noch, dass es wahrscheinlich nichts gibt, was ich mehr bewundere als einen Menschen, der sich in Wissens-Sphären bewegt, von denen ich nicht mal ansatzweise verstehe, wie sie funktionieren. Das hat ne Größe, so lebensphilosopisch betrachtet, die mir imponiert. Es scheint mir so sinnvoll, sinngebend zu sein, sein Leben damit zu füllen.
August 2014 – Geld
Geld. Geldgeldgeld. Geldigeld.
Heute morgen im Bett. Ich frage T. wie viel Geld man eigentlich bräuchte, um von den Zinsen leben zu können. 250 000?
Rechne es doch aus, sagt er. (Typisch)
Ich: Wie viel Zinsen kriegt man denn gerade? 1 Prozent?
Er: Bei 250 000 schon bisschen mehr, 3 Prozent.
Ich: Also gut. gehen wir mal davon aus, dass wir 1500 Euro monatlich brauchen, netto. 250 000 sind 100 Prozent, x sind 3 Prozent. 250 000 mal drei durch hundert. 7500. 3 Prozent von 250 000 sind 7.500. 7500 pro Monat?
Er: Spinnst du? Pro Jahr!
Ich: Das reicht nicht.
T. lacht.
Ich: 7500 durch 12 sind 650, immerhin, da ist die Miete schon mal drin (im Moment noch). Kann man ja noch was dazu verdienen. Aber gut, das Doppelte also: 500 000. Ich bräuchte 500 000 Euro, um von den Zinsen leben zu können. Ich müsste mich dann ja auch nicht mehr um eine Altersvorsorge kümmern, die hätte ich ja – eben die 500 000 Euro. Gut. Dann will ich 500 000 Euro. Dann wäre ich endlich frei. Ich könnte endlich in aller Ruhe arbeiten gehen, ohne mir ständig Sorgen machen zu müssen, dass ich die Arbeit wieder verliere. Ich könnte aufschreiben, was ich aufschreiben will und einfach mal sehen, ob es jemanden interessiert. Ich könnte auch putzen gehen oder Gebärdensprache lernen. Ich könnte nach Japan fahren und ein paar Monate in den USA leben und dann wieder was arbeiten. Ich könnte arbeiten und arbeiten, wenn ich Geld hätte, das wäre dann ja überhaupt nicht schlimm. Das wäre überhaupt kein Problem. Es würde nicht weh tun. Ich hätte ein Büro mit einem großen, einem ziemlich riesigen Tisch und da würde ich schreiben und Sachen basteln und Kunst machen aus Geld und schreiben. Und dann wieder was an die Wand kleben oder was ausschneiden oder so, das mach ich so gern. Ich brauche also 500 000 Euro das ist jetzt klar. Ich brauch sie jetzt, bevor. Ich brauche eigentlich nur jetzt 500 000 Euro. Der Rest würde sich dann schon regeln. Ich glaube, das geht. Das ist eine überschaubare Summe. Ich glaube, das geht. Wenn jeder 500 000 Euro hätte, dann könnte jeder von den Zinsen leben. Auch die Banken wären dann reich. Ein bisschen was dazu verdienen kann ja jeder noch, aber dann wär’s ja auch leicht, weltweit. Das ist auch besser als Grundsicherung, denn da hat man ja wieder Probleme, weil es vorne und hinten nicht reicht, und die Altersvorsorge nicht gesichert ist und am Ende sind doch wieder alle arm. Also 500.000 Euro. Jetzt.
500.000, das muss doch gehen.
August 2014 – Affen gemeinsam stark
Cooler Slogan. Visuell ein großer Spaß für mich, die Einstiegsszene im Wald bläht einem die Nüstern, die Bewegungen der Affen, das Affental, das zugewachsene San Francisco, die Golden Gate Bridge, über die sich die Affen in die Stadt schwingen – alles klasse. Aber die Figuren und die Geschichte, es klingt abgeschmackt, weil mans immer sagt, aber wirklich: Du liebe Zeit. Der einzig interessante Moment im ganzen Film ist der, in dem einer der Affen zwei Dumm-Menschen den Affen macht. Und die drauf reinfallen, bevor er sie mit einer MP dahinfegt. Da gibt es mal für einen Moment ein kurzes Aufleuchten von sowas wie einer politischen Ebene. Und ein bisschen Befriedigung.
Der absolute Hammer ist die Frau: Sie assistiert dem guten Helden bei seiner gefährlichen Mission und ist ihm Stütze und Mutter für sein Kind. Wow, so krass gab’s das aber auch schon länger nicht mehr, oder? Und der andere absolute Hammer ist die Figur des Schwarzen. Er fängt an zu tanzen, als nach apokalyptischen Jahren stromloser Zeiten (Vireninfektion hat Menschenbestand auf überschaubare Menge reduziert) Musik erklingt. Achja, und der dritte Hammer ist die äffische Kleinfamilie, in der die Frau daran zu erkennen ist, dass sie erst gebärend, dann krank, jedenfalls schutzbedürftig ist, sich um ihre beiden Kinder sorgt, in Sicherheit gebracht werden muss, und eine Art Lichterkette ohne Licht trägt, damit man sieht, dass sie die First Lady ist.
Das hatten sie aber auch schon mal alles besser bei Pl.d.Affen, oder?
August 2014 – Beine
In der Tram sitze ich vorne rechts, allein, auf einem Einzelsitz. Da guck ich hoch und denke, wow, hab ich lange, schlanke Beine!
Da ist das eine Wand aus getöntem, spiegelndem Plexiglas, leicht gewölbt, die die Fahrerkabine umhüllt und meine Beine in die Länge zerrt.
Cool, da setz ich mich jetzt immer hin.
August 2014 – Lügen
ich lüge wie gedruckt. Ich flunkere. Es fällt mir leicht. Will ich irgendwo nicht hin, denk ich mir was aus. Und ich will oft irgendwo nicht hin. Auch wenn ich dann am Ende doch hingehe, denke ich mir vorher lang und breit aus, was ich sagen könnte. Erleichterungsfantasien, Wunschfantasien. Beinbrüche, Magen-Darm-Grippen, Jobs im Ausland, Gerichtstermine, Ortstermine, gestorbene Verwandte, kriminelle Verwicklungen, Schienenersatzverkehr, Migräne, Nachbarschaftshilfe – ich bleibe immer hart an der Realität. Ich gebe auch T. gerne Tipps, was er sagen könnte, wie er sich aus der Affäre ziehen könnte. Er lacht sich tot. Ich sage, sag doch. sag doch, du bist. Oder sag doch, du musst. Oder sag doch, du machst. Es gibt gute Flunkereien und schlechte. Man muss sich schon was einfallen lassen. Bisschen nachdenken. Es darf nicht langweilig sein (für einen selber), nicht zu lahm, aber auch nicht zu aufwändig. In diesen Fällen kann man sich die Flunkerei sonst nicht merken und das ist schlecht, falls das Gespräch nochmal drauf kommt.
Denn es ist ja so: Du sollst nicht lügen ist die größte Lüge der Menschheit und das Verlogenste was sie je hervorgebracht hat. Den lieben langen Tag sollen wir lügen (Arbeit) und dann aber an den richtigen, wichtigen Stellen (Name, Adresse, Geburtsdatum, Sozialversicherungsnummer, Jobcenter) schön die Wahrheit sagen. Wir leben im Zeitalter der wahrheitsgemäßen Lüge, Selbstoptimierung genannt und ich sehe nicht ein, warum das nur dem Arbeitgeber nutzen soll. Bei jedem Gespräch das sie mit dir führen, wollen sie dich lügen sehen und gleichzeitig die Wahrheit sagen hören, die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Deshalb liebe liebe ich das Internet. Ich habe einen Namen, den ich nicht mag, deshalb gebe ich mir gerne und oft einen anderen. Danke Internet! Danke fuck-Facebook, der Klarname ist out! Das Klarbild ist out und das Klaralter ist auch out, ich seh nicht ein, warum ich mir mit einer der drei Sachen einen Nachteil durch Unoptimierung verschaffen soll. Ich lebe davon, mir Sachen auszudenken, also warum sollte ich irgendjemand da draußen die Wahrheit sagen? Ich möchte entscheiden, wie ich heiße und wie alt ich bin. Ihr wollt, dass ich kreativ bin? Seht meine Vita. Die ist so kreativ wie ich, suckers! Ich? 38. Elli April. Geboren am 6.November 1974. Äh, ja, Skorpion. Ups, schon erledigt. Man muss flink sein im Kopf, vor allem beim Rechnen. Da haperts manchmal, das ist peinlich.
Mein Leben lang habe ich mich gefragt, wie man seine Identität wechseln kann. In den amerikanischen Filmen sieht das immer so leicht aus (auch nicht mehr). wie macht man das, einfach abhauen, alles zurücklassen, wie macht man das konkret, wie verschwinden Menschen, effektiv, wie kriegt man einen neuen Pass, einen neuen Namen, eine eine neue Geschichte. Das hat mich schon immr fasziniert an Verbrechern, Terroristen, Kronzeugen. Zurück auf Los. Du bist nicht mehr du. Was für eine Erleichterung.
August 2014 – Al. Bechdel
Alison Bechdel kann das, was ich gerne können würde: Sie kann Comics zeichnen.
Immer denke ich, wenn ich zeichnen könnte, dann wär alles viel einfacher. Dann könnte man den anderen zeigen, was man sieht und müsste es nicht immer so aufwändig und kompliziert aufschreiben, beschreiben und umschreiben und am Ende sehen sie doch alle was anderes als das, was gemeint war.
Sie ist lesbisch, hat jahrelang einen Comicstrip mit dem Titel Dykes to watch out for in diversen einschlägigen Zeitschriften veröffentlicht, in dem sie aus dem Leben von rund 10 bis 15 Figuren von den Achtzigern bis heute erzählt, alles Lesben und dann im Laufe der Jahrzehnte immer queerere Frauen und Männer, die so aufgelöst in ihren Rollen- und Lebensentwürfen sind, dass es am Ende schon richtig anstrengend ist. Das ist alles ziemlich witzig udn noch vor the L-Word. Ein bisschen geht’s auch um Sex, aber nicht so viel, wie ich mir das gewünscht hätte, da gibts schließlich noch Klärungsbedarf. Aber im großen und ganzen versteht man da mal die Lesbenwelt.
Es geht viel um Politik (bitte nicht schon wieder George Bush, please!) und um das Milieu in dem sie sich bewegt (Bioladen, community-Treffen, Lesben/Frauenbuchladen). Es geht z.B. um die Frage und den Kampf um die gay-marriage, outings vor Eltern, Adoptionen, Beziehungen, Affären, Jobs, politisches Engagement, Kindererziehung usw. Eine WG, ein stable couple mit double income und kid, ein Buchladen sind so die main locations.
Sie hat Fun Home geschrieben, ein Buch über ihren Vater, der schwul war. Les ich demnächst im Griechenland-Urlaub. Und Are you my mother, ein Buch über ihre Mutter. Und über die Beziehung zu ihrer Psychotherapeutin – eine der wundersamsten Beziehungen dern Welt. Außerdem geht es um Winnicott, einen Psychoanalytiker, der sich auf offenbar äußerst kluge Weise mit Kindheit beschäftigt hat (kannte ihn nur vom Namen her), um Virginia Wolf und ihr Tagebuch, und um die Frage, warum Frauen angeblich immer nur über sich selbst, während Männer über die Welt schreiben und noch so einiges anderes mehr.
August 2014 – wohnen kann tödlich sein
ich lese etwas, das ich erwähnenswert finde:
Zille hat einmal gesagt, man kann einen Menschen mit einer Wohnung genauso gut töten wir mit einer Axt.
Ein Architekt in der Zeitung sagt, wir wohnen scheiße. Dunkel, Bäder ohne Fenster, schlechte Fenster, zu klein geschnittene Zimmer,
Fahrstühle für dünne Leute, schlecht isolierte Wände. Ich kann ihm nur beipflichten.
Es gab und gibt hervorragende Architekten, mit großartigen Ideen für Wohnungsbau, Siedlungsbau. Kann man die nicht mal machen lassen? Es muss doch im Jahr 2014 möglich sein, Häuser zu bauen, in denen die Wohnungen gut geschnitten, gut isoliert, ökonomisch und ökologisch durchdacht und für durchschnittliche bis unterdurchschnittliche Einkommen affordable sind. Ich sehe nur andauernd hässliche Neubauten mit abgeschotteten, balkonlosen, lichtlosen, abweisenden Außenfassaden, Bernauer Straße, Märkisches Museum usw. Trotzdem übersteigt jede Wohnung darin meine Möglichkeiten, mietlich und käuflich sowieso.
Die Löhne steigen nicht. Berlin wird teurer und die Löhne steigen nicht.
August 2014 – Fundstück 7

August 2014 – diaries
ich bin gerade total obsessed mit Tagebüchern.
Andy Warhols ist so dick wie die Bibel.
Am Ende ist ein Register mit allen Leuten, die erwähnt sind und den Seitenzahlen auf denen man Einträge zu ihnen findet. Oh my God, ich bin in Andys Tagebuch, hat da bestimmt der ein oder andere geschrien. Andy, bin ich in deinem Tagebuch? Ich hab heute Andy gesehen, vielleicht schreibt er mich ja in sein Tagebuch. Lieber ist mir allerdings seine Philosophie von A bis B, da lernt man mehr. Das ist alles ziemlich absurd und witzig.
Alison Bechdel hat von frühster Kindheit an jeden Tag aufgeschrieben, was so passiert ist. Ich bin neidisch, ist das nicht absolut großartig, was für ein Schatz!
anders als ich hat sie das tagebuch nicht zur beschreibung ihrer gefühlslagen ausgenutzt, sondern zur archivierung ihres Alltags. Man sollte das ding ins all schicken, zusammen mit dem anderen kram, der da oben schon rumschwebt. Es war ihr so wichtig, alles aufzuschreiben, festzuhalten, dass ihre Mutter ihr eine Zeit lang die Arbeit abgenommen hat, damit sie Ruhe finden kann. Die kleine Alison saß also abends aufrecht im Bett und hat ihrer Mutter diktiert. Die Mutter hat alles aufgeschrieben, haarklein und genau so wie Alison es ihr gesagt hat. Ist das nicht wunderschön. Was für ein Liebesdienst. Die kommentarlose Stillung des Bedürfnisses eines Kindes.
Wie es wohl sein muss, zu wissen, was man jeden Tag gemacht hat, jeden verdammten Tag seines verdammten lebens von klein auf? Macht es reich und glücklich und eine Menge Erkenntnis oder ist es traurig, weil man sieht wie arm und repetitiv alles ist.
Was man alles vergessen hat. jedes Wetter, jeden Anruf, jeden Lehrer, jede hausaufgabe, jede Begegnung, jede Bahnfahrt, jeden urlaubsort, jede Wohnung, jede, jeden und alles.
Ich mache seit Jahrzehnten einen großen Bogen um meine Tagebücher. sie stehen in meinem SChrank udn ich hab Angst vor ihnen und gleichzeitig Angst, dass sie bei einem Wohnungsbrand umkommen. Wenn ich mir ab und an überlege, was ich schnell mitnehme, wenns brennt, dann sind es die Tagebücher und Fotos.
Eines Tages werd ich mich traun. Dann werd ich reingucken und dann wirds rauskommen. Was für ein dummer, unreflektierter, selbstmitleidiger Teenager ich war, der immer nur gejammert hat bis er Ende zwanzig war. Ab da hab ich dann mündlich weitergejammert. Und jetzt, im hohen Alter, steig ich wieder schriftlich ein.
August 2014 – Fundstück 6

In meinem Leben hat es mal einen Mann gegeben.
Der hat für mich zwei Pilze an die Wand gesprüht. Zwei Pilze lieben sich, hieß das Bild.
Das lag daran, dass er immer geseufzt und gesagt hat: In meinem nächsten Leben werd ich Pilz.
Das war so ein Spruch von ihm.
Das war das Schönste und Tollste was je jemand für mich gemacht hat.
Trotzdem war ich überfordert.
Irgendwann hab ich die Beziehung beendet. Auf unschöne Art, wie man so sagt.
Ich weiß, dass der Mann sehr unglücklich war. Das tut mir heute noch leid. Manchmal träume ich davon.
Es tut mir leid.
August 2014 – Fundstück 5

Affe 3 D
August 2014 – Gentri-Falle
Die Gentrifizierung, im Volksmund liebevoll Gentri genannt, lässt sich nicht mehr nur in Vierteln oder an Straßenzügen beobachten, sondern auch in den Shops selbst: Intrinsische Gentrifizierung – so nenn ich dsa!
Gestern bei District Mo. Vor kurzem erst (halbes Jahr, Jahr) haben sie eröffnet. Am Anfang immer schön leer, immer schön freundlich, tolles Essen zu korrekten Preisen.
Lage und Style allerdings vom ersten Moment an mittig kalkulkiert und so kams dann auch wies kommen sollte: Man konnte zusehen – Kamera hinstellen und Zeitraffer drauf – wie die Blume der Gentrifizierung sich entfaltete. Wie der Laden immer voller wurde, immer früher immer voller wurde, wie die Tische ab halb 8 immer öfter Reservierungsschilder bekamen, dann schon ab 6. Wie der Burger ein Euro mehr kostete, dafür aber im Durchmesser 1 cm kleiner wurde, die Süßkartoffeln weniger wurden, die Soße gleichzeitig reduzierter. Wie die Kellner einen Oberkellner bekamen, wie die Reservierungschilder von den Unterkellnern schon ab halb 6 flächendeckend für alle Tische draußen aufgestellt wurden, wie der Oberkellner die Unterkellner immer schlechter behandelte und die Gäste schließlich auch. (Sitz! Platz! Iss! Geh!).
Einhellige Meinung jetzt: da kannste nicht mehr hingehen. Ohne dich zu ärgern. So war’s zum Beispiel auch beim Transit.
I. neulich, zeigt mir in Neukölln wo eine Freundin von ihr wohnt. Ich: Also hier wärs mir aber doch zu krass. Eine Straße weiter, ich: ah, hier merkt man jetzt schon, wies anders wird.
Sie: jaja, ab hier ist schon gentrifziert. Damn it. So ist das. Ein bisschen Gentri ist gut, zu viel ist zu viel und in Nullkommanix ist das Viertel aus der Balance. Und so reden wir alle diesen Müll des modernen jungen akademisch gebildeten Großstadtmenschen. Und wenn ich mir mich anhöre, dann ist es doch unterm Strich das Gleiche, was Eltern und Nazis sagen: Hier wohnen zu viele Türken und Araber, hier ist es gefährlich, hier bist du zu sehr unter anderesgleichen. Nur ich sags nicht, weil ich ja politisch korrekt bin. Aber Fakt ist: Ich will nicht zwischen Frauenunterdrückung, Ehrbegriff und kriminellen Machenschaften leben. Ich will keine Glücksspiellokale, Kinder, wegen denen ich das Jugendamt rufen muss, Männer, die auf arabisch anzügliche Bemerkungen machen und Frauen, die mich nicht anschauen. Ich will Cafes und kleine Läden, ich will da sein, wo Leute sind wie ich und dann gerne noch eine vertretbare Zahl exotisch erträglich Anderer, die mir das Gefühl geben, tolerant zu sein, cool zu sein und in einer offenen Weltstadt zu leben. Die für meine innere Aufwertung sorgen. So siehts aus. Schämen sollte man sich. Alles nicht neu, aber immer wieder: Was soll man machen? Wie soll man sich zu sich, seinem eigenen inneren Rassistenschwein, seinem Ego, das eine gute Wohnlage verdient und der hochkomplexen, globalen Gesamtsache verhalten? Muss man da hinziehen, wo man sich nicht wohlfühlt? Muss man Pionier sein? (Mir fällt Jonathan Lethems Motherless Brooklyn ein, seine Mutter zieht mit ihm und seinem Dad in ein schwarzes Viertel in den 70er Jahren, weil sie findet, dass ihr weißes Kind von Anfang an lernen soll, dass das alles kein Problem ist. Anders, ich weiß, aber irgendwie fällts mir ein).
Neulich hab ich mal gelernt, dass man in den USA auf den Websiten der Immobilien-Makler zusammen mit den angebotenen Miet- und Eigentumswohnungen auch direkt die Kriminalitätsstatistiken, Einkommensverhältnisse und Kinderschänderrate der neighbourhoods abrufen kann.
Vielleicht sollte man auch einfach nie mehr darüber reden? Das Unwort des Jahrzehnts, Gentrifizierung nie mehr in den Mund nehmen? Einfach nicht mehr begründen, warum es einem irgendwo gefällt oder nicht gefällt? Es sind die Nuancen in den Entscheidungen mit denen jeder selber fertig werden muss. Dass es im Endeffekt um was Politisches geht, ist klar, macht einen aber nicht gerade handlungsfähig.
August 2014 – Fundstück 4



Juli 2014 – Wurst
Ich bin so kreativ wie ne Wurst.
Es ist soo heiß und ich bin soo faul.
Ich starre die Wand an oder den Bildschirm.
Ich kann es blubbern hören, in meinem Kopf. Alles nur heiße Luft.
Ab und an ein Kaltgetränk. Ab und an ein Heißgetränk. Zwischendurch mal ne Erdbeere oder ein Mayonnaisebrot.
Auf Stühlen und Sofas liegen Laken gegen die Nacktheit. Denn anziehen mag ich eigentlich nichts mehr. Und doch kommt es mir gefährlich vor, so ungeschützte Brust. Also doch wieder ein T-shirt, eine Unterhose. Gibt’s kein weites, weiteres T-Shirt, ein frei fallendes Riesen-T-Shirt ohne Hautkontakt? Ich notiere: Weites T-Shirt kaufen, das über den Po geht (dann kann man nämlich auch die U-hose wieder weglassen).
Alles faule Ausreden. Ich hab keinen Bock auf meinen Job.
Juli 2014 – Fundstück 3

an apple a day…
Juli 2014 – kaufen
Ich bin kaufsüchtig, hab ich das schon erwähnt?
Es ist nämlich so. Je weniger Geld ich habe, umso mehr kaufe ich.
Das hat sich in den letzten Jahren so entwickelt, da ich im Gegensatz zu früher total genervt davon bin, dass ich nie Geld habe. Früher hat mir das nicht so viel ausgemacht, da wollte ich nicht so viel, aber jetzt will ich ständig was und bin beleidigt, weil ich mir, obwohl ich gute Arbeit leiste, nichts leisten kann, weswegen ich aus Trotz, Wut, man lebt nur einmal (Yolo) und ist mir doch egal, alles kaufe, was ich haben will, jetzt. Auch Schwachsinniges und teure Sachen. Dann liegen die Sachen da rum, und ich schick sie wieder zurück oder verkaufe sie auf ebay (obwohl ich das hasse), weil ich Panik kriege.
Außerdem kaufe ich ein, damit ich was zu tun habe und nicht arbeiten muss. Es gibt lange Zettel auf denen steht, was ich kaufen muss. Die muss ich abarbeiten. Da muss ich durch die Stadt laufen und dann noch schnell dahin und da ham sies dann nicht oder nicht so wie ichs will und dann guck ich nochmal im Internet. Dann wird bestellt und abgeholt und dann passts nicht und Umtausch, Retoure und bei der Post ist die Schlange immer so lang. Undsoweiterundsofort. Wie ein Rentner halt ich mich auf Trab. Ich will einfach nicht an den Schreibtisch. Dabei muss ich mir dringend was ganz Tolles ausdenken, was absolut Geniales, super Witziges, einfach Brillantes und es fuck nochmal ABGEBEN!
Wie das alles enden wird, ist klar. Verschuldet auf der Straße, in einer Pfütze aus Kotze und Alkohol. Ihr denkt, ich mein das nicht ernst.
Die perverseste Verquickung seit es Menschheit gibt, Arbeit und Geld, leisten und leisten. Noch nie bin ich, niemals werd ich damit klar kommen.
Juli 2014 – Natur
Also ich mag die Natur nicht.
Da geh ich in den Park, und nehm ein Handtuch mit. Da setz ich mich. Schön unter einen Baum, zieh Schuhe und Strümpfe aus, schlage mein Notizheft auf, lege mein Handy zurecht, nehme ein Buch aus der Tasche, und zack – hängt irgendwas Schwarzes, Sülziges an meinem Fuß. Ich wisch es weg, denke, irgendein Dreck von der Straße, hochgeflogen von meinen Boots, in dem Moment kommt mir der Gedanke, vielleicht Vogelscheiße. Über mir im Baum ist ein ziemlicher Vogellärm. Neben mir im Gebüsch raschelt es ebenfalls. Ich guck, obs ne Ratte ist, nein, ein Vogel. Okay, also Vogelterritorium. Trotzdem. Ich muss ja auch irgendwo hin.
Da lese ich ein bisschen (Alison Bechdels neuen Comic Are you my mother), da schreibe ich ein bisschen (lustloses Gekritzel) und zack – kackt mich jemand von oben an. Diesmal aber eindeutig. Dicke schwarze Vogelscheiße, halb auf dem Handtuch, halb auf meinem schneeweiß-karierten Notizbuch. Auf dem Notizbuch der eher flüssige Teil. Disgusting!
Ich versuche nichts anzufassen, erinnere mich an meine Cousine, die als Kind einen schrecklichen Ausschlag hatte, weil sie eine Vogelfeder angefasst hatte. (Und es hat ne Weile gedauert, bis man drauf kam). Außerdem die berühmte Geschichte vom Oberbürgermeister aus München, dessen Frau sich die Taubenkrankheit eingefangen hatte und daran gestorben war, woraufhin ihr Mann alle Tauben in der Stadt vernichten ließ. So die Mär in meinem Kinderkopf. Hat mich immer beeindruckt, diese Geschichte. Der Mann kam mir vor wie ein griechischer Gott, ein Racheschwert schwingender, weil zutiefst und schmerzlich verletzter, liebender Mann. Ich hab ihn brüllen hören in seinem Schmerz und auf und ab laufen und den Tauben die Faust entgegen recken sehen in seinem Rathausturm hoch über der Stadt.
Jedenfalls reichts mir. Ich geh ins Cafe und wasch mir die Hände und den Fuß. Das Handtuch hab ich, Vogelscheiße nach innen, zusammengerollt in die Tasche gesteckt. Als ich den Bechdel-Comic öffne, liegt ein zerquetschtes Kleinvieh auf Seite 3. Irgendein Käfer, eine Mücke, eine Wanze, was ist das für Zeug? Zerquetscht im Comic, was für eine Ironie. Ich muss an Mickey Mouse denken, die jede Quetschung überlebt hat, gattungs- und stilprägend bis heute. Nicht so dieses dumme Vieh. Was bleibt ist ein störender Fleck.
Natur, Natur, was soll das sein.
Juli 2014 – fatzebuck
Ich bin jetzt bei facebook. Aber ich kann da nix posten, dazu bin ich viel zu schüchtern. Das ist ja als ob man auf eine Bühne tritt, alle gucken einen an, sehen, wie man aussieht, und dann muss man eine Rede halten, sich präsentieren. Ein Alptraum. Alle kriegen mit, dass man da ist, was man denkt, und was einen so interessiert. Man sagt seine Meinung. Grässlich.
Ich will nur abgreifen. Aber das ist so egosau-mäßig, das kann man irgendwie auch nicht bringen. immer nur feige gucken, was die anderen so interessiert.
komisch finde ich die Unübersichtlichkeit, man weiß nie, wer sieht denn jetzt was wo automatisch oder absichtlich. sehen alle meine freunde, was ich sehe, sehe ich alle freunde von allen, was ist home, was ist chronik, was ist okay, was ist nicht okay. ist das eine private unterhaltung, äh, nein, das ist ein kommentar. kriegen die anderen mit, wenn mir jemand jemand vorschlägt und ich den dann ignoriere? ich will gar nicht so viel Freunde. ich muss dann ja noch mehr aufpassen, was ich nicht sage.
Juli 2014 – Fundstück 2

gesehen in – wo wohl – Neukölln
Juli 2014 – BraunWeißGrün
Ich fahre morgens mit dem Rad am Ufer in Kreuzberg entlang und entdecke auf der gegenüberliegenden Seite einen Lastwagen mit Kran, der gerade dabei ist, Flaschencontainer auzuladen. Das sieht toll aus. Diese bulligen Dinger hängen in der Luft, schwanken und schweben über dem oben offenen Lastwagen. Dann wird dem Container irgendwie der Boden weggezogen und die Flaschen tosen auf die Ladefläche.
Was mich schon immer interessiert hat, und T. neulich ausdrücklich bezweifelt hat, ist die Frage, ob die von der gutgläubigen Bevölkerung so hübsch und liebevoll in braun weiß grün sortierte Flaschen womöglich am Ende zusammengeschüttet werden. ich bleibe also stehen und warte bis der grüne Container aufgeladen ist. Der nächste grüne Container aufgeladen ist. Und jetzt wirds spannend. Wird er als nächstes den braunen Container an den Haken nehmen? Wird er davon fahren, weil er der Lastwagen für die grünen Flaschen ist und bald wird ein anderer kommen, der sich der braunen Flaschen annimmt? Und dann noch ein weißer? Der Kran greift sich den Braunglascontainter, zieht ihn hoch, der Containerbully schwankt über der offenen Ladefläche und zack – ergießt sich dann mit ohrenbetäubendem Lärm in den Lastwagen. Es könnte sein, also es könnte wirklich sein, dass in der Ladefläche des Lastwagens Unterteilungen angebracht sind, für braun weiß grün, dass Zwischenwände eingebaut sind, die man nicht sehen kann, weil der Lastwagen zu hoch ist, das könnte sein, man sieht es eben nicht, aber es könnte wirklich sein. Im Lastwagen sind die Flaschen dann getrennt, auch wenn es jetzt erstmal so aussieht, als würden sie höhnisch alle zusammen schmeißen. Ich höre T. verächtlich lachen. Na gut.
Ich trenne trotzdem weiter, das ist wie beten für Atheisten.
By the way, wieso stellen sie eigentlich nicht einfach neben die Flaschencontainer noch einen, in den man die Deckel werfen kann? Das wär doch praktisch.
Juli 2014 – Sozialhorst
Teil I
Ich bin auf einem Geburtstag eingeladen. Ein Mädchen, das ich mag. Mit dem ich irgendwie wenn auch von ferne aber doch befreundet bin.
Sie hat ein Kind. Einen festen Freund. Eine Eigentumswohnung. Sie interessiert sich für ethische Tiere und vermüllte Umwelt. Also bis auf das zweite alles anders als ich.
Ich bin zwei Tage lang nervös, denn man soll was mitbringen. Ich überlege Kuchen. Wälze Kochbücher, Kochhefte, Koch-Internet, was Einfaches, was Schnelles, was was nicht schief geht? Was Aufwändiges, was Cooles, was was mir Spaß macht? Sie hat gesagt, kein Stress. – Ich kaufe ein neues Kochbuch.
Endlich entscheide ich mich, gehe einkaufen, am Tag des Tages. Ich backe den Kuchen. Der will nicht so wie das Rezept sagt. Ich lass ihn drin. Noch immer ist er butterweich. Ich lass ihn noch mehr drin. Ich werde unruhig. Der ist zu feucht, aber jetzt wird er bestimmt zu trocken. Was mach ich dann? Eigentlich wollte sie ja auch lieber Salat mitgebracht haben, so in den Abend reingedacht. Ich hatte nur mehr Lust auf Kuchen backen. Aber sie hat doch Geburtstag, da sollte sie bekommen, was sie will. Wann geh ich denn da jetzt hin? Ab 5 geht‘s los, aber was heißt das? Wann geht man denn dann hin, um 5 oder um 8? Um fünf vor 5 mach ich einen Salat.
Teil II
Ich bin da und von der ersten Sekunde an ist alles pretty awkward. Kann sein, dass das auch mit meiner bereits instabilen Kuchenverfassung zu tun hat (da steh ich, voll übertrieben, mit Kuchen und Salat und Mitbringsel, wie needy ist das denn). Keine ihrer Freundinnen ist alleine da, keine. Es sind nur Paare da und vor allem: Kinder. Die rennen rum und pinkeln auf den Boden und sind süß und im großen und ganzen verständig. Teilweise hängen sie noch an Brüsten rum, teilweise rennen sie schon kreischend auf und ab oder heulen, weil es nicht ihr Geburtstag ist. Die Männer sind Architekten und Filmemacher und wenn sie jetzt noch nicht da sind, dann kommen sie gegen später dazu, von der Arbeit. Man kennt sich von früher, vom Studium oder aktuell aus dem Kinderladen und alle sind sehr nett und sehen gut aus, aber gucken komisch. Ich weiß nicht, was ich reden soll, fragen soll, für was ich mich interessieren könnte. Ich denke nach bis sich meine Stirn runzelt, aber mir fällt nichts ein. Im Grunde scheint Sprechen aber auch nicht so wichtig zu sein, denn nach Halbsätzen unterbrechen Kinder sowieso quer das angefangene Gespräch. Es geht um Bauprojekte, Wohnungen, die zu klein werden, weil das zweite Kind da ist oder demnächst kommt, um Häuschen im Grünen. I’m an Alien. I’m a legal Alien. Vielleicht bin ich auch ein bisschen enttäuscht. Ich wusste, dass es ein bisschen so wird, aber dass es so doll so wird und gar kein bisschen anders?
Die Wohnung ist schmerzhaft schön. Also wirklich schön, cool geschnitten, toller Balkon im Dach drin, gut eingerichtet, und hat wahrscheinlich in der Lage ne halbe Million gekostet.
F. und ihr Freund sind saunett. Von guten Eltern. Mit Gespür für meine Lage. Trotzdem oder deswegen: So geht’s nicht und ich muss hier raus. Auf der Straße kommen mir die Tränen von der Anstrengung. Ich rufe T. an und texte ihn zu. Der versteht mich.
Ich bin okay mit meinen Entscheidungen. Doch die Strukturen sind stark und lassen niemanden kalt. Nichts an diesem Leben triggert einen Wunsch in mir an (außer die Wohnung). Aber normal ist das nicht. Das kann mir keiner erzählen.
Juli 2014 – Gesprächsthema
Ich komme vom Einkaufen und biege um die Kurve in meine Straße ein. Da steht ein BMW mit der Schnauze in der Eingangstür vom Späti an der Ecke. Drumherum Absperrband und weißes Zeug, damit nichts brennt. Zwei Polizisten laufen um das Auto herum und machen sich Notizen. Well, da ist wohl einer deutlich von der Straße abgekommen. Aber als Berliner geht man an sowas vorbei als wärs nix. Noch nicht mal meinen Schritt verlangsame ich. Ein kurzer, schweifender Blick, und weiter. Daheim im Dorf wär das ein Gesprächsthema für die nächsten Tage.
Juli 2014 – WM
Noch ne halbe Stunde bis Fußball.
Auf dem Hauptbahnhof (Rückfahrt von HH, es ist sonntag Abend 20 Uhr 30) noch schnell zu Kaisers, dauert ein bisschen, bis ich ihn finde. Immer so. Schwer, sich zu orientieren hier.
Alles voll mit leider Assis, ich stehe in einer Eng-Schlange, die sich vorne in zwei Kassen teilt. Jeder vor mir so ca. 1 bis 2 Bier, aber in Gruppen. Es dauert.
Kurz vor dran schleicht sich einer von rechts ran. Vordrängeln. Ich sag ihm, sorry, da hinten ist das Ende der Schlange. Er braucht eine halbe Sekunde von meinem Gesicht bis zu seinem Ohr, dann geht er ab, hoch an die Kaisers-Decke. Beschimpft mich, was singst du, was heulst du, was jaulst du. interessant, guter flow. Interessant auch, welche Assoziationen ich in ihm auslöse, er schimpft, ich würde aussehen wie ne Crack-Hure (okay, kann ich nachvollziehen), ich würde stinken (stimmt nicht, ich riech gut, ich überlege, ob er vielleicht meine Ledertasche meint. Oder mich mit dem Restgestank in der Schlange verwechselt.). Dann nennt er mich Öko-Fotze. Also jetzt bin ich beleidigt. Mit Fotze hätte ich leben können, aber mit Öko-Fotze? Wie kommt er darauf, frage ich mich beunruhigt? Slim-Jeans, silbern glänzende Trash-Turnschuhe, Second-Hand-Windjacke, oh mein Gott, seh ich aus wie ne Öko-Fotze?!
Leider bin ich wie er nicht so recht bereit, klein beizugeben. Sollte ich aber vielleicht, er hat ne Flaschen-Waffe in der Hand, die er mir über den Schädel ziehen könnte. Der Typ ist von der klassischen Berliner Proll-Sorte, schnell derbe hochgehen und dann auf jeden Fall dranbleiben. Leider bin ich so langsam auch von der Sorte. 14 Jahre Berlin färben ab. Vielleicht krieg ich irgendwann nochmal auf die Fresse in meinem Leben. Kann echt sein. Fühlt sich leider nur immer so crazy an, in der Schlange stehen und sich mit Assis streiten. Ohgott, ich bin ne borderlinige, Öko-Fotze, alles wird schlimm. Ich muss an O. denken, mit seinem Kieferbruch.
Als ich die Sachen aufs Band lege, zwei vor mir dann der nächste crazy-guy. Er krakeelt und droht und ruft dann ernsthaft mit seinem Handy die Bullen, weil sie seine 5 Pfandflaschen nicht zurücknehmen. Als ich draußen bin, kommen gerade drei schwarz gekleidete Abfederer angelatscht, die Sache kompetent zu lösen. Ist alles voll von denen hier, die haben ne harte Scheißnacht vor sich. Schwarz gefederte zwischen weißen Deutschbeflaggten. Aber ist ja auch furchtbar, der Pfand-Assi wollte bestimmt nur sein Pfand gegen ein Bierchen eintauschen, das Finalspiel genießen, sich inkludieren, und jetzt hat bei Kaisers der Automat dicht. Da pocht er auf seine Menschenrechte als Verbraucher.
Ich rette mich nach Hause und mach das Stadion an.
Das Ergebnis ist ja bekannt.
Juli 2014 – Hamburg 6

Vorm Pudels. Ach, Hamburg – wie immer ein gutes Gefühl für den Schmerz dieser Welt.
Juli 2014 – Hamburg 5
Wir sitzen vor Facebook. Habe B. und N. gebeten, mir das beizubringen. Habe mich kürzlich zum zweiten Mal angemeldet. Wir suchen und versuchen, probieren aus, wie man möglichst private bleibt, was man sieht, was nicht, was man löschen kann oder nie mehr. Für uns ein riesen Thema, für 22jährige wahrscheinlich scheiß drauf.
Es gibt ein Foto auf B.s Seite, das jemand gepostet hat, da sieht man viele Leute, unter anderem auch B. Eine Freundin hat es mit B.s Namen markiert. (Ein schönes Foto, aus leichter Aufsicht fotografiert, mit einer tollen Dynamik.) Einzig, die Person auf dem Foto ist nicht B.! Sie sieht ihr nur zum Verwechseln ähnlich.
Ich bin begeistert:
B. hat eine Doppelgängerin, die U-Boot-Ausschnitt trägt, das würde B. nie tun. Vielleicht ist das Foto aber auch aus der Zukunft. Es gibt ein paar Hinweise darauf. Zum Beispiel hat jemand einen gelben Helm auf und einer sieht aus, als hätte man ihn als Sachbearbeiter verkleidet. Es gibt viele Tische hinter denen Menschen engagiert stehen und irgendwas erklären oder bereitlegen als Information. Vielleicht ist es auch ein Theaterstück, eine Performance, eine Tanzaufführung, ein Kunst-Foto, komplett durchinszeniert. Jedenfalls wurde ein Foto von B. gepostet, von jemandem den sie nicht kennt, auf dem sie nicht drauf ist, das aber mit ihrem Namen markiert ist.
OMG!
Juli 2014 – Hamburg 4

Juli 2014 – Hamburg 3
Bei B. und N.
Es gibt Frühstück und tollen Käse, alles ist am Platz, gebügelt, sauber und aufgeräumt. Es gibt Einkaufstaschen, die man mitnimmt, wenn man zum Bäcker geht oder auf den Markt. Das tut man nämlich. Es gibt Laken und Besuchercouches und schöne einzelne Dinge und viel Kultur in den Regalen. Es gibt Wege, die man mit dem Rad fährt und geregelte Arbeitszeiten. Alles ist komfortabel und unaufdringlich und ohne jeden Anspruch an andere, es genauso zu machen.
Zum ersten Mal reden sie übers Streiten zwischen sich. Wusste ich vorher gar nicht, dass es das gibt.
Alles ist wie immer sehr entspannt und lustig. Wir lachen viel. Ich komme immer ins Quasseln, ermutigt vom aufmerksamen Zuhören. T. rutscht in sich zurück, wie so oft auf Reisen, um dann für ca. fünfzehnminütige Phasen aufzuwachen und Dinge zu erzählen, die alle interessieren und zu denen er eine dezidierte Meinung hat. Ich fühle mich wohl hier, auch weil das Wetter schön ist, das ist in 95 Prozent der Fälle ja leider nicht so und es kann auch kalt und depri und selten sogar langweilig und fremd sein hier.
Ich mag das Trinken in der Bar und den Flohmarkt und die kurzen Wege, den Dom, den Bunker und die Second Hand Läden, auch wenn die Marktstraße nicht mehr so toll ist wie in den 90ern. Hamburg hatte noch nie ein Problem damit soft zu sein, anders als die Berliner. Deshalb kommt meine Palm Beach Windjacke hier auch gut an, während mein Tiger-Shirt eher für Irritation sorgt.
Was für ein gelungener Wochenendausflug!
Juli 2014 – Hamburg 2
Hamburg ist so schön! Wir stehen am Hafen und die Schiffe tragen dreimal hoch Container, werden geschleppt von sympathischen, tapferen, kleinen Schleppern, vorne, hinten, strengen sich an, bleiben cool, zeigen dem großen Schiff wie man reinkommt in ihren Hafen. Wir trinken Bier und anderes und A. geht es gerade gut und B. und N. stabil wie immer und vom Pudel her klingt krachmusik.
Am Samstag Veranstaltung mit Klaus Walter in dockville in Wilhelmsburg, das mich, vielleicht wegen der Namensähnlichkeit an Williamsburg in New York erinnert, wo man auch rüberfährt, rausfährt, sich des abends nach der Arbeit hinexkludiert und sich wieder zurückinkludiert am Morgen, in einen Kern, der einen nicht dabei haben will, in den man es nicht reingeschafft hat. Ein bisschen auch wie Queens, die Läden, die Leute. Der Vortrag wie 1996, I like it, das war meine Zeit, die wird hier noch hochgehalten. T. lästert. Recht hat er, aber das ist mir egal. Hamburg ist so schön!
Juli 2014 – Hamburg 1
Auf dem Weg nach HH im InterRegio. Wir haben es geschafft ein 19,90 Ticket zu ergattern, den von der Bahn gut versteckten Zug zufinden, der früh morgens um 6:54 nach HH fährt. Im IRE sind die 80er wieder modern, in türkis und altrosa, und ich erinnere mich an all die Fahrten mit diesem Zugtyp, in dem man schlecht aus dem Fenster sieht, die Sitzgruppen wohnzimmerfamiliär zusammengestellt sind, man seine Jacke an eine Garderobe hängt und der Durchguck zur Nachbarin derart frontal ist, dass man tun muss, als wäre man nicht da. Catering gibt’s am Sitzplatz. Theoretisch, faktisch nicht. Schade.
Eine Mutter und ihre ca. 8jährige Tochter steigen ein. Sie reden so nett und verständig miteinander, sind so nett zueinander, so überhaupt nicht nervig, dass ich die ganze Zeit zuhören muss und zu Tode gerührt bin. Dabei sind sie echte Voll-Prolls. Die Mutter trägt Billig-Brille, Klamotten von kik, die Haare dünn und strohig vom vielen immer wieder selber färben. Das Mädchen praktisch genauso. Sie haben sich gefreut, wahnsinnig gefreut auf diese Zugfahrt. Sie haben Cola dabei und Salamibrote und Radieschen, die das Mädchen nicht mag (zu scharf) und Stofftiere, die auch aus dem Fenster gucken dürfen und PFERD! oder KUH! mit entdecken dürfen. Jetzt noch kommen mir die Tränen, wenn ich daran denke.
Die Mutter hat einen nagelneuen kleinen Fotoapparat, digital der Billigsorte, für den sie eine Tasche gehäkelt hat, mit Bändchen. Sie fotografiert alles, das Draußen durchs Fenster und innen das Drinnen. Gemeinsam schießen sie Selfies von sich im Zug. Dann liest die Mama Heftchen und als die Schaffnerin kommt, und mit ihr spricht, fängt sie an, zu stottern. Keine Sekunde hat sie gestottert, als sie mit ihrer Tochter gesprochen hat! Aber es scheint sie nicht zu irritieren. Sie will reden, erzählen, wie sie sich gefreut hat, die Tochter, und dass nun die Schaffnerin endlich kommt und die Tochter ihr die Fahrkarte geben kann! Die bekommt einen ordentlichen Zangenabdruck. Und die Tochte bekommt die Fahrkarte zurück. Eine Medaille, eine Auszeichnung, eine Ehre.
Sie spielen ein gleichberechtigtes Würfelspiel. Die Tochter geht allein aufs Klo. Sie summen sich die Lieder ins Ohr und die andere muss raten. Sie singen leise Eisern-Union-Fan-Lieder (!, die Frauhat die Deutschlandfarben auf den Fingernägeln) und ein Lied namens das Rote Pferd.
Als mal wieder ein paar Kühe die Tochter begeistern, sagt die Mutter, dass sie dann wohl mal Urlaub auf dem Bauernhof machen müssen. Und erzählt einer Sitznachbarin hinter uns, dass sie als Kind bei einer Kälbchengeburt dabei war. Wieder fängt sie an zu stottern. Die Frau lässt sie kühl hamburgisch abfahren. Sie habe viele Jahre auf einer Ranch gelebt, für sie sei das nichts besonderes. Ich würde sie gerne ohrfeigen. Die Mutter jedenfalls hat verstanden und redet den Rest der Fahrt nicht mehr mit ihr.
Die Stofftiere am Fenster (eine kleine Eule und ihr großer Kumpel Frettchen) und daneben das Mädchen. Ich hab Lust, eine Geschichte daraus zu machen. Und ich denke natürlich auch an Irina, und die Zugfahrt mit ihr und Dorothy.
Auf dem Rückweg nach B. werde ich später zu T. sagen, dass ich ein Träger von Geschichten bin, sie sind in mir drin, sie sind unruhig und wollen raus, aber ich kenne sie nicht, kann sie nicht hören, ihnen keine Stimme geben und das quält mich. Ich weiß so viel und finde den Kanal nicht. Das ist schrecklich und es macht mir Angst vor Krebs.
Juli 2014 – A.
Ich habe A. mal wieder gesehen, nach langer Zeit. Sie hat mir ihre Wohnung gezeigt und ihr neustes Kind: O.
Es kam zur Welt als ich mit T. in den USA war, letztes Jahr im September. Wir waren in diesem airbnb-Apartment in Los Angeles, da hab ich die sms bekommen.
O. und ich sind uns gleich sympathisch. (Mir scheint, er kam nicht ganz geplant, was eigentlich so gar nichts für A. ist, die die Dinge sehr gerne plant. Ein kleines bisschen nimmt sies ihm vielleicht übel, aber er ist so ein Typ, der offensichtlich das Gefühl hatte, er gehört auf diese Welt und sich das nicht hat nehmen lassen. Ein kraftvolles Kind, ein kleiner, witziger Aggro mit Rotznase, babydicken Bewegungsbeinchen und wenig Sprache. )
Es rührt mich immer bis in die Eingeweide, sie zu sehen, und ich weiß, dass sie das nicht weiß und wahrscheinlich auch nicht verstehen würde. Aber sie scheint mir so glücklich, so reich, an Verbindung zur Welt und ihren Mitmenschen, mit viel Kraft und Nachhaltigkeit erarbeitet und organisiert, und doch weit davon entfernt nicht zu wissen, wie traurig alles sein kann.
Leider kommt ein Freund und Nachbar von ihr dazu und wir können nicht mehr weiter reden. Oder ich nicht.
Ich erinnere mich, wie sie mich mal mutig gefragt hat, wieso ich keine Kinder will. Ich wusste nicht, wie ich ihr das erklären soll.
Ich mag, wie sie ihre Kinder handelt. Sie ist begeistert und voll dabei, sie hat wenig Angst (nicht so wie ich, die den Impuls aktiv unterdrücken muss, O. ständig zu überwachen). Sie addiert ihre Kinder zu ihrem Leben dazu und subtrahiert nicht ihr Leben von den Kindern.
Juli 2014 – Robbe
Ich muss ne Robbe mieten, in meiner Wohnung steht Müll rum. Und zwar ein Bett aus Holz, Größe 100 mal 200, und eine dazugehörige Matratze. Wie so oft, wenn man was aussortiert hat, kann man nicht fassen, wie lange man die Sache durchgezogen hat.
Ich bitte T. mir zu helfen. Wie immer bei solchen Sachen ist er sofort dabei.
Ich miete also eine Robbe am Schalter (dabei treffe ich noch ne Ex-Affäre meines Ex-Mitbewohners, die sich äußerlich so verändert hat, dass ich sie nicht mehr erkenne, sie scheint einen lebensanschaulichen Re-start durchgemacht zu haben, irritierend sowas), bei einer der ladies, die gerade nicht am Telefon sind.
Hier wird kein Mitarbeiter eingestellt, der nicht raucht, das hört man am Husten, sieht man an der Haut und daran, dass sie rauchen. Sie will die Kaution Cash oder gar nicht, also gut, ich nochmal los zur Sparkasse und wieder zurück.
Dann fahren wir zur Behmstraße, Recyclinghof. Ich sitze am Steuer und habe wie immer Angst. Dabei bin ich mal echt gerne Auto gefahren, aber für mich ist das Auto an sich eine Waffe, mit der man Dinge potentiell zerstören und Menschen potentiell umbringen kann. Leider traue ich auch mir da nicht über den Weg. Dennoch ist so weit oben sitzen schön und erhaben und stolz. Aber gleich schon wieder gender-politics, ich weiß nicht, wie der Rückwärtsgang reingeht (T. weiß es), ich weiß nicht, wo die Handbremse ist (T. weiß es). Erzeugt in mir zusätzlichen Aggro-Stress.
An der BEhmstraße werde ich als erstes von tätowierten Männern in orange angeschissen, die auf Barhockern am Eingang sitzen als wären sie Türsteher. Man will wissen,w as ich geladen habe. Man winkt mich undefiiniert rüber richtung links: Sperrmüll.
Ich fahre rüber und stelle mich hinter zwei parkende Auslader-Autos auf die rechte Spur, obwohl T. vorschlägt, ich soll mich auf die linke stellen. Dort sind Container mit geöffneten Türen, mir kommt es vor, als würde ich auf diese Weise den Zugang zubauen. Von links hinten kommt ein Gabelstaplerfahrer inorange. Er hält an, um mich ebenfalls ausführlich anzukacken. Wieso ich links stehe, wo er durch muss. Ich hab keine Lust, mir das gefallen zu lassen, ich kacke zurück, woher ich das wissen soll, nichts davon steht irgendwo, ich dachte dies, die beiden da, usw. T., der sich inzwischen hinten zu schaffen gemacht hat, kommt dazu, als der G.fahrer weiterfährt. Hat er doch gesagt, sagt er. Ich beschwere mich, dass er mir in den Rücken fällt statt sich solidarisch zu zeigen und dem Kerl zu sagen, dass er sich zusammen reißen soll, der jetzt auch noch schön lustvoll den Kopf über mich schüttelt während er seine Tonnen auflädt. Nice.
T. teilt mir mit, dass der Müll abgeladen ist – warum diese Hektik? – und dass die vier Ytong-Steine, die wir noch im Wagen haben, in die Kategorie Schutt fallen und Geld kosten. No way! Fuck BSR. Fuck Kack-Arschlöcher. Ich fahre raus und lade die Steine bei einem Container in einem Wohnviertel illegal ab.
Beim Robbe abgeben muss ich 14 Euro statt 4 Euro bezahlen, weil ich nicht geschnallt habe, was die lady mir untergejubelt hat, eine „Versicherung“ für 10 Euro.
Ich bin müde und traurig über die Welt, in der man immer nur kämpfen muss und verarscht und angekackt wird und ich will nach Hause und muss mich auch noch zusammen nehmen, dass ich T. nicht vollhasse, der ja nur nett war und mir geholfen hat.
Ich kann nicht leben. Ich will nicht leben in so einer Welt, denke ich. Es macht mir keinen Spaß. Ich weiß nicht, wo Handbremsen sind. Und neben mir ist jemand, der immer alles weiß. Wieso will die BSR 50 Euro für Sperrmüllabholung? Damit die Leute ihren Müll in den Wald werfen oder auf die Straße, weil sie kein Geld und kein Auto haben? Damit die Umwelt so richtig schön geschützt wird bei so einem niedrig schwelligen Angebot? Müll entsorgen ist was für reiche Leute in dieser Stadt.
Ich nehme mir vor, das das nächste Mal den Müll in unseren Hof zu werfen, so wie alle anderen in meinem Haus es tun. Das ist billiger und schont die Nerven.
Juni 2014 – Hochzeit 2
Der freund einer freundin von L. flippt aus, als ich ihm sage, dass ich 8 Jahre älter bin als L. ich weiß nie, wie ich mit dieser reaktion umgehen soll, die es leider sehr häufig gibt, weswegen ich angefangen habe, meine altersangabe der situation und den wahrscheinlichen Vorannahmen anzupassen. Diese art von reaktion ist mir nämlich zutiefst unangenehm, ich scheine nicht im geringsten die erwartungen zu erfüllen, die man an eine Person meines alters hat und deshalb spreche ich nicht gerne daüber.
L. motzt über die Unterbringung. Wie immer hat ihre Schwester, die es chronisch besser erwischt besser erwischt – dabei ist sie doch die Patentante und sofort und als erste bereit gewesen, die Reise nach K. auf sich zu nehmen, während die Schwester bis kurz vor knapp nicht wollte. Ich kann das verstehen. Trotzdem strengt sie mich an. Sie ist die klassische Pauschalurlauberin. Wie viel und was kriegt man fürs Geld, Portionsgrößen, Sauberkeit, Freundlichkeit, wird alles bemerkt, jeder Deutsche ein ltur. Trotzdem haben wir es nett miteinander. ich mag sie, ihr Weg ist und war der längste. Die anderen kapieren das nicht. Am Abend darauf gehen wir beide ganz allein noch einen trinken.
M. tanzt. Ich kann mich nicht erinnern, sie jemals in meinem Leben tanzen gesehen zu haben. Der verschüttete Mensch in ihr kommt zum Vorschein. Und doch scheinen mir ihre Bewegungen, ihre Ausdauer schon geprägt zu sein von der Krankheit. Ich nehme sie mit auf mein Hotelzimmer als sie mal auf Toilette muss. Ich fotografiere sie. Ihr Kleid wirkt absurd mädchenhaft und ich ärgere mich über die Schneiderin. Sie kämmt sich die Haare. Sie plappert. ich mag sie, ohne sie zu verstehen, jemals verstanden zu haben. Wie immer tut sie mir leid, weil sie eine Tochter hat wie mich.
Als mein Bruder mit I. tanzt, kommen mir doch noch die Tränen.
Ich finde, sie schlagen sich hervorragend. Was für ein Stresstag! Sie sind ein gutes Team. Ich freue mich auf die Kinder.
Es regnet kein einziges Mal obwohl es die ganze Zeit so aussieht. Alles läuft nach Protokoll. Das ist lang und durchgetaktet. Zwei Standesbeamten müssen sich versichern, dass beide Parteien verstehen, auch das Kleingedruckte. Sie müssen versichern, dass sie sich gegenseitig über ihren Gesundheitszustand aufgeklärt haben. Die Übersetzerin weint mit vor Rührung.
Der Fotograf ist ein harter, abgebrühter Typ, er manipuliert das Lachen der Menschen wie ein Marionettenspieler. Später erfahre ich, dass er das schon seit 20 jahren macht.
Der Videomann erklärt uns morgens wie wir L. ankleiden sollen, das macht man so in der Slowakei. Es macht Spaß, auch wenn mir M. ein bisschen leid tut.
Als sie B. für ein Foto küssen soll sieht sie aus wie ein Kind das zum ersten Mal in ihrem Leben und noch dazu einen fremden Onkel auf den Mund küssen soll.
Der Garten ist wunderschön, ich bin auf einer amerikanischen Hochzeit mit weißen Tuchgirlanden und Blumen und einem Zwischengang durch den die beiden schreiten. Ich freue mich den ganzen Tag über das schöne Fest.
Wir Germans tanzen alle und die Slowaken trinken viel weniger als angenommen. Das dient dem Abbau von Vorurteilen. Alleine tanzen darf man übrigens nicht. Man fasst sich an den Händen, das geht dann links rechts, viel GEhüpfe, auch mal große Runden, Kreise, Polonaisen.
Irgendeine dicke Cousine der Braut kommt zu mir, als ich alleine tanze, später, zu Daft Punks Discohit des letzten Sommers. Ooouuuhh, macht sie, I cant see you dancing alone, und drückt mir ein Gespräch rein, dass mich an diese proll-britischen Hochzeitssendungen auf sixx erinnert. Ob ich neidisch bin, auf meinen Bruder, weil er jetzt (vor mir) verheiratet ist. Ob ich nachher auch den Brautstrauß fangen gehe. Nein. sage ich. (Dieses Ritual entpuppt sich später übrigens als abgekartetes Spiel, die hübsche Trauzeugin und beste Freundin der Braut kriegt das Ding praktisch vorgelegt, wie als wär sie Stürmer beim Fußball). Okay, denke ich, bitch. Wenn ich keine überzeugte alte Jungfer wäre, sondern eine mittdreißige Single-Frau mit Hang zur klassischen Biografie würde ich mich jetzt richtig schlecht fühlen und auf die Toilette gehen, um zu heulen und bulimisch das Hochzeitsbufett auszukotzen. Ohne heiraten und Kinder kriegen kann eine Frau hier nicht glücklich werden. Dafür sorgen schon die anderen Frauen. Auch bei den german friends von L. übrigens steht das Heiraten hoch im Kurs. Und die sind alle Mitte dreißig. Schwer, sich nicht falsch zu fühlen. Gottseidank lebe ich im Heimathafen der Schrägvögel, da fällt mir nie auf, wie schräg ich bin.
Juni 2014 – Hochzeit 1
B. ist wahnsinnig. So wahnsinnig zwangswahnsinnig, dass ich wieder mal nur staunen kann. Und das noch wahnsinnigere ist, dass alle so tun, als wär das normal. Dass sie sich kommandieren, beherrschen, bestimmen lassen von seinem Wahnsinn. Er meint‘s doch nur gut, höre ich immer wieder an diesem Wochenende. Von den Frauen in der Familie. Klar, wie Hitler, der hat‘s auch nur gut gemeint.
U. erzählt mir, dass sie sich erinnert, wie er mir schon hinterher gerannt ist als ich noch klein war, und ich ihm immer davon. Das ist heute noch so, sage ich, aber ich weiß nicht, ob sie es gehört hat. Es geht nicht um Sorge, es geht nicht um kümmern. Es geht um Zugriff, Kontrolle, es geht um ihn. Seine Identität als Mann und B. Darum, dass er sich nicht wohlfühlt, nicht weiß was er tun soll ohne eine anerkannte Aufgabe, als wäre es ihm peinlich mit den anderen herumzusitzen und zu reden, weil man da sozial sein muss und er nicht weiß, wie das geht.
Ich und B. schreien uns also auf der Straße an. (Ich bin erstaunt, über meinen problemlosen Zugang zur Wut. Es macht mich fertig, ich schäme mich, ich zittere, aber unterm Strich ist das egal. Ich sage ihm, dass ich ihn übergriffig finde.) Was da aufblitzt, für einen Moment, auf dieser Straße in K., in Anwesenheit von Zeugen, ist der blanke Hass. Er steht in meinem Gesicht und wird augenblicklich von seinem Gesicht beantwortet, als hätte er nur darauf gewartet. Das erstaunt mich für eine halbe Sekunde. BEstätigt mich und meine alten GEfühle. Nur ein paar Millimeter unter der Oberfläche steckt sein Hass, sofort sichtbar, ungefiltert, genährt von Jahrzehnten unterdrückter Aggression.
Wie immer ist meine Mutter nicht da. Sie ist Luft. Sie ist irgendwo. Man kann sie nicht sehen und sie spielt keine Rolle.
Juni 2014 – Fundstück 1

die sind toll, über die schreib ich mal was! Super-Tussis retten das Vorstadt-Universum.
Juni 2014 – Hubots, nochmal
2. Staffel beendet.
ich frage mich, wie ich das finde, dass die Serie die Hubots unterteilt in den gemeinen Hubot und den besseren Hubot.
Der Elite-Hubot ist von David Aischa (verrückter, unglücklicher Frankenstein-Wissenschaftler) entwickelt und mit einem besonderen Code ausgestattet. Dieser Hubot hat ein Bewusstsein, einen eigenen Willen, er will leben und respektiert werden wie ein Mensch.
Und dann gibt es noch den Normalo-Hubot. Er ist eine einfache Maschine, programmiert Dienstleistungen zu erbringen, manche einfacher, andere komplexer. Dieser Hubot wirkt zuweilen recht mitleiderregend und schützenswert. Man empfindet es als gemein, wenn er manipuliert, abgeschaltet oder missbraucht wird. Denn er kann sich ja nicht wehren, ist seiner Programmierung und der willfährigen Nutzung des Menschen ausgeliefert.
Jedenfalls ist das ein bisschen so, als gäbe es zwei verschiedenen Klassen von Schwarzen, bessere und schlechtere. Macht die Serie dadurch nicht einen eigenen Rassismus auf? (Also ohne ihn als erzählerisches Element zu nutzen, ohne das Prinzip zu reflektieren, meine ich, sondern es zu etablieren).
Kann natürlich sein, dass sich das im Laufe der Serie nun konsequent dazu weiter entwickelt, dass die Elite-Hubots sich die Normalo-Hubots unterwerfen. (in Südafrika hatten die coloureds einen besseren Stand als die blacks). Obwohl es im Moment eher so aussieht, als wäre zumindest ein Teil der Elite-Hubots vor allem angetreten, sich die Menschen zu unterwerfen. Der andere Teil möchte hingegen friedlich mit den Menschen zusammen leben. Also zwei verschiedene politische Haltungen/Strategien, radikal-extremistisch oder gemäßigt. Diese Teilung vollzieht sich aber innerhalb der Elite-Hubots.
Durch die Etablierung des David Aischa-Codes erzählt die Serie also nicht – so Cs Theorie neulich beim Kaffee in der Weinerei- von verschiedenen Haltungen, wenn sie die Elite Hubots neben bzw. über die gemeinen Hubots stellt. Sondern sie entwickelt zwei verschiedene Klassen von Hubots, spricht ihnen jeweils essenzielle Eigenheiten zu, die sie unterscheiden. Reproduziert sie damit nicht das rassistische Prinzip, das sie vorgibt zu bearbeiten. Oder kurz gefragt: Ist sie rassistisch?
Interessant übrigens, dass die sukzessive Menschwerdung auch der gemeinen Hubots – z.B. durch die Manipulation des Menschen oder weil er darauf programiert ist, dazu zu lernen – dazu führt, dass sie die Aggression für sich entdecken. Essential Part of being human. Dass das Menschsein eine Last ist, begreift Florentine in den letzten Folgen der 2. Staffel schmerzhaft. Sie verliert ihren Geliebten, ihr Baby und ihren Wohlstand.
Und zuletzt: Wie sieht es aus mit dem Umkehrschluss. So wie der Hubot sich sehnt, ein Mensch zu sein, sehnt der Mensch sich, ein Hubot zu sein. Er würde so gerne funktionieren, nach den Programmen, die die Umwelt ihm vorgibt. Aber ständig scheitert er.
Juni 2014 – Hard Candy
Ich glaube nicht, dass Madonna mit ihrem Hard Candy Konzept hier in Berlin ernsthaft Punkte macht. Auf den Plakaten präsentiert sie sich als Tier. Verzerrtes Gesicht, Kampfmaschine. Hartes Rot, hartes Schwarz, urban verwaschen. No sweat, no candy steht auf den shirts. Da lacht man doch verächtlich. Wen soll das hier ansprechen? Wir sind nicht in New York wo die Leute sich umrennen müssen, um zu überleben. Hier machen sogar die Läden in Mitte erst um 11 auf. Und um 8 wieder zu. Und die Touristen müssen verwirrt um 9 Uhr früh ins Starbucks und warten, bis sie shoppen können. Die Leute arbeiten sich nicht krumm hier, das ist nicht die Idee. Sie sitzen auf dem Tempelhofer Feld in selbstgemachten Schrebergärten oder wippen auf Umsonst und Draußen-Festivals von links nach rechts oder trinken Bier im Park. Nichts da Hard Candy. Ein bisschen Yoga, ein bisschen Pilates, ein bisschen Shaper 50 plus, aber doch nicht deep work und hardcore dance.
Juni 2014 – Alt 1
Aktuelle medizinische Beschwerden:
Schmerzen im Bereich Lende, Nacken und Schulter.
Rechtes Auge innen stark gerötet.
Schmerzen in rechter Hand, vornehmlich kleiner Finger, sowiedem Ellbogen.
Linkes Hüftgelenk blockiert bei ca. 45 Grad.
Magenschmerzen nach Nahrungsaufnahme.
Blähungen.
Wir machen trotzdem weiter.
Juni 2014 – L.
L. heiratet. Das ist ein interessantes Ereignis.
Ich hab ihn wachsen sehen. (Er war ein Baby, ich weiß es.) Irgendwo neben mir, hinter mir, unter mir, ist er gewachsen. In anderen Zimmern, anderen Klassen, zu anderen Zeiten, mit gefühlt anderen Eltern.
Im Grunde habe ich ihn nicht gesehen. Im Grunde weiß ich kaum etwas über ihn. Ich hab ein schlechtes Gewissen.
Ich hab ihm weh getan, fand ihn langweilig und doof. Ich war grob, roh und gemein. Nur selten wollte ich ihn beschützen.
Trotzdem ist es nah genug, dass es mich rührt.
Es rührt mich, weil er Vertrauen hat. Weil er Pläne macht, weil er Dinge tut, die man macht, wenn man lebt. Wenn man gerne lebt.
Es rührt mich, weil er mir mal gesagt hat, er sei ein glücklicher Mensch geworden.
Ich bin gespannt, ob mir die Tränen kommen.
Juni 2014 – Der Mensch am See
Der Mensch am See ist anders als sonst.
Er ist entspannt, in Hautkontakt mit sich selbst. Er raucht, isst (Gegrilltes), trinkt (Alkoholisches), guckt Gras, checkt Mücke und wird erotisch.
Dann fährt er heim.
Juni 2014 – abregen
Heute Job-Gespräch bei H., nur mit den Kollegen, die ich beide schon kenne. Sie sollen mich auf den Stand der Dinge bringen.
Von M. fühle ich mich wie immer taxiert auf meine beruflichen skills hin. Was hast du so gemacht, was kannst du so, (Unterton kann ja jeder kommen…) Aber er ist mein Kollege, nicht mein Chef, nicht für die Einstellung zuständig! Also warum fragt er mich das?
Er möchte, dass ich ihnen Skripte von mir schicke, damit man mal sieht, was ich so mache. Er ist doch wie ich, tut aber immer so als wäre er besser, vermittelt mir, z.B. mit dieser Technik, er sei größer, höher, weiter als ich. Tut als würde er mitbestimmen, Einfluss haben/nehmen, ob ich ins Team komme. -was mir Angst macht, mich beunruhigt, bedroht, klein, lein.
Bin ich paranoid mit dieser ganzen Mann Frau Scheiße? Zu viel Mad Men geguckt? Da haben Don und Campbell gestern mal wieder Peggy so richtig schön ausgebootet. Abtropfen lassen, statt sie zu unterstützen, sie zwischen ihren Intrigen zermalmt.
G. treibt mir das abends bei einem Weißwein in der Bar wieder aus: Vielleicht ist es doch nur Neugier, ehrliches Kollegen-Interesse – ein bisschen egoistisch, gut, – von wegen mal gucken wie so ein Radioskript aussieht, und so, aber im Grunde. – . Okay, okay, ich reg mich ab. Obwohl…
Juni 2014 – War Room
L. erzählt mir von seinem letzten Arbeitsplatz.
Es handelt sich um ein großes deutsches Unternehmen im Bereich der Telekommunikation.
Dort gab es einen War Room. Kein Witz. Versammlungsort für die Chefetage.
Und fire drills, zu denen die Führungsetage morgens um 4 Uhr zusammen geschrillt wurde (hätte man auch um 9 Uhr machen können).
Und ein rotes Telefon. Auch kein Witz.
Wo wir sind, ist vorne, sagte mal jemand von ganz oben (L. meint sich zu erinnern, dass das ein Spruch der SS war).
Im Sightseeing Bus hat jemand auf die Frage, was die Anwesenden so beruflich machen, gesagt: We hunt people.
(Und da wundern die sich, dass Frauen keine Lust auf diese Jobs haben. Dass sie keine Lust haben, Männer zu werden und in diesem systemischen Schwachsinn Mimikry zu betreiben).
L. saß 25 Stunden in Telkos (Telefonkonferenzen). Jedes zweite Wochenende hat er nicht geschlafen. Er hatte andauernd Bereitschaft. (als wären sie Chirurgen in der Notaufnahme, als ginge es um Leben, als ginge es um irgendwas Wichtiges!)
Einer von ganz oben ist irgendwann ausgestiegen mit den Worten I want my life back.
L. sagt übrigens, durch die Quote wird es mehr Frauen geben, aber am System wird sich nichts ändern. Nur die Frauen werden sich ändern.
Juni 2014 – Bohrmaschine
Seit Wochen brauch ich ne Bohrmaschine um ein Brett im Bad anzubohren. Das Problem: ich hab keine. Vor allem und in erster Linie bin ich aber nicht bereit, mir diese hässlichen Winkelhaken in die Wand zu hauen. Sämtliche Recherchen in den Baumärkten dieser Stadt haben aber ergeben: Das Brett ist zu dick für die elegante Silberklotz-Halterungs-Lösung und damit juck.
Kaufe eine Tube „Kleben statt Bohren“ und das Brett hält.
Ich bin begeistert.
Das ist mein Ding!
Ich renne durch die ganze Wohnung (meine übrigens wieder) und klebe statt bohre wie wild. Alle Wände sind jetzt voll. Kommt und seht. Kein Fitzelchen Platz mehr. Und das alles ohne Alarmgeräusch auf Ebene Kamikazeflieger, der dann am Ende ja doch immer in die Butterwand abrutscht, Löcher reißt, die man dann wieder verputzen und überstreichen muss, und der kiloweise durch die ganze Stadt geschleppt werden muss, von mir, dem Trageesel.
Kleben statt bohren!
K-leben statt bohren!!
Juni 2014 – Ribisl
Heute Johannisbeer-Torte mit Baiser, mein all time favourite Lieblingskuchen.
Hier auf der Brunnenstraße heißt sie Ribisl-Torte, weil Ösi-Betreiber. (stimmt gar nicht, Franzose.) Das Baiser ist so lecker, dass ich fast weinen muss. Ja, ja, die kleinen Dinge. Ich stelle mir vor, ich liege auf dem Sterbebett. Was bleibt sind Erdbeeren, Ribisl-Torte und das Meer. Deshalb ist es so wichtig, dass man weiß, was man mag. Ich nehme mir vor, mal wieder eine detaillierte Liste zu schreiben. (Wie es empfohlen wird für Demenz diagnostizierte, hab ich mal gelesen.)

Mai 2014 – Greifenhagener
Seit heute in der Greifenhagener. Hier wieder alles anders. Wohngebiet. Ost-Wind weht schon, rauscht von der großen Straße her (Wisbyer).
Die Wohnung: erwachsen (wegen C.s Dingen ab und an eine Vertrautheitsinsel).
Töpfe, Pfannen, Einbauküche.
Schränke, Vitrinen, Regale.
Staufächer.
Bilder in Rahmen, Klavier
Teppiche. Tischchen, Pflanzen. Sitzkissen. Balkon. Laminat. Nachbarn. Vier verschiedene Waschmittel. 10 verschiedene Shampoos (Frauen). Post. Mülltrennung, Tischdecken.
Seltsam, wie diese Wohnungen (A.s ist genauso, nur Mann: etwas schmutziger, strenger) die großen Fragen an mich selbst aufwerfen. Wieso hab ich das nicht? Wieso will ich das nicht? Will ich das? Will ich es nicht, weil ich es nicht kann?
Ein bisschen fühl ich mich frei hier , durch den Komfort. Ein bisschen fühl ich mich eingesperrt, durch das Erwachsene.
Der Schreibplatz ist klasse. Hell, rausgucken – es kann doch nicht so schwer sein, sowas mal zu finden?
Noch drei Tage, dann gehe ich zurück in meine Wohnung. Die ist arm, bindungslos, vorübergehend. – Hängen geblieben?
Bin mal gespannt, wie ichs finde.
Mai 2014 – Fahrrad
Fahrradläden sind wie Plattenläden. Orte reiner Männerkultur. Ihre Türpolitik ist zwar subtiler, tolerant runtergeschraubter, aber im Grunde sind sie die türkisch-arabischen Neonlicht-Kulturvereine des deutschen, weißen, schwarz gekleideten Mannes mittleren Alters.
Ich brauche einen Ständer. Ich gehe zum Fahrradladen und nehme mir vor, genau diesen Satz nicht zu sagen, um keinen blöden Spruch zu provozieren.
Er muss noch ne Bremse fertig machen, dann kommt er raus. Ich warte in der Sonne neben meinem Rad.
Er kommt, stellt sich hin, guckt, mit seinen tätowierten Waden. Wenn ich nur wüsste, was er da sieht. Ich sehe ein 80er grün-weißes Fahrrad mit so einer extra Querstange, die ich total cool finde. Die Schutzbleche könnten auch weiß sein, dann wärs perfekt. Und ein bequemer Sattel in weiß wäre ein Traum. Aber sowas gibt es nicht. (Wieso gibt es sowas nicht?) Er sieht was ganz anderes. wie ein Terminators oder ein Hubot scannt er das Rad und sieht Maschinenteile, Naben, Bremsen, Ketten oder keine Ahnung. So stehen wir nebeneinander und gucken jeder was anderes. Er jedenfalls, zum Rad: Nee, geht nicht. Ich, zum Rad: Nee? Geht nicht? Warum? Er, zum Rad: Da ist was abgebrochen. Ich, zum Rad: Wie abgebrochen? Er, zu mir: Na, abgebrochen. Abgebrochen heißt, da war vorher was da, was jetzt nicht mehr da ist. Abgebrochen halt.
Also Herrgott, ehrlich, ich meine, was soll das sein? Soll das witzig sein, halten die das für attraktiv? Denken die, man findet sie gut, wenn sie sowas sagen? Ist ihnen das egal, weil sie sich selber so supergeil finden, dass sie niemand anderen mehr brauchen, der sie supergeil findet? Zugegeben: Wie abgebrochen? ist ne unpräzise, dumme Frage. Aber: Nee, geht nich, da ist was abgebrochen, erklärt einen ja wohl schon von vorne herein für unwertes Leben. Er darf das, ich nicht? Ich, zu ihm, giftiger Pinscher: Ja, was denn abgebrochen?, ne Platte oder was? Er: Ja, ne Platte. Die musste ranschweißen. Das darfste aber nicht, weil du den Rahmen, ich sach mal, instabil machst. Und wenn, biste mindestens bei 100 Euro. – : Verbrechen, Geld, Gefahr! Staatsmacht, Illegalität, Untergrund! Worüber reden wir?! Ich bereue, dass ich nicht einfach gesagt habe: Ich will einen Ständer.
Ich rufe C. an, beklage mich. Er: Bullshit. Die Menschheit ist zum Mond geflogen. Hier geht’s um einen Fahrradständer. Geh in die Lychenerstraße, die machen das!
Ich geh in die Lychenerstraße – den Satz mit dem Mond halte ich für alle Fälle parat, aktualisiere ihn noch durch den konkreten Fall des deutschen Astronauten der vor ein paar tagen die ISS-Raumstation betreten hat – aber vor Ort ist plötzlich alles kein Problem mehr. Korb unter meinem Hintern weg, Bremse ohne Sehnenscheidenentzündung, Ständer: Die machen das! Morgen hol ichs ab.
Dann flieg ich zum Mond.
Mai 2014 – Gulasch
Koche ein riesiges Sonntags-Gulasch mit Serviettenknödeln und Gurkensalat für A. – zum Dank für spontane Aufnahme und Herberge in der Not.
Interessant beim Gulasch, es muss köcheln und köcheln – drei Stunden ehrlich gesagt – simmern, wies bei den Österreichern so schön heißt, und dann, wenn man schon blöd drin rumstochert und es rausholt und probiert und es immer noch zäh ist wie Schuhsohle, und man schon denkt, scheiße, was mach ich, das wird nix mehr, dann gibt das Fleisch auf.
Es zerfällt.
Das mag ich am liebsten, wenn die Fasern schon so abgehen, sich mit der Soße verbinden.
Die Soße finde ich diesmal zu dünn. Woran liegt das, chefkoch-Frage. Ich gucke in den Foren. Mehl, Kartoffel reinreiben, wird vorgeschlagen, Aubergine. Da is scho grundsätzlich was falsch glaufe, meint einer. Ich auch. Gleich viel Zwiebeln wie Gulasch reingetan? Eigentlich ja. Ansonsten: Rotwein, Rinderfond, immer schön reduzieren lassen, Paprika, Paprikagewürz, Lorbeer, Tomatenmark – falls es jemanden interessiert. Die Soße vom Gurkensalat auch zu wässrig, aber wie das Gulasch trotzdem lecker (Dill, frisch! Schalotten klein, Zitrone, Apfelessig oder Weißweinessig, Olivenöl, Salz, Pfeffer, lange im Kühlschrank ziehen lassen!). Vielleicht gibts da auch einen Trick, in Salz einlegen, damit das Wasser rausgeht, bevor man die Soße drübergießt?
Die Serviettenknödel sind richtig gut geworden (schwierige Sache, nämlich!), das Rezept mach ich nochmal, aber das nächste Mal muss mehr Gewürz dran (Salz, Pfeffer, Muskat).
Dazu ein bisschen Wahl geguckt (Front Nationale 25 Prozent, das soll hier dokumentiert werden), und ein bisschen Tatort (A. versucht mich auch an diesem Sonntag wieder davon zu überzeugen, dass sich das Gucken lohnt). Buch: Lars Kraume, ich erinnnere mich an ihn, er war mal bei uns an der Akademie, Joachim Krol, älter geworden, alles ganz ordentlich, trotzdem gehe ich nach der Hälfte gelangweilt raus auf den Platz und setze mich auf einen Weißwein und zwei Zigaretten ins eka. Allein. Ich kann das. Das gefällt mir. Einzig der Mann neben mir stört mich, auch allein, mauere ihn weg durch meinen verschlossenen Gesichtsausdruck und Handy-Gedaddel. Dann geht er. Der Arme. Entspannung tritt ein.
Die Tage sind herrlich, die Abende auch.
Im Späti kaufe ich Eiskonfekt. Keine Schachtel begeistert mich mehr als die von Eiskonfekt (und mich begeistern viele Schachteln). A. bringe ich ein Big Sandwich mit, Fürst-Pückler-Dreiklang in Knatsch-Waffel – nice trash!
Morgen heißt es: Ciao Helmholtzplatz, ich ziehe weiter in die Greifenhagener.
Mai 2014 – Weißensee
Mache mit G. einen Spaziergang nach Weißensee. Treffpunkt Ernst-Thälmann-Denkmal.
Hier hängen ein paar DKP-Plakate rum, als hätte sie jemand für einen Historienfilm da hingehängt. Die Deko zum Denkmal.
G. war noch schnell wählen (heute ist Europa-Wahl).
Ab Kino Toni wird’s nett und man kann sich hinten rum ranschleichen. Nette Ecke, Backsteinbauten. Wenn man Kinder hätte. Bauprojekte, Verkehrsanbindung sind da so die Stichworte.
Der See mit Springbrunnen, um die rot blau gelbe Ruderboote kreisen. Like! Wir kehren ein im Strandbad (lascher Latte, prima Pommes) und machen wie immer alles durch: Arbeit und Liebe. Heute geht es schwerpunktmäßig um Genderfragen (G. interessiert sich für den Konflikt mit T.). Er sagt, es gibt Situationsbeschreiber und die anderen, die ich jetzt vergessen habe. Also die, die eine Sache angehen statt zu jammern. (Also nicht ich.)
Ich finde, dass das ja wohl tendenziell klassisch rollenverteilt ist. Frauen erzählen detailliert, wie die Situation war und wie sie sich gefühlt haben. Eine Freundin hört zu, nickt, sagt, das kann ich gut verstehen, fragt nach, hakt auch mal nach, und dann ist sie dran. Der Mann fühlt sich hingegen nach so einer feminalen Situationsbeschreibung umgehend aufgefordert, das Problem der Frau zu lösen. (was er zu einem späteren Zeitpunkt in die „was ich alles für dich tue- Waagschale“ werfen wird) Oder ihr zu sagen, wie er, wie jeder NORMALE Mensch das Problem lösen würde. Was die Frau umgehend zur Raserei bringt, weil sie sich in einer wilden Mischung unterdrückt, abhängig, bevormundet und psychologisiert fühlt. G.s Lösungsansatz für seine Männer-Freunde: Klappe halten, machen lassen. Da, sage ich, würde ich mich unbeachtet, nicht ernst genommen und einsam fühlen. Euch kann man auch nichts recht machen, meint G. Wohl war!, kann ich da nur sagen. Dilemma ohne Ausweg.
Nachtrag:
hier ehrlich gesagt zu meiner eigenen Überraschung ganz schön viele Beiträge zum Nebenwiderspruch. Hoch die Kaffeetasse.

Erne Thälmann, Tochter ihrer Klasse
Mai 2014 – Hubots
Seit ich Real Humans schaue (bin gerade bei Staffel 1 Episode 7, movie4k.to) sehe ich überall Hubots, spiele Hubot (bzz, bzz, Kopf be-we-gen, da hat dich jemand an.ge.spro.chen) oder fühle mich wie ein Hubot (Sehnsucht, ein Mensch zu sein).
Sehr schön wie sie mit diesen Diskriminierungs-Parallelen arbeiten, ähnlich wie in True Blood.Da ist alles drin, die Migranten, die Homosexuellen, die Tiere. Dürfen Hubots und Menchen heiraten? Dürfen Hubots Kinder adoptieren? Nehmen sie uns die Arbeistplätze weg? Darf ein Mensch einen Hubot liebe? Darf man ihn wegen seiner Liebe bzw. seiner sexuellen Orientierung diskrimnieren? (manche Menschen haben nämlich THS, sie sind transhumansexual, stehen auf Hubots) Was ist Liebe? Was ist ein Gefühl? Ist die Würde des Menschen die Würde der Maschine? Was ist ein Mensch, was eine Maschine, wo fängt das an, wo hört das auf? Kann ein Hubot an Gott glauben? Hat Gott die Hubots erschaffen? Und wenn ja, welche Konsequenzen hat das? Diskriminieren wir die Maschine oder diskriminiert sie uns? Kontrollieren wir die Maschine oder kontrolliert sie uns?
Das ist alles ganz großartig über die Figurenpalette gespielt und oft witzig gesetzt. Zum Beispiel Opa Lennart. Er verfügt zu seinen Lebzeiten, dass man ihn nach seinem Tod klonen lassen soll. Nun spaziert er als Hubot in der Familie herum und nervt alle. Aber darf man Opa einfach so wieder abschalten?
Auch alle Positionen, die man so einnehmen kann, werden durchdekliniert: Es gibt die Liberalen, die Konservativen und die Rechten. Man kann sie alle verstehen. (Auch die Rechten, weil sie ihre persönlichen, schlechten Erfahrungen gemacht haben. Die Hubots wurden ihnen vorgezogen – Mutterliebe, Arbeitsplatz). Während die einen für Toleranz und Hubot-Rechte eintreten, aber auch zur Mäßigung aufrufen, die Alten und Kinder vollends der Hubot-Dienstleistung zu überlassen, interessieren sich die anderen für den wirtschaftlichen Vorsprung durch Hubots und finden den Fortschritt fortschrittlich per se, während die dritten demnächst zur Endlösung in der Hubotfrage aufrufen werden.
Außerdem wird natürlich viel Missbrauch getrieben, der Hubot-Schwarzmarkt blüht – illegal umgebaute Hubots, dirty Sex-Hubots, Kampf-Hubots…
Klasse! Bzz-bzz.
Ich bin mir nur nicht sicher, wie ich diese ganze Code-Sache finden soll. Es gibt nämlich einen (unglücklichen, verlust-traumatisierten) Wissenschaftler, der einen Code entwickelt hat, der einigen wenigen, von ihm gebauten Hubots einen freien Willen a la Kant gegeben hat. Die spazieren jetzt rum, als Bande im Untergrund, wollen was und sind tendenziell gefährlich. An ihnen machen sich diese ganzen Toleranz versus Gefahr-Themen nochmal extra fest. Hier steckt der Krimi: Code-Suche, Code-Suche über Leichen, der Geheimdienst ermittelt, Braucht man das? Wahrscheinlich.
Mai 2014 – Prinzenbad
Aufreger der Woche: Prinzenbad jetzt 5 euro 50 Eintritt. Und dann ist es auch noch eins der wenigen öffentlichen Bäder, das überhaupt noch offen hat!
Ich unterschreibe schwungvoll eine Unterschriftenliste im geliebten Kiosk. Dagegen! – Und Spaßbad sind sie ja nun beileibe nicht: Auf der Toilette kein Klopapier, was man ja immer erst dann merkt, wenns schon zu spät ist, Seife sowieso nicht, und da es keine Eimer gibt, werfen die Leute ihre Tampons und Binden auf den Boden. Und das alles für diesen Schnäppchenpreis! Arm, aber arm. Fuckstadt.
Ich gehe ins Kinderbecken. Damn it! Wieso hab ich das früher nicht gemacht! Ich übe schwimmen und niemand stört mich, ist ein Haufen Platz. Herrlich! ich atme und pruste vor mich hin und komme bei entgegenkommender Gefahr jederzeit mit den Füßen auf den Boden.
Es gibt jetzt wieder Dolomiti. Hab mich mit C. zu einer gemeinsamen Erst-wieder-verköstigung verabredet, allein hat sie Angst, dass es nicht mehr so ist, wie es mal war.
T. und ich planen auf unserem Handtuch den Sommer. Man muss aufpassen, dass man sich sieht, zwischen den Terminen. ich schlage vor, mal über Grünzeug nachzudenken, damit meine ich Rausfahr-Orte, ab ins Grüne, am Wochenende. Jetzt lebe ich schon so lange hier und hab noch immer keine Lieblingsplätze, -seen, usw. Ist aber auch schwer hier, mit all dem Osten um uns rum. Kaum fährt man raus, ist man schon deprimiert. Es hängen Naziplakate rum oder die Dörfer sind ausgestorben oder die Kneipen wissen nicht, wie man gutes Essen serviert. Wer aus Süddeutschland ist, leidet da. Das geht alles besser.
Mai 2014 – Helmholtzplatz
Der Helmholtzplatz nervt. Was machen die hier eigentlich alle für ein Theater? Die Eltern finden sich toll, die Kinder finden sich toll, alle zusammen finden sie ihren Helmi super. Es ist ein Graus aus Bullerbü entsprungen.
Man kann sich nicht sicher sein, was da heran wächst. Entweder diese muttermilchsatten, biogefütterten blonden Properkinder retten mit ihren rücksichtslosen Entfaltungspotentialen die Welt oder sie werden die neuen Nazis. Das ist noch nicht raus.
Ich bin jedenfalls wahnsinnig neidisch.
Mai 2014 – Fußball
Heute ist Pokalspiel. Bayern gegen Dortmund. Alle sind völlig aus dem Häuschen. Mir ist das egal. Voll egal, voll super total egalegal. Setze mich mit A. zum Abendessen vor den Rechner, er streamt noch Barcelona gegen Atletico. Ich höre und sehe immer nur Männer und Bier, Männer und Bier, Männer und Bier, Banane, (okay, das ist witzig), Männer und Bier.
Oje, das wird was, diesen Sommer.
Malaga im Mai – Back to B -2
Blut im Stuhl.
Fieser Keim aus Malaga.
Zwieback und Kamillentee. Buscopan.
Sterilium und Sagrotan.
Aber mein Blog gedeiht.
Und A. kocht Suppe.
– ein Gedicht.
Malaga im Mai – Back to B -1
T. hat mir nicht angeboten, für 14 Tage bei ihm zu wohnen. Nicht, dass ich das gemacht hätte. T. hat mir nicht angeboten in der ersten Nacht bei ihm zu übernachten, was ich gerne gemacht hätte. (Ich kann morgen früh erst zu A.)
Gehe zu C.
Flughafen Schönefeld fuck you. Airport Express eine einzige Farce. S9, Ostbahnhof umsteigen. Ein Ekelkerl fragt, ob wir uns das Taxi teilen. Taxi zu Fuck you. Fuck you
Bei C. erwarten mich eine weiche, verschlafene Umarmung und Kuschelkissen mit Handtuchstapel.
Malaga im Mai – vorbei
Ciao Malaga.
I loved you. You didnt love me back.
Malaga im Mai – pics
Malaga im Mai – diarrea
Hola, buenos. Necesito un medicamento contra la diarrea, por favor.
Na, super, das jetzt auch noch. Den ganzen Tag ist mir schlecht, elend, schwach und auch ein bisschen blöd im Hirn und ich muss ständig in der Nähe einer Toilette sein. Das mach ich im Cafe, im Museo Picasso (Kategorie: schönlangweilig, ein Video von ihm ist toll, da malt er auf eine Scheibe und guckt dabei zu einem durch), am Hafen und bis ganz superknapp kurz vor 12 Checkout-time im Hotel.
Malaga im Mai – safe
I am never allowed to feel safe. anywhere. with anyone.
Malaga im Mai – Zoff
Zoff mit T. am Telefon. Irgendwie passt ihm nicht, dass ich abbreche. Als ob mir das passen würde!
Sagt keywords wie: Irgendwann muss ich mich auch schützen. (???) Hab schon Pläne am WE. (???) Erst sagst du, ich darf nur drei Tage kommen (stimmt, wollte mein Schreibabenteuer alleine durchziehen, das war Teil des Plans, so what?) Dann meckerst du, dass ich schon gehen muss. (Meckern? Ich hab gesagt, dass ich es schön fände, wenn wir jetzt noch mehr Zeit miteinander hätten. Sagt man das nicht so, wenn man nett sein will?) Ein Haufen Stress und Geld, um nach Malaga zu kommen. (Geb ich zu. Entschuldige mich nochmals dafür, dass er mit drin hängt, im Schlamassel. Dass es auch für ihn anders ist als geplant. Andererseits hatten wir ein bezauberndes Wochenende und ich hab das Hotel vorgeschlagen, damit wir nicht nur bei seiner Mutter sind.)
Dann Entschuldigungs-sms. T. simst mit seinem neuen (alten) Handy. Folgender Wortlaut:
E7 war richtig toll mit dir!orry. Komplet.
Kommunikation ist keine leichte Sache.
Malaga im Mai – Orga
Werde bei A. im zweiten Zimmer wohnen können! – In meine Wohnung kann ich nicht, die ist vermietet.
Malaga im Mai – Farton
Neulich erzählt mir D., dass J. und S. (Frauen) immer sofort heulen, wenn’s Probleme gibt oder was nicht klappt. Ich versteh das nicht. Ich heule nicht. Vielleicht weil ich dann zu viel zu tun hätte.
Seit ich hier bin, stehe ich immer wieder mal vor dieser einen Panaderia. Sie haben ein verführerisch ausgeleuchtetes Schaufenster in der Calle Nueva mit lauter braun-goldglänzenden Leckersachen drin. Unter anderem auch Fartons. Das sind so längliche breite Stücke dünnen, leichten Teigs, mit Puderzucker bestreut. Kenn ich nicht, sieht super aus. 5 Stück gibts für einen Euro. Jedes Mal wenn ich dort stehe, will ich eins essen. Jedes Mal ist aber was anderes: Ich gerade satt, gerade eher Hunger auf Salat, ich gerade auf dem Weg zur Tostada, ich und T. gerade auf dem Weg zum Flughafen, ich keine 5 auf einmal.
Heute gehe ich rein. Nach all dem Schlamassel. Beschließe zu bleiben, weil sie einen con leche mit 2 Fartons als oferta für 1,60Euro auf der Karte haben. Perfekt. Die Bedienung geht rüber, um das Farton zu holen, der con leche steht schon auf dem Tablett. Sie kommt zurück und sagt, die Fartons sind aus.
Als ich sitze und in die Magdalena beiße, die ich stattdessen bekommen habe, kommen mir die Tränen.
Malaga im Mai – kämpfen
Komisch, dass ich immer so kämpfen muss.
Sie sind eben einfach ne Kämpferin, hat meine letzte Therapeutin gesagt. Beim letzten Mal als wir uns gesehen haben, nachdem sie mich in der Woche zuvor rausgeschmissen hatte und ich ihr danach aber nochmal die DAK-Karte vorbeibringen musste, weil sie vergessen hatte, sie für den neuen Monat einzulesen. So mit betontem Schwung hat sie das gesagt.
In dem Moment hätte ich sie gerne gehauen.
Malaga im Mai – Hotel 2
Der handsome guy (laut Timo) hinterm Tresen im Itaca Hotel auf der Fajardo begrüßt mich wie eine alte Bekannte. Er will mir unbedingt bis 10 Uhr ein Zimmer zugewiesen haben. Wahrscheinlich sehe ich müde und traurig aus. Bin ich auch. Schon wieder eine Nacht ohne Schlaf, schon wieder ein Tag ohne Arbeit. Ohne Ruhe, ohne Ankommen. Schon wieder suchen, schon wieder überlegen, schon wieder alle Möglichkeiten in Betracht ziehen, die wenn-dann Geldsummen im Kopf hin und her wälzen und und sich mit airbnb und dem Vermieter auseinandersetzen, der ist von der Sorte ganz schlau. Tut als hätte er die Mails nicht bekommen (hat er aber) und als sei er jetzt gerade zufällig mit einer Antenne im Apartment eingetroffen, die er jetzt gerade gekauft hat (klar, um 8 Uhr morgens, fuck you). Ich bleibe einfach hier mit meinem Rechner sitzen und warte was passiert, während das, was ich eigentlich wollte, nicht passiert.
Malaga im Mai – Kopfchaos
Kann ich mir vorstellen die nächsten 16 Tage hier in diesem Raum zu verbringen? Kann ich hier arbeiten, endlich arbeiten? Ohne Internet? Nein. – I need WIFI! Ich gucke jede halbe Stunde nach Mails. Was ist, wenn die von der Prod.firma sich melden, was ist mit Kontakt zu meinen Freunden, was ist mit Blog!!!, was mit Hörspiel, mit dem eigentlichen Projekt, weswegen ich hergekommen bin!, das ich verdammt nochmal nach zwei Wochen noch nicht mal angefangen habe!, weil ich nie nie nie mal zur Ruhe komme! weil ich Kakerlaken hinter her renne, Augenentzündungen, meinem Geld, dem nächsten Apartment, der nächsten Auffangstation und das alles obwohl ich schon so viel Geld ausgegeben habe!
Andauernd brauch ich Wifi, was ist mit Wiki, was ist mit noch ne Serie schauen, zum Einschlafen. Ich kann sehr gut allein sein, aber nur mit Internet.
Alle Apartments, die was taugen sind längst weg. Waren schon weg als mein super günstiges Lieblingsapartment wegen Großbaustelle 10 Tage vor Abreise nicht mehr in Frage kam. Waren schon weg, als ich das mit den Kakerlaken gesucht habe, als ich das hier gesucht habe.
Wenn ich doppelt so viel ausgeben könnte wie geplant, dann würd ich jetzt noch eins finden. Ich hab aber kein Geld mehr. Hab ja jetzt schon mehr ausgegeben. Bei jedem neuen Apartment mehr Geld. Und Mai kein Einkommen und Juni auch erst am Ende, wenns gut läuft. Und Steuer kommt. Schätze 2000. Und was, wenn ich das Geld vom Scheißvermieter hier nicht zurück kriege? Storno-policy: streng. Besser nicht mehr lange zögern und innerhalb der ersten 24 Stunden nach Check-In raus hier? Sonst gleicher Fehler wie bei dem raoches-Apartment, alle reden tagelang rum, ich muss mich immer weiter damit beschäftigen und am Ende noch mehr Geld verloren.
Ich könnte zu R. nach Madrid. Kostet jeweils einen Tag Zeit. Wieder neue Umgebung, keine Konzentration. R. sweet, aber T.s Freund. Und: war doch alles nicht die Idee!! Danach weniger Tage hier – also billiger? Pustekuchen. 600 Euro nochmal mindestens, eher 900. Flug umbuchen, geht das?
Schadensbegrenzung.
Lets go home.
Malaga im Mai – Traum
Habe nachts einen Alptraum. meine Wohnungstür geht auf und drei Indianer, die nebenan wohnen, strangulieren einen Mann mit einem Kabel. (wahrscheinlich mein Vermieter). Als nächstes bin ich dran, sie sind schon in meiner Wohnung. Ich versuche, die Feuerwehr anzurufen, 112, aber ich krieg keine Verbindung, hatte mich extra erkundigt, ob das in Spanien auch 112 ist, tippe wie wild auf dem Handy rum.
Is ja alles sehr durchschaubar. Nur die Indianer wundern mich, wo kommen die denn her aus welchem rassistischen Kindheitsgrund?
Malaga im Mai – Olé
Im spanischen Fernsehen läuft Stierkampf. Das beste was ich hier bisher im TV gesehen habe, sonst nur Scheiß-Filme oder Verkaufsfernsehen.
Ein Torrero hat ein Auge weniger, da hat der Stier seinen Tribut gezollt. Er ist schon ganz schön alt, muss ich sagen. Also etwa so alt wie ich. Die machen das hier so, dass die berühmten Kämpfer den Kampf aus dem Off kommentieren, so wie bei uns so alte Hasen beim Fußball. Das gibt der Sache sowas Sportives. Statt Kulturelles. Die Ränge sind voll mit Stars und Sternchen.
Ein Stier will nicht so recht. Der wird von einem dieser Typen mit rosa Tuch aufwändig gereizt, die Arbeitsteilung ist mir ja nicht so ganz klar, die mit den Pferden sind jedenfalls die Gelackmeierten, scheints, sie werden immer ganz schön zerquetscht. Inklusive der Pferde natürlich. Aber der Stier ist fix und fertig, da tut sich nichts mehr, der ist schon längst mit seinem Sterben beschäftigt. Auch das ganze Rufen des Torrero nützt nix. Der lässt sich nicht mehr provozieren. Beeindruckend immer wieder, wie alert die Kämpfer alle sind, alle reißen die Augen auf, jede Sekunde kann man sterben, das Tier ist unberechenbar.
Tatsächlich greift der Stier doch nochmal an, als der Torrero lange genug Augen in Auge mit ihm verhandelt hat. Der Torrero wird frecher. Dreht dem Stier den Rücken zu, kommunziert mit ihm. (Was er da wohl so sagt?) Wie dem Stier hängt auch ihm was aus den Nüstern. Tolle Tänzerfguren ham sie, die Jungs. Ihre Penisse hängen immer so an der Seite im Hosenbein runter, ich finde das etwas irritierend, nicht im positiven Sinne. Die Tribüne ist voll. Huch, jetzt wacht der Stier doch nochmal auf . Ein letztes Tänzchen, bevor der Torrero ihm den Todesstoß versetzt. Flüssig und präzise, so ist das. Plötzlich ist man nur noch Fleisch. Der Stier fällt zu Boden. Aus, vorbei. Jetzt kommt er zum Metzger.
Einer mit rosa Tuch stolpert über sein Tuch. Shit. das ist bestimmt peinlich. Dabei ist der ganz süß, so ein kleiner Spanier (zu klein fürs große Tuch.) Außerdem gefährlich, der Kollege muss schnell rosa dazwischen wedeln. Der Torrero wird am Arenarand interviewt. Auch wie beim Fußball.
Danach ein Torrero, der einen tollen Tanz mit einem wütenden Stier aufführt, ihn dann am Ende aber 10mal stechen muss, bis er den richtigen Punkt trifft. Stümperhaft, findet das auch das Publikum. Doch er geht, erhobenen Hauptes und gestreckten Hinterns, das Publikum respektiert das, er hat sein Leben riskiert.
Malaga im Mai – Runde 2
Heute T. zum Flughafen gebracht. Danach mein neues Apartment bezogen. Auf den ersten Blick schon mal recht Kakerlakenfrei: 2. Etage, ganz neues Gebäude, in Soho Malaga, das wird hier so ein bisschen als cooles Künstlerviertel hochgejazzt, ein bisschen Rotlicht, ein bisschen Finanzen, ein bisschen Leerstand, ein paar Art Graffitis – die werden dann aber auch gleich vom Ayuntamiento promotet, die glücklichen Art Graffiteure. Um die Ecke vom Contemporary Art Museum. Fine with me.
Bei näherer Betrachtung aber genau das, wovor die Reviews schon vorher gewarnt haben: Ich bin mir nicht sicher, ob die sheets jemand gewaschen hat, der Boden und alle Oberflächen sind staubig – niemand hat gewischt. Fürs Sofabett hat keiner den Vakuum Cleaner angeworfen. The worst: wifi doesnt work. Und zwar not at all!
Ich also wieder los, kämpfen. Bei fnac frage ich auf Spanisch! (stolz) nach einem Pen (Mobilstick). Kostet 69 Euro. Olé!
Bei Orange frage ich – auf Spanisch! (läuft immer besser) – nach einem Vertrag. geht nur für 12 Monate, alles viel zu teuer.
Zurück im Apartment entdecke ich, dass ein Wlan einigermaßen zwei Balken anzeigt (es ist nicht das aus dem Apartment!). Und zwar von einem Hostel. Ich gehe durch die Straßen und suche das Hostel. Finde ich das Hostel. Kommt ein Ami raus, frag ich ihn, wie das Wlan-Password ist, pretending to look something up on my mobile and belonging here. Er gibt mir das Passwort. Mann, bin ich clever.
Zuhause Frust. Funktioniert einfach zu schwach. Ich denke darüber nach, morgen nach einem Verstärker zu fragen, der kostet wahrscheinlich so 20 Euro. Bin aber misstrauisch, dass das funktioniert. Hatte ich schon mal irgendwo, war fürn Arsch.
Mein Vermieter antwortet in seiner verknappten Art (book it, hat er geschrieben. zu Befehl, du Arsch. noch so ein Gender-Ding: Bloß nicht zu viel Worte verlieren, als würde einen das schwach machen), dass ich die Metalltür aufmachen soll, die vor der Wohnungstür nochmal so einen kleinen Flurbereich abschließt. Mach ich. Nützt kein Mü was. Fuck you.
Fuck you überhaupt alle so langsam. Der Typ macht Geld mit überteuerten Apartments und falschen Angaben all over the city. Schickt hier irgendein unterbezahltes Mädchen her, um die Tür aufzumachen, macht einen auf Edel-Großvermieter, kriegt aber noch nicht mal das Putzen auf die Reihe, geschweige denn, dass das Wifi funktioniert.
Ich bin müde, abgegessen und will eigentlich nur noch nach Hause.
Was soll ich denn heute Abend machen, ohne Verbindung zu Welt, Mails, Blog, Whatsapp, Stream usw. Ich kann gut allein sein, aber nur mit Internet. Ohne fühl ich mich einsam und unfrei. Und wie soll das die nächsten 14 tage gehen? Ich wollte doch meine Memoiren schreiben, das Hörspiel, das geht nicht ohne Wikipedia. Ich bin doch hierher gekommen, um zu arbeiten und nicht um die ganze Zeit sinnlose Herausforderungen zu bestehen! Die dazu noch einen Haufen Geld kosten. Aber de facto tu ich das seit 14 Tagen.
Erstmal mache ich weiter:
Ich kaufe Waschpulver, und wasche sheets, Handtücher und Küchentücher.
Ich kaufe Avocado, Tomate, Burgoskäse bei Supersol, damit ich mir Salat machen kann, und werfe alles weg, was in der Küche noch offen rumsteht. Ich putze den Kühlschrank, der dreckig ist und in dem ein paar Ameisen aufgeregt herumlaufen. Er ist ausgeschaltet.
Nochmal in mein Cafe, sie haben Wlan. Das mit den Cupcakes auf der Alameda hat auch Wlan. Toll, jetzt muss ich zehnmal pro Tag Kaffee trinken oder wie?
Bin um 9 Uhr zuhause. Gut, arbeite ich halt. Tippe vor und zurück im Hörspiel herum. Kann mich nicht konzentrieren. Fühl mich nicht wohl hier. Mir fällt nicht ein, wie die Geschichte weiter gehen soll. das ist alles Blödsinn, was da steht. Ich ändere vorne was, damit es hinten besser wird. Wird es aber nicht. Ich langweile mich. Sehe mich um. Kann ja noch nicht mal Musik hören ohne Internet. Inspiziere nochmal das Bett. Sorry, aber so gehts nicht. Ich werde mich hier nicht wohlfühlen können über so einen langen Zeitraum.
Zum Einschlafen schau ich Castle auf Spanisch.
Malaga im Mai – Rumlaufen 7

Wasser im Fluss!
Malaga im Mai – Rumlaufen 6

Mähen im Fluss
Malaga im Mai – Rumlaufen 5

Baggern im Fluss
Malaga im Mai – Mojito
der hässliche Deutsche. Ruhrgebietstyp, der uns langatmig den besten Spezial-Mojito ever verspricht. wahrscheinlich Ex-Hells Angel oder zumindest Motorradfahrer, sitzt da, vor seiner eigenen Ex-pat-Kneipe, mit seiner Frau und einer Bekannten, die vom Nachbartisch her rübernervt. Laut spricht. Irgendeine im Grunde Fickgeschichte übers Internet erzählt, seit vier jahren hier ist und auch sonst jede Menge Infos preisgibt, die man garantiert nicht wissen will. Der Deutsche lästert über einen spanischen Angestellten. Er mag Küchenmaschinen, die Minze häckselt er ganz klein und vermischt sie mit Eis und Limetten zu einer Art Granita. Serviert in einem runden Glas mit dickem Stil, ich finds bescheuert. Die Minze hängt noch garantierter in den Zahnzwischenräumen als sonst.
Im Innenraum läuft RTL. Ich fange an, Birgit Schrowange hüsch zu finden. T. trinkt tapfer seinen von der Nebentisch-Bekannten lauthals gelobten Weißwein, man kommt von fern und nah, um sogar ganze Kisten zu kaufen – wie sind wir hier bloß reingeraten. Ah, das hotel ist direkt gegenüber.
Dort zurück hört man sie immer noch alle haarklein reden. Wenn ich hier wohnen würde, hätte ich ihn wahrscheinlich schon umgebracht. Ihn in der Küchenmaschine zerhäckselt, minzklein, er ist ziemlich dick, das lohnt sich. Aber er hat bestimmt Geldsorgen. Überhaupt tut er mir leid, mit den beiden Frauen da unten und ausgeliefert, uns, dem nur mühsam die Verachtung überlächelnden Paar, was hinstellen zu müssen.
Malaga im Mai – Hotel
duschen im hotel. das beste. alle pröbchen über mir ausgeleert.
auf die laken legen noch besser. ich bin schon wieder hundemüde.
aber sex ist noch drin. wie hier überhaupt sex leicht von der hand geht.
Malaga im Mai – Calahonda Ronald

Malaga im Mai – Calahonda Kröte

Plattkröte. Schon fast Leder. handtasche
Malaga im Mai – Calahonda Alkohol
T. macht sich lustig, weil seine Freundin sich mittags um 1 schon einen Weißwein „reinhilft“, wie er sich ausdrückt, und am Abend tinto de verano. Bisschen sexistisch, finde ich das. Der ist bloß neidisch. Abstinenzler sind Alkoholiker.
Trotzdem, mein Alkoholkonsum ist definitiv gestiegen seit wir mal mit B., N. und C. einen Test gemacht haben, und ein paar Wochen lang aufgeschrieben haben, wer wie viel trinkt. Da hab ich noch gewonnen, mit Abstand, haushoch. Oder verloren, ganz klar war das nicht. Das wäre heute nicht mehr so.
Malaga im Mai – Calahonda cas

Malaga im Mai – Calahonda beach



Malaga im Mai – Calahonda style

Weg zum Einkaufszentrum

Einkaufszentrum (con leche 1,70 echauffiert sich E., sonst 1,20)

Weg zurück

Malaga im Mai – Calahonda Meer

Meer

Apartments

Strandsalat
Malaga im Mai – Calahonda
Ruhe kehrt ein. Entspanntes Schlafen. Balkon mit Meeresrauschen. Ab und an auf eine Zigarette mit E. Ab und an auf einen con leche über die Autopista. Lidl. Supersol. Lavanderia. Engländer rot-weiß. Keine Ahnung, warum ich bei denen immer an Pornos denken muss. Thanks, love, Yes, darling, so reden sie vor allem gerne die Bedienung an. Vielleicht deswegen.
I adapt, hab schon Sonnenbrand.
Das Hörspiel gedeiht. Na endlich. Morgen kommt T.
Malaga im Mai – libreria
in der großen libreria luce auf der Alameda suche ich ein Buch für E., als Mitbringsel, wenn sie mich schon rettet in der Not. mir fällt ein, dass ich was in der SZ überflogen hab (hirn leider sieb), da ging es um ein spanisches buch, neu, aber irgendwie auch von Carlos Saura verfilmt, über ein paar junge Menschen während der Franco-Ära.
ich also zur Informacion, die schwangerbäuchige, sich selbst streichelnde Verkäuferin gefragt: Busco un libro sobre jovenes en la epoca franco. Carlos Saura made a film out of it. Sie überlegt. Sie sucht nach Sauras Filmtiteln. En älterer Mann kommt dazu. Auch er überlegt. Aber über jUgendliche… hat der saura nix gemacht… voll nett von denen.
Dann fällt mir ein, dass ein anderer Mann, der vorher an der informacion was recht forsch gefragt hat, ein dickes Buch aus einem Pappständer mitgenommen hat. Das schau ich mir an. ich verstehe, dass es um ein neues Buch einer ganzen Chronik geht, so a la Reitz, Menschen über die Jahre in ihrer Geschichte. Von einer dieser patent spanisch aussehenden Frauen. Ich schau sie mir an, auf dem Buchrücken. Es geht um die Kriegsjahre. Sieht gut aus. Vor allem das Foto vorne drauf, eine junge Frau. an einer Mauer. Läuft, hinter ihr irgendwo Jungs. Aber interessanterweise kann ich nicht einschätzen, ob es jetzt links oder rechts ist. Das liegt ein bisschen an dem älteren Mann, den ich für rechts halte. Den anderen Mann, der über Saura reden will, halte ich für links. Keine Ahnung, woran man das hier erkennt. Aber ich stelle mir vor, dass es in Spanien eher so ist wie in den USA oder GB, man ist entweder konservativ (bis frankistisch) oder sozialdemokratisch (bis kommunistisch). ich kaufe das Buch. Später stellt sich heraus, es ist von einer Frau geschrieben, die hier alle kennen, weil sie regelmäßig im El Pais schreibt und auch sonst den Mund aufmacht. also links und ein Volltreffer.
T. meint übrigens, dass man es nicht so leicht erkennt. Also eher so wie bei uns. An den Zeitungen ein bisschen. El mundo ist eher FAZ, El Pais eher die Süddeutsche. ABC ist tendenziell rechts. Andalucia ist traditionell eher sozialdemokratisch (aber das ist München ja auch).
Malaga im Mai – way out
auf dem Weg nach Fuengirola:

Könnte jetzt auch Bretten oder Kleindeinbach sein. Die Haltestelle der Jugend.
Malaga im Mai – Ärger haben
Ärger haben ist wie über Steuer reden, es gehört den Erwachsenen.
Hierzu ein Banner:

Malaga im Mai – The Others
Ich im Hotelzimmer, gerade die Jogginghose angezogen. Plötzlich geht die Tür auf. Ein Zimmermädchen kommt rein, erblickt mich, schreit laut auf, schreit lange, laut, schreit noch als die erste Schrecksekunde vorbei ist, ich denke schon, findet sie den Knopf nicht? Sie entschuldigt sich auf Spanisch, klein und dick, sagt irgendwas wegen der Minibar, in die sie dann noch reinguckt bevor sie verschwindet. Sie muss gedacht haben, ich bin ein Geist.
Als ich mich ins Bett lege, frage ich mich, ob das vielleicht stimmt. Ich sehe so aus, tendenziell ja immer, aber im Moment noch mehr, weil die Augen noch schlimmer als sonst. Vielleicht ist es das?: Wie bei The Others bin ich längst tot und will es einfach nicht kapieren. Deshalb klappt auch alles nicht.
Malaga im Mai – Hotel 2
Um 8 Uhr bin ich da, kann natürlich erst um 12 ins Zimmer. Ich bin so müde und meine Augen tun weh.
Geh ich nochmal in die biblioteca. Calle Ollerias 34. Kriege den schönsten Platz am Fenster für Frühaufsteher und Zuerstdaseier. Ein Typ setzt sich mir gegenüber, Bart, unkompliziert, schon bisschen älter als die ganz jungen. Ich merke, er ist neugierig, weil ich anders tippe als die anderen, kein Buch und nix dabei habe, but I play cool und würdige ihn keines Blickes. (Hörspiel geht eher lahm voran).
Gestern mir gegenüber ein Mädchen, bzw. ihre beiden Brüste. Die von mir aus linke deutlich größer als die andere. Tischplaner…
Ich sinke in einen kühlen, kakerlosen Schlaf. Ohnein, nicht in der Bibliothek! Im Hotel.
Malaga im Mai – Hotel 1
Jetzt hatte ich gerade angefangen, diese kleinen Routinen zu entwickeln. Mein Cafe, meine Straße, meine Marktfrau. Ich wollte doch, dass der Kioskmann sagt, die kommt jeden Tag und kauft diese revista aleman (Süddeutsche), kostet 3 euro, steht ganz unten! Aber als ich den Schlüssel in der Wohnung auf den Tisch lege, und die Tür hinter mir zuziehe, bin ich trotzdem total erleichtert.
Und jetzt? Hotel. Eurostars Astoria, 54 Euro, schräg gegenüber vom Corte Ingles.
Malaga im Mai – i’m done
Die ganze Nacht nicht geschlafen. Die roaches halten mich auf Trab. Licht aus, ich nicke weg, über die Furcht drüber weg, da könnte was sein, was zappelt, auf dem Rücken, wie die neulich, oder seine Fühler bewegt, sich vortastet zum nächsten Dreck, von dem es die nächsten hundert Jahre existieren kann, eventuell auch auf meiner Bettdecke, und zack schrecke ich wieder hoch, because of actual noise, Licht an. So geht das Ballett. Licht aus, einnicken, noises, Licht an. Diesmal witscht eine direkt über mir an der Decke in die schattige Deckenlampe zurück! – Thats it. I’m done. Keine Einzelfälle, keine aus dem Gulli zufällig hier reingeratenen Extra-Dick-Roaches – this place is infested. Mir wird klar, so lange ich hier bin, werde ich mich nach denen umsehen, umhören, wo ich doch gar nicht vorhatte, mich mit denen zu beschäftigen. Sondern mit was ganz anderem! Morgen ziehe ich aus und jetzt erstmal um aufs Sofa, alle Lichter an, schalte Musik an, Laut und Luise bei soundcloud, Trostmusik, Trostinternet!, und suche mir ein Hotel.
Malaga im Mai – Rumlaufen 4

Spaziergänger im Fluss.
Malaga im Mai – Rumlaufen 3

Bewässerung im Fluss.
Malaga im Mai – note 5
Meer und Dreck. Hitze
Malaga im Mai – note 4
Wenn man Barcelona und Madrid kennt – verblüffend wenig szenig hier. Mal ein Secondhand-Laden, aber dann winzig, mal ein Comicladen, aber dann eher commercial, mal ein Plattenladen, aber eher so Flamenco. Die Cafes auch meist klassisch. Ich kapiers nicht so ganz, weil, wie München isses jetzt auch nicht.
Malaga im Mai – note 3
Die Schiffe so hoch wie die Häuser.
Malaga im Mai – note 2
In Malaga stinkts ziemlich oft nach Pisse. Ich verdächtige die Männer des nachts.
Malaga im Mai – note 1
Kurz vor dem Centro Medico eine Frau im Rollstuhl mit gebrochenem Bein und ihrer kleinen Tochter auf dem Schoß, auch ein gebrochenes Bein! Also manchmal kommts dicke.
Malaga im Mai – Café
Das Mädchen in meinen Café ist so süß und immer da!
Ich mag, dass sie ihren Hintern immer in so enge Jeans stopft, dass die hinten unten so eine Kneiffalte ergeben. Dazu trägt sie hässliche Stoffschuhe in schwarz und so ein grauenvolles, orangenes CI-Poloshirt, gut, dafür kann sie nix, da ist das Café dran schuld. Ich mag Frauen, die sich scheiße anziehen. Nicht so wie die Mitte-Frauen, die immer genau wissen, welchen Hosenschnitt man zu welchem Shirt anzieht. Obwohl, die mag ich auch.
Ich glaube, alle sind verknallt in sie. Aber nicht so hypersexuell, eher so wie ich.
Malaga im Mai – Ampelmännchen
So läuft das hier:
hier sollte jetzt ein Video laufen, aber dazu muss ich erst updaten.
Malaga im Mai – Augensiff
Also meine Augen… – Katastrophe: Zugeschwollen, rot, und was da rausläuft – disgusting.
J. empfiehlt mir per Mail eine Sonnenbrille zu tragen. Mach ich.
Malaga im Mai – tostada
Habs geschafft, endlich mal das zu bestellen, was immer alle an den Nachbartischen hatten: una tostada con tomate y aceite de oliva. muy rico!

angebissenes Stilleben
Malaga im Mai – Hospital Civil
Im Centro Medico schicken sie mich wieder weg. Ich muss ins Hospital Civil, in die Urgencias. Das hatte die Apothekerin schon gesagt. Na gut. Nachmittags dann also zweiter Anlauf.
Ein netter Mann hinterm Tresen gibt mir gleich das deutsche Formular zum Ausfüllen. Er freut sich, dass ich mich freue. A la derecha y al fondo muss ich – und renne direkt in das Ende der Warteschlange. Lustig, wie die hier meinen Namen ausrufen. Mein Vorname geht, den mögen sie, hat man den Eindruck, aber meinen Nachnamen versteht kein Mensch. Zu eckig-deutsch. Ich werde nochmal neu eingeteilt, erneut muss ich a la derecha y al fondo. Personal ziemlich nett. Und ziemlich viel. Muss an Almodovars Krankenpfleger denken in einem seiner besten Filme, mit dem Mädchen im Koma, wie hieß der noch? Loved that guy. So ein dick-schwuler. Die mag ich eh am liebsten.
In einer Ecke steht ein Mann und weint. Ich erschrecke, müsste da nicht mal jemand? Er hat die Schuhe ausgezogen und schluchzt. Und jammert, ich verstehe. Alle anderen waren schneller, haben ihn schon unter der Rubrik crazy guy abgespeichert, sind ja auch schon länger da. Das zieht sich dann durch, mit dem, während meiner Wartezeit. Er geht den Security-Typen ziemlich auf die Eier, spaziert auf Socken durch den Gang, redet die ganze Zeit, bleibt nicht sitzen, so wie man ihm sagt. Schade, dass ich nix verstehe, es scheint teilweise ganz lustig zu sein, die Leute lachen manchmal. Ein junges Mädchen, vielleicht 15, 16, rennt immer an die offene Tür des Wartezimmers, um zu gucken, was er jetzt wieder so treibt aufm Gang. Ihre Mutter versucht am Anfang noch, ihr Manieren beizubringen, aber schließlich gibts keinen Fernseher.

Der Oftalmologio, der mich untersucht, ist ungefähr 20 Jahre jünger als ich und hat in seinem Leben schon mehr geleistet als ich jemals. Meine Bewunderung für diesen Alltag ist grenzenlos. Er fragt, ob ich Englisch spreche, er will üben. Überall auf der Welt das gleiche. Sure, sage ich, I have to practise, too.
Ich hab ne -itis, das war klar, des Augenlids. (Blephamitis) Ich finde er guckt nicht so ganz richtig und er desinfiziert sich nicht die Hände nach der Untersuchung. (Also vorher wahrscheinlich auch nicht, ich hab Angst vor Herpes). Er verschreibt mir drei Sachen: pomada fürs Augenlid, Tropfen für rein damit, und so kleine towels, mit denen man die Augen sauber machen soll. Die Tropfen soll ich zwei Monate lang nehmen. Ein Antibiotikum, zwei Monate? Ich bin misstrauisch. Aber er betont das. Ich bekomme so ein graues Altpapier, das die anderen draußen auch hatten, mit der presciption drauf, endlich gehöre ich dazu.
Apotheke 20 Euro.
Malaga im Mai – Rumlaufen 2

Wiese im Fluss.
Malaga im Mai – fresas

doscientoscinquenta grammos des fresas, por favor.
Beautiful!,no? Und ähnlich wie manchmal bei BHs ist der Inhalt auch noch so lecker verpackt! Verstehe das total mit der edible underwear, würde dieses schöne dicke Papier, das unten mit einem so kunstvollen wie routinierten Griff von MEINER Marktfrau zusammengefaltet wird, am liebsten mitessen. Insgesamt begeistert mich hier meine Ernährung. Ich glaube nicht, dass ich schon jemals zuvor so gesund gelebt habe. Gurken, Tomaten, Erdbeeren, Joghurt, Manchego-Käse, bisschen WeißBrot, Oliven, Meersalz, Olivenöl, Artischocken – come on! besser gehts ja wohl nicht. Paar Cerealien vielleicht noch, gehen Cornflakes als Cerealien durch?
Malaga im Mai – Guter Sonntag
Malaga im Mai – Schlechter Sonntag
Miese Nacht. Ich wache auf, höre Kakerlake in der Küche. Ernsthaft! Weiß jetzt, warum die auch Schaben heißen. Trau mich nicht nicht in die Küche. Kann nicht mehr einschlafen. (4 Uhr). jedesmal wenn ich einnicke, weckt mich meine Angst vor dem Ding wieder auf. Schließe Tür zu meinem Schlafzimmer, lächerlich, kommt erstens durch, zweitens, was, wenn die auch hier drin? Höre auf weitere Sounds.
Heute morgen nach dem Frühstück sehe ich sie. Genauso fett wie die letzte, diesmal hinter der Eingangstür, ebenfalls halb hinüber, schätze wegen Cucal. Ich spraye sie mit Raid voll, verlasse das Haus. Wunderschöner, warmer Tag! Ich spaziere aufs Castel de Gibralfaro. Wahnsinns-Spaziergang, wahnsinns Blick. (siehe Beitrag oben, pics) Danach noch der Hafen. Toll. Cafe con leche. Lecker. Vergesse leider nicht die Kakerlake, sitzt in meinem Kopf fest. Außerdem Problem Nummer zwei noch immer: Meine Augen sehen zombiemäßig aus. Aber heute ist Sonntag, ich gehe lieber morgen ins Hospital Civil. Wird bestimmt voll die Aktion mit Warten und so. Die ganze Zeit meine Sonnenbrille auf.
Meine Vermieter nett wegen der Cucarachas, aber ich überlege trotzdem, ob? und wenn ja wie? ich hier weg kann. Belastung zu groß, idiotisch, but Fakt. Jetzt schon Angst vor heute Nacht. Immer alarmiertes Umschauen wenn ich auf dem Sofa sitze, die Tür öffne usw. What to do? Stil hier übrigens aus Kurzgeschichte geklaut, die ich gerade lese: Buch: 10.Dezember, Geschichte: Die Semplica-Girl-Tagebücher, Autor: George Saunders, Ami.
Gestern ST umgeschrieben. Hoppla. Gut!
Malaga im Mai – Rumlaufen 2
Malaga im Mai – Strand am Abend
Malaga im Mai – Arbeitsplatz

Malaga im Mai – cucarachas
Nach einer ersten, kleinen, längst vertrockneten Kakerlake im Kleiderschrank, jetzt eine riesige in der Küche direkt neben dem Kühlschrank. Zwar schon auf dem Rücken, aber leider noch nicht ganz hinüber. Bisschen Gezappel noch. Ich lasse sie liegen und bete, dass sie nachher noch da liegt, gehe Raid (Killer-Spray) und so komische schwarze Plastikdinger kaufen, die man auf den Boden stellen kann, so eins hab ich im Kleiderschrank gesehen. Da gehen sie rein, werden vergiftet und spazieren auf der anderen Seite tot wieder raus. Aha.
Sie liegt noch an Ort und Stelle als ich nach Hause komme. Ich sprühe sie vollends kaputt, das Spray ist eher so ne Art Schaum, ein letztes Wellnessbad für die Lake, disgusting, schiebe sie auf ein Kehrblech, more disgusting, und werfe sie in den Müll, even more disgusting, den ich dann raus bringe. Uffz. Okay. Das ist echt nicht mein Ding.
Ich bewege mich ab sofort wie immer nach sowas ungern in dieser Wohnung, sehe es überall krabbeln und muss mir richtig vornehmen, mich von denen jetzt nicht ins Bockshorn jagen zu lassen. Ich mache mir einen großen trotzigen Obstsalat und esse ihn. Stopfe aber auch alles in den Kühlschrank, inklusive Brot und sämtliches Obst. Bilde mir ein, dass mir das im anderen Apartment nicht passiert wäre. Spotlessly clean hieß es da. Ob ich meiner Vermieterin was sagen soll?
Leider kein Triumph-Foto gemacht. Von der Kakerlake meine ich.

Malaga im Mai – Rumlaufen 1
Heute morgen erste Entdeckungsreise. Vorher noch alle Schlüssel durchprobiert. Mir fällt ein, dass I. neulich erwähnt hat, dass sie die Schlüsselneurose auch kennt: Man denkt, man ist zu doof, die Türen aufzukriegen, die Schlösser haken, man dreht einmal, zweimal, dann gehen die Schlüssel nicht wieder raus, usw. Offenbar also mal wieder familiär bedingt. Hat vom Unsicherheitsfaktor her ziemlich viel Self-Fulfilling-Prophecy-Potential. Aber: Alle Schlüssel passen, ich kriege alle Schlösser auf und zu – Check.
Ich laufe und laufe, zuerst Plaza de la Merced, Orientierungspunkt, alles hier noch ganz schön verschlafen, obwohl schon 10 Uhr. Ich finde: den Mercado Central, unendlich viel Gassengewirr bei schönstem Licht, Cafes, allerdings noch kein Lieblings-, zu viele Iglesias, und mehrere pharmacias. Nach denen halte ich Ausschau, weil meine Augen leider ziemlich schmerzen. Wahrscheinlich Bindehautentzündung. Die Dame in der pharmacia, die ich schließlich auswähle, gibt mir was mit Antibiotika, bingo, wusste ichs doch, die stellen sich hier nicht so an, von wegen Antibiotika als Gefahrengut nur in der Hand der Ärzte (was ich übrigens voll unterstütze, aber nicht jetzt), hier auch eher so das amerikanische Prinzip. Wenns in zwei Tagen nicht besser ist, dann soll ich ins Hospital Civil.
Im Supersol al lado de Teatro Cervantes (noch Orientierungspunkt) kaufe ich das Nötigste und im Mercado daneben fresas (medio), 2 limones, eine Gurke, tomates (Cherry) und zahle dafür sage und schreibe 2 Euro. Da freut sich die Touristin. Wenn was billiger ist als daheim.
Jetzt sitze ich zum ersten Mal in meinem Patio und der Tisch ist gedeckt für die erste Schreibrunde. Gegenüber wird den ganzen Tag klassische Musik gespielt, die leise zu mir rüber dringt. Ich bin gerührt, extra für mich. Sie spielen sogar Lacia piango, das hab ich mal gesungen, krass, bei Sigrid.
Bis jetzt also alles prima, ich zwar insgesamt schüchtern, aber nicht böse und vor allem nicht wirklich gehandicapt deswegen. Ach, noch schnell in der Calle de Jinetes mein ursprüngliches Traumapartment angeschaut. Die Baustelle ist echt Großbaustelle, trotzdem werde ich wieder ein bisschen traurig, denn die Wohnung – ich kann sie von er Straße aus sehen – wäre nun mal eben doch so viel schöner gewesen als das eindeutig dunkle Apartment hier. Dennoch, es ist schon so warm hier unten auf der Straße, wie warm dann erst da oben…
Malaga im Mai – Parkposition

Parkposition Malaga, 1.Mai, 18:45
Das Paar neben mir hat die ganze Zeit gestritten. Solide Beziehung. Man hat gemerkt, dass sie sich lieben. Ihm war trotzdem nicht zu trauen.
Malaga im Mai – Schönefeld

Auf dem Weg nach Schönefeld Heizungskeller, siehe oben. Wie oft wohl noch? BER…
Regionalbahn 19 bringt mich hin. Ein Typ schräg gegenüber telefoniert mit einem Freund, hört sich nett ab, ein anderer Freund muss zur Therapie. Er erwähnt, dass er nach Malaga fliegt, genau wie ich. „Nur“ nach Malaga sagt er, well, das sage ich nicht: Ich bin sauaufgeregt. Als wir aussteigen stelle ich fest, er trägt Easyjet Uniform. Der Typ ist mein Pilot!
April 2014 – Mauerpark
Gestern Abend im Mauerpark. Die Sonne geht unter hinter den Wohnhäusern Weddings. Wir sitzen auf der kargen, steilen Wiese zwischen Zigarettenstummeln und Kronkorken, Safety Blick auf potentielle Hundescheiße beim Abstützen der Hand. Neben uns hat sich ein Pärchen Rotwein mitgebracht und irgendwas in Alufolie was wie Pizza aussieht, aber ökiger. Flaschensammler ziehen ihre Kreise. Einer entdeckt ein richtig dickes Nest, ein paar Meter unter uns in einer Bergkuhle. Das ist so saftig, dass es eine frische Tüte wert ist, eine große, gelbe sogar, die mit dem Hund drauf, von netto. Sie ist ordentlich zu einem Quadrat zusammengefaltet, wie zuhause wahrscheinlich auch die Stofftaschentücher und das geschenkte Geschenkpapier. Er schlägt sie auf, mit Knall. Lädt ihn ein, den Fund, Stück für Stück, hebt er das Nest aus. Das ist so zufriedenstellend.
April 2014 – Memoiren
Neulich erzähle ich D., dass ich nach Malaga fahre, zum Schreiben. Was schreibste denn?, fragt er. Meine Memoiren, sage ich. Er: An der Seite eines großen Mannes?
April 2014 – Bierfrage
J. neulich, regt sich auf über eine Bemerkung des Freundes einer Freundin. Kommt in die Küche der WG in der die Freundin wohnt, macht den Kühlschrank auf und sagt: Kein Bier. Typisch Frauen-Haushalt. Dabei, sagt J., trinken die doch alle ständig Bier!
Das ergibt natürlich keinen Sinn. Auch wenn der Kühlschrank voller Likörchen wäre, wäre es eine Scheiß-Bemerkung.
Andersrum übrigens ebenfalls denkbar. Nur Bier im Kühlschrank, typisch Männer-Haushalt. Könnte von mir sein. Auch nicht okay. Oder?
April 2014 – Karrieretip 1
Neulich in der Bahn. Mal wieder Karrieretipps von Frauen für Frauen: Sprecht die Sprache der Männer, wenn ihr weiterkommen wollt.
Frauen sind einfach so defizitär. Ewig muss man sie coachen.
Damit sie endlich dahin kommen, wo die Männer schon längst sind. In die Welt. Die einzige, wahre, universale, supergeile Männerwelt.
April 2014 – Mad Men 1
Gestern mehrere Folgen Mad Men 5 auf Netflix geguckt. Über die inneren (gender-) Identifikationsbewegungen nachgedacht, die man dabei hat. Man will Don sein, auch als Frau. Jedenfalls will man keine der Frauen sein, die von ihm gefickt werden, obwohl das ein kaputter Held wie er natürlich anrührend macht.
Ansonsten weiß man natürlich, wer für einen gedacht ist: Peggy, Sally. Nehm ich dankbar an. Saug ich auf, mit aller Wut dann wiederum auf Don und die Männermauer gegen die sie anrennen.
Toll gestern die Revolte von Joanie. Sie holt Avon in die Firma. Schafft es, sich an Campbell vorbei, mit dem Typen zu treffen. Hoch gepokert. Joanie schwitzt. Gewinnt dank Peggys kleinem Coup gerade so.
Ich frage mich: hat sich irgendwas verändert? Jungs dealen immer noch am liebsten mit Jungs.
April 2014 – Wählen
Ich fahre in die Müllerstraße, um zu wählen. Am 25.Mai werde ich nämlich nicht da sein. Auf dem Stimmzettel für das Tempelhof-Volksbegehren mache ich – im Gegensatz zu den meisten Menschen, die ich kenne – mein Kreuzchen bei Nein.
Sorry, folks, aber eine Bibliothek und Wohnungen auf einem Teilstück von fetten 300 ha Sahneschnitte mitten in der Stadt – da kann ich nicht Ja sagen.
Europa erledige ich gleich mit.
Danach nehme ich den 247er mit dem ich noch nie gefahren bin, obwohl er fast bei mir an der Haustür vorbeifährt, und überprüfe interessiert den Wedding auf Wohnfühltauglichkeit.
April 2014 – Neni
Wir waren im Neni essen, mit Blick über den Tiergarten. Ein überraschend grünes Meer, ohne Unterbrechung.
Bikini Berlin, Daniel Brühl auf dem Uniqulo-Plakat, die Monkey Bar. Zoopalast frisch renoviert. Berlin besucht sich selbst und guckt mal, was der Westen so macht und was davon zu halten ist.
Die ganze Familie ist fröhlich abgebildet auf der Speisekarte. Lauter junge, hübsche Menschen zwischen Israel, Libanon und Spanien. erinnert ein bisschen an die Familienaufstellung beim Mädchenitaliener, nur internationaler. Ich bin neidisch, wie immer. Verstehe nicht, wie man lebt.
Ich esse: Rote Beete Karotten Salat mit Sesam und Chili, Süßkartoffel-Chips (yeah!), den Rest hab ich vergessen, aber: alles great und viele kleine Sachen trotzdem satt. So mag ichs.
April 2014 – under water, love
T. lädt mich zum Geburtstag ins Hotel Palace ein, um mir dort tauchen beizubringen. Es ist schwer zu verstehen, aber ich hab das nie gelernt und eine ähnlich unkontrollierbare Angst davor wie vor den meisten anderen selbstverständlichen Dingen.
Ich bekomme eine Taucherbrille und eine Nasenklammer. Zuerst übe ich unter Wasser ausatmen über Wasser einatmen. Man sollte meinen, dass das logisch ist, aber nichts dergleichen. Es ist nicht zu fassen, dass ich das nicht kann, als wäre irgendwas evolutionär falsch verbaut. (Insgeheim bestätige ich mir selbst mal wieder die Alien-These). T. lacht sich immer wieder kaputt, weil ich so komisch bin. Nach einer halben Stunde habe ich was kapiert und dann, nochmal eine halbe Stunde später, bin ich das erste Mal unter Wasser. Sehenden Auges (wegen der Brille) und inklusive Ohren. Und halte es aus. Gucke mich um und habe das Gefühl, dass das was Schönes sein kann. Als ich nach oben komme, fange ich an zu weinen. Meine Scheiß-Eltern, sage ich zu T.
April 2014 – Banner 1
T.W., ein Freund, schickt mir zum Geburtstag ein Banner via Whatsapp:
Mehr Liebe weniger Fuck you.
April 2014 – Fundstück 1








































