Ein obdachloser Mann, viele Beutel links und rechts über den Schultern. Alle von Supermärkten. Um seinen Hals trägt er, wie eine überdimensionale Kette, einen dieser Schwimmgürtel, die aus mehreren Blöcken bestehen.
So bleibt er oben.
Ein obdachloser Mann, viele Beutel links und rechts über den Schultern. Alle von Supermärkten. Um seinen Hals trägt er, wie eine überdimensionale Kette, einen dieser Schwimmgürtel, die aus mehreren Blöcken bestehen.
So bleibt er oben.
Ich weiß nicht wovor ich mehr Angst habe, vor dem was kommt oder vor dem was nicht kommt.
Kommt es mir nur so vor, oder ist es stiller geworden, das Schweigen größer, wenn ich mit Menschen am Tisch sitze und das Gespräch auf Politik kommt. Menschen, die früher gerne und viele darüber diskutiert haben. Ist es die Ratlosigkeit, die sich eingestellt hat, angesichts der so grundlegenden, sich in atemberaubender Geschwindigkeit vollziehenden Veränderungen der Zeit? Ist es die Sorge, vielleicht feststellen zu müssen, dass man, ähnlich wie in der Pandemie, unterschiedliche Positionen zu den Dingen hat, womöglich so unterschiedlich, dass die Freundschaft plötzlich zur Gewissensfrage wird? Ist die Stille Ausdruck einer sich im Gang befindenden Suche nach der eigenen Position, um die man früher leicht wusste und heute nicht mehr? Ist das Schweigen größer, weil man Positionen einnimmt, von denen man niemals gedacht hätte, dass man sie einnehmen würde, die man aber nun, angesichts des sogenannten Vibe-Shifts für richtig hält? Ist es stiller, weil diese Positionen die Fragen aufwerfen, ob man sie schon früher hätte vertreten müssen, man also falsch lag? Ist ein Schweigen im Raum, weil man fürchtet, etwas zu sagen, das man im Kopf hat, vielleicht auf der Zunge trägt, aber von dem man nicht weiß, ob es denkbar oder sagbar sein sollte?
Jetzt wünschte ich nur noch, es fiele Sand aus dem Buch.
Heute in der Ubahn. Die Bahn fährt am Bahnhof Alexanderplatz los und bleibt noch am Gleis wieder stehen. Und steht. Steht. Uuund: steht.
Eine Frau wird nervös, sie versucht die Tür zu öffnen. Geht nicht. Jetzt wird sie noch nervöser, redet vor sich hin, Maaannn. Sie steckt mich an, ich lass mich nicht anstecken.
Keine Durchsage. Der Zug steht. Die Türen gehen noch immer nicht auf.
Ich setze mich, nehme mein Handy, das beste Mittel, um mich zu beruhigen: Berichterstattungen und Analysen zur desaströsen Weltlage lesen. Ich atme ruhig, ich muss mich konzentrieren, nicht an die verschlossenen Türen zu denken, keine Panikattacke zu bekommen.
Irgendwann läuft der Fahrer die Ubahnwagen entlang, zwei Männer kommen hinzu mit BVG-Westen, alles ist vollkommen unklar, Schaden am Zug, jemand ausgeflippt, Warten auf die Polizei, jemand auf den Schienen, what the fuck is Hölle los?
Als der Fahrer und die beiden Westen zurückkommen, stehe ich auf und klopfe an die Scheibe der Tür, es geht so schnell, dass ich es erst später realisiere. Ich drücke demonstrativ dreimal laut die Türhebel runter: Lassen Sie uns mal raus oder sagen uns wenigstens mal was los ist? Der Fahrer guckt nur böse, da hat man Schwierigkeiten und dann wird man auch noch doof angemacht, die Westen sagen auch nichts. Warum?
Inzwischen sind wir seit zehn Minuten hier drin und können nicht aussteigen. Eine ganze elend lange Bahn voll mit Menschen, die eingesperrt sind. Was, wenn ich mich anders entscheiden will, statt Bahn zu fahren, lieber laufen möchte, weil ich es eilig habe, lieber eine andere Route nehmen will, warum hat dieses Arschloch von Fahrer nicht die Türen freigegeben, warum hat er nichts gesagt, gar nichts. Ist was so Schlimmes passiert, dass man nicht darüber reden kann. Um niemanden zu beunruhigen?!
Ich schaue zurück aufs Handy, lese den Artikel weiter, zwinge mich, nicht herum zu daddeln, herum zu scrollen. Satz für Satz. Vielleicht gehen die Türen gar nicht auf, vielleicht hat er sie nicht nicht freigegeben, sondern sie gehen nicht auf, weil die Elektrik spinnt. Warum hat er den Zug runtergefahren und dann wieder hoch. Und trotzdem nicht die Türen freigegeben.
Die nervöse Frau hat ihren Kopf auf ihre Unterarme gelegt. Ich weiß, wies ihr geht, trotzdem, hör auf damit, du Panikkuh, du steckst mich an, reiß dich zusammen. Sie ist groß und kräftig, ihre Unterarme liegen auf dem Plexiglas neben der Tür, da komm ich nicht mal hin, jedenfalls nicht mit den Unterarmen. Eine andere Frau erklärt, mehr sich als den anderen, das dürfen die nicht, die Türen aufmachen, aus Sicherheitsgründen. Als wären wir hier drin in Sicherheit. Asl hätte dieses Arschloch von Fahrer auch nur eine sekunde an das Vieh in seinen Waggons gedacht. Wie geht es den anderen in den anderen Wagen, wir haben Glück, dass wir nur die nervöse Frau haben. Und mich. In anderen Wagen siehts vielleicht schon anders aus, da ist vielleicht schon einer dabei, die Tür aufzubrechen, das Fenster mit dem Nothammer einzuschlagen, die Notbremse zu ziehen, die Polizei zu rufen oder was könnte man sonst noch machen.
Die eine Weste bleibt jetzt näher an unserem Fenster stehen, guckt pseudo-checkermäßig die Wagenreihe entlang nach links, die Wagen entlang nach rechts, warum bin ich nicht in den vordersten eingestiegen, dann könnte ich jetzt gegen die Fahrertür klopfen, was rufen, was fragen. Das könnte meine OCD-Macke werden, immer vorne einsteigen. Die Weste guckt zu uns rein, zu mir, die gemotzt hat, der fährt gleich weiter, sagt er. Leck mich, denke ich, klammere aber meinen Blick einen Moment lang an seinem Gesicht fest, seinem unsicheren Lächeln, seinem uns Sicherheit vermitteln wollenden Blick. Das Handy. Ein vertrauter Ort, voller heimeliger Katastrophen.
Irgendwann fährt die Bahn wieder hoch. Der Zug fährt los. Was für eine beschissene Scheiße, denke ich, 15 Minuten eingesperrt, von einer Person, die sich zum Herrn gemacht hat über uns, gehört das nicht zum Protokoll, Leute informieren, Türen freigeben, damit alle frei entscheiden können, was sie jetzt machen wollen, bleiben oder das Weite suchen?
Als ich an der übernächsten Station aussteige, bin ich zittrig, aufgelöst. Und genervt davon.
Plötzlich sehe ich das Zimmer vor mir, in das meine Mutter mich früher eingesperrt hat.
Drei Jungs in der Sbahn. Einer deutet runter auf einen Imbiss, an dem wir vorbei fahren:
Döner hier voll overrated. Schmeckt Arsch, Digga, wie Arschritze, Digga.
Ansonsten geht es viel um die Frage ob der ne Freundin hat oder der? Als klar ist, dass der ne Freundin hat, schüttelt der Arschmann den Kopf, so: Wieso der und ich nich.
Was ist das für eine Existenz.
Dieses permanente Traurigsein.
All die Schritte, die ich gehe,
gehe ich allein.
Ich komme gerne an. Ich ziehe gerne weiter.
Ich weine. Aber ich bin unterwegs.
Das Gras wie eine ausgelegte Matte
immer möchte man
darüber streicheln
wie über das Fell eines Tieres
dabei den kleinen Kästchen ausweichen, den Häusern und Hütten
Die Tiere, Pferde, Kühe
hochnehmen und ein bisschen weiter nach links setzen
oder nach rechts
aber sie fliegen ja sowieso vorbei
Der Nebel hängt wie Rauch
über den Bäumen
einmal hinein pusten
einmal ihn fassen
um zu schauen
wie kühl er ist
wie fest wie flüchtig
Mega nervige Girls Crew auf dem zentralen Platz in Tirano, auf dem alle nur ankommen, um abzufahren. Der arme Ort einfach nur eine Umsteigestelle, ein Wartelokal für den Bernina-Express, mit Eis, Cafés, einer schnellen Pasta, ein paar Bänken unter Bäumen zum Ausruhen und so einer Art Erweiterung des Platzes zwischen den Shops von dem aus man im Hintergrund das Bergpanorama sieht. Der Platz, den jetzt die Girls belegen.
Sie posen in allen nur erdenklichen Formationen vor den Kameras ihrer Handys, allein, zu zweit, als Gruppe, anders zu zweit, anders als Gruppe, sie rufen, sie schreien, sie kommandieren über den Platz. Wer an ihnen vorbei will, hats schwer, kann sich nur vorbei drücken, muss sich bemerkbar machen, nur um von der Gruppe ausdrücklich unbemerkt zu bleiben. Sie nehmen den ganzen Platz ein, belegen, wenn sie gerade nicht in einer Session sind, sogar noch die Stühle eines angrenzenden Cafés, ohne was zu bestellen, von wo aus ich die Show staunend beobachte. Das hier ist ne ernste Sache, so viel steht fest. Da ist viel Druck drauf.
Von der Bande her rufen die, die gerade nicht auf der Bühne stehen, Posing-Vorschläge rein, Anfeuerungsrufe: Luv ya, Love this outfit, So cute, honey, oder auch mal was konstruktiv Kritisches, Mahnendes: Maybe more to the right, oder The shirt, honey, the shirt! wenn The shirt verknittert aussieht.
Das meiste verstehe ich nicht, weil sie hauptsächlich Indisch sprechen, wobei mir klar ist, dass es das nicht gibt, Hindi, kann ich nur annehmen. Die Girls machen den Eindruck als seien sie eine Gruppe von zwanzig, de facto sind sie nur zu siebt. Alle sind in ihren Mid- to late twenties würde ich sagen, schicke kids, eher rich, aber was weiß ich schon. Zwei Jungs sind auch dabei. Viel zu sagen haben die nicht. Einer von ihnen ermahnt die anderen irgendwann: This is a public space, guys. Keine der Frauen ändert danach auch nur ein Mü ihr Verhalten.
Sind diese Girls jetzt so, weil das die lang ersparte super teure Reise ihres Lebens ins ultimative Sehnsuchtsland der Bollywood Filme, der Schweiz, ist, und nur hier und jetzt also die Chance besteht, die nicht wiederkommt, Freunden und Familien auf den einschlägigen Beweisplattformen zu beweisen, dass man es geschafft hat
oder sind das einfach superficial White-Lotus-Tussis, die im Business Studium gelernt haben, dass man einfach immer so rigoros sein muss?
Im Bus von Lugano nach Tirano. Neben mir eine Familie mit halbflüggem Sohn. Mutter und Vater versuchen mit je einem Fotoapparat die ganze Fahrt festzuhalten bzw. abzuschießen, der Fotoapparat des Mannes gibt drei Stunden lang in kurzen Abständen ein Maschinengewehrgeräusch von sich. Leute, a, kann man sowas nicht ausstellen? Und b, wer denkt sich so einen Sound aus?
Ich lasse mir davon die Aussicht nicht trüben. Italien sieht wunderschön aus, als wir über die Grenze fahren und ich die erste Zypresse sehe, kommen mir die Tränen. Plötzlich wird mir klar, dass die drei Russisch sprechen. Keine Ahnung, vielleicht sind die drei ja auch Regimegegner,
aber der Sound liegt jetzt anders über dem Landstrich.
Das Hotel ist wunderschön.
Trau ich mich in den Pool?
Am nächsten Morgen ganz früh trau ich mich. Es ist herrlich. Der Blick aus dem Wasser übers Wasser, nämlich des Luganer Sees, die kleine Meerjungfrau am Beckenrand, die aus einer Schale Wasser in den Pool gießt. Schwimmen geht nur eingeschränkt, die Schulter. Aber ich schwimme, ich bin da, ich schaue, ich fotografiere, ich wusste, dass ich froh gewesen sein würde, das gemacht zu haben und so ist es.
Im Bad schlage ich mir kurz danach heftig den Knöchel an, Schmerz, und sofort: Angst, Panik, was wenn ich mir wieder was gebrochen habe. Einfallstor für alles, die Wut auf T., die Wut auf U, die Angst vor der Zukunft, vor der Perspektive aus Schmerzen und zunehmender Immobilität, nicht mehr laufen können, nicht mehr das machen können, was ich hier gerade mache, der Gedanke an eine geheime Erkrankung im Hintergrund, die alles, was ich habe, in einen Gesamtzusammenhang stellen würde, die Schulter, die Hüfte, das Knie, die Füße, die Finger, der Rücken, bei jedem Hexenschuss, der mich für Tage, Wochen, raushaut, jedesmal die Sorge, dass es was Schlimmeres ist, doch wieder ein Bandscheibenvorfall?, ein erster Wirbelbruch?, tagelanges Rumquälen wie ein halb zerquetschtes Insekt, nach dem Liegen an der Fensterbank hochziehen, nicht sitzen, nicht liegen, nur stehen oder gehen wie ein Zombie, bis in der Konsequenz was anderes weh tut, nicht teilhaben, sondern Tabletten fressen, die wenig nützen,
jeden Tag mache ich Sport, dauernd gehe ich zur Physio, zur Ostheo, jeden Tag lasse ich mich „nicht unterkriegen“, wie scheiße das ist, sich nicht unterkriegen zu lassen, was soll das sein, das ist nicht leben, das ist permanente Anspannung, permanente Angst, dass es wieder kommt, das ist Kampf, Goliath, Windflügel, wann wird der Tag kommen, an dem ich mich unterkriegen lasse, untergekriegt werde, ich fühle mich schuldig, bringe mein ständiges Kranksein mit dem Scheitern meiner Beziehungen in Verbindung, mit der Vorstellung einer Unmöglichkeit einer neuen Beziehung, wer will sich das antun, wer will mit jemand zusammen sein, der permanent krank ist, jederzeit sein könnte, U, der keine Lust mehr dazu hatte, sich damit beschäftigen zu müssen, dabei sein zu müssen, wenn schon wieder irgendwas ist, es macht mich verzweifelt, weil ich nicht die Krankheit bin, die sich aber so aufspielt, ich stelle mir vor, wie er schwimmt, paddelt, wandert, Ski fährt, nur ein paar Kilometer weg von hier, mit einer anderen Frau. Einer Saisonkraft.
Ein Bahnbeamter in Uniform, ich schätze ihn auf 60, berät mich am Schalter im Zürcher Bahnhof.
Ich habe ihn gefragt, ob es angesichts der Zugreisen, die ich durch die Schweiz noch so vor mir habe, vielleicht eine insgesamt günstigere Möglichkeit gäbe als einzelne Tickets zu kaufen. Er überlegt, tippt, probiert aus. Nein, das lohnt sich nicht, das hier vielleicht? – Ah, mit dem Touristenticket hätten Sies günstiger haben können, aber das hätten sie dann direkt vor der ersten Fahrt kaufen müssen. Er schüttelt bedauernd den Kopf:
Also der Zug ist abgefahren, sag ich mal.
Obwohl ich ahne, dass er diesen Witz seit Jahrzehnten seinen Kundinnen und Kunden erzählt, obwohl ich sehe, dass er etwas zu siegessicher auf meine Reaktion wartet, muss ich laut lachen.
Und so fahre ich
mit meinem Liebeskummer
und meinem Trotz
durch
plötzlich Italien!
Das Wasser flaschengrün, ach was, türkis!!!
In der Nachbarschaft meiner Bürogemeinschaft gab es einen alten japanischen Mann. Er war schmal und hager. Jeden Tag ging er, auf seinen Rollator gestützt, an der Eingangstür unseres Ladenlokals vorbei. Diszipliniert, so kam es mir vor, um sich zu bewegen und ein paar Schritte bis mindestens zum Ende der Straße zu gehen.
Für ein paar langsame Sekunden erschien er zu unterschiedlichen Tageszeiten im Fenster des Türrahmens, wo ich ihn von meinem Platz aus sehen konnte, verblasste im Weitergehen hinter dem milchigen Sichtschutz des Schaufensters, um schließlich aus meinem Sichtfeld zu verschwinden.
Nie setzte er sich, wie viele andere Nachbarn auf das Bänkchen vor dem Fenster.
Manchmal saß ich auf diesem Bänkchen und sah ihn vorbeikommen. Auf seinem Hin- oder Rückweg. Ich habe, typisch für mich, erst nach einer Weile angefangen ihn zu grüßen. Er nickte zurück. Mehr nicht.
Ich habe den anderen in unserem Büro manchmal von ihm erzählt. Wer? Kenn ich nicht, haben sie gesagt. Niemand wusste, von wem ich spreche. Niemandem war er aufgefallen. Keiner hatte ihn je gesehen. Auch die nicht, die viel öfter da waren als ich, auch die nicht, die viel mehr mit der Nachbarschaft im Kontakt sind als ich.
Der japanische Mann ist lange nicht mehr an unserem Büro vorbeigelaufen. Sehr lange. So lange, dass ich davon ausgehe, dass er inzwischen seine Wohnung nicht mehr verlassen kann. Oder im Heim ist. Oder gestorben.
Ich weiß nichts über ihn. Gar nichts.
Ich kann niemanden nach ihm fragen.
Ich vermisse ihn.
Manche Kinder wachsen auf und haben das Gefühl, sie seien ein Geschenk. Ich wundere mich mein Leben lang, wieso nie jemand verstanden hat, dass ich ein Geschenk bin. Zwinkersmiley.
Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber ich finde die Männer meiner Generation gerade so richtig scheiße.
Es ist heiß.
Als ich die Wasserflasche öffne, pfeift der Wind ein Lied darin.
Ein junger Mann trägt seine Muskeln spazieren.
Nackt ab der Jeans aufwärts.
Die Farben leuchten.
Plötzlich Kleider in Gelb zu Taschen in Lila zu Caps in Rot.
G. regt sich auf, weil ein riesiges Schild mit der Aufschrift Frieden am Ortsschild eines kleinen Brandenburger Dorfes hängt. Ist doch klar, wer das ist, sagt er. Is doch irre, sage ich, dass das so ist. Dass die Forderung nach Frieden, die zu unserer politischen Sozialisation, zu unserem Selbstverständnis als sich links verortende Menschen seit je dazugehört, heute etwas ist, was einen empört. Dass man, wie G., den Impuls verspürt, zur Bürgermeisterin gehen zu wollen und zu sagen, was hängt denn da, so geht das doch nicht. Weil man weiß, welche Ecke mit dem Begriff hantiert und welchen Twist er dort verpasst bekommen hat. Frieden und Freiheit fordern, das machen heute die Rechten – oder die von links in diese Richtung abgebogenen bei der BSW. Und was kann man als Bevölkerung vor Ort oder als Durchgangsreisender auch sagen gegen ein Plakat, das Frieden fordert. Für wen da nix dabei ist, dem ist eh nicht zu helfen. Den sogenannten Kulturkampf hat die AfD in diesen Orten längst gewonnen. Wir können dagegenhalten und spezifizieren, was wir meinen, wenn wir Frieden sagen. Aber das ist alles Jaja und tl;dr. Die Begriffe liegen längst frisch gefüllt wie Cannoli ganz vorne in der Auslage.
Dennoch. Sind jetzt alle Leute, die sich auf Frieden als aktivistischen, politischen Begriff beziehen, nur bekloppte, naive Hippie-Idioten? Das hatten wir schon mal. Die Rhetorik der Stunde ist jedenfalls Aufrüsten in Milliardenhöhe, kriegstüchtig werden (nicht mal verteidigungstüchtig hört man mehr, der Krieg muss schon rein in die Köpfe, in die Erwartungshaltung), Rheinmetall-Aktien kaufen, Wehrpflicht wieder einführen, sich von der Schweiz zum Thema Bunker beraten lassen, bei uns gibts nämlich keine, da sind jetzt Ausstellungen und Pubs drin, den Hiroshima-Jahrestag weggedenken, als wär er was für Leute im Altersheim, Experten für Katastrophenschutz warnen und aufklären lassen, und immer wieder auf allen Kanälen versichern, dass der Krieg in der Ukraine alternativlos sei, weil Putin sich nicht bewegen will. Das stimmt auch. Aber trotzdem, ich mein, ja nur. Rhetorik. Was ist hegemonial. Alles immer mit Vorsicht zu genießen und zu beobachten.
Im Gropius Bau und der Nationalgalerie eine Ausstellung von Yoko Ono. Es wäre falsch, sie nur auf diese Peace-Sachen zu reduzieren, die sie gemacht hat, aber als Thema zieht sich das bei ihr schon durch. Kein Wunder, sie hat als Kind den Krieg erlebt. Und auch, wenn mir das oft kitschig oder zu einfach vorkommt, was sie da macht, liegt doch gerade in der Einfachheit der Peace-Forderung, des Friedens-Wunsches eine Stärke. Was, wenn alle Schachfiguren weiß sind. Wie in den 80ern verbindet sich die Forderung nach Frieden erneut mit der Natur und Umwelt-Frage, heute Klimawandel genannt. Im September gibt es in der Neuen Nationalgalerie eine von der Yoko Ono-Ausstellung inspirierte lange Tafel für alle, bei dem irgendwann alle als Friedenszeichen gemeinsam kleine Glocken läuten. Da muss ich natürlich spontan an die Ulmer Menschenkette denken. Okay, Frieden sagen war schon immer etwas problematisch, weil nicht gerade analytisch, sondern eher gefühlig, weihnachtlich, aber dennoch, was, wenn Frieden sagen irgendwann mal wieder hegemonialer und weniger peinlich bzw. vor allem weniger Putinflüsterer-mäßig. Was bis dahin alles passieren wird, davor graut einem. Es fällt mir jedenfalls auf, dieses Event, als seismografische Bewegung gegen die Bewegung. Und gegen die gefüllten Cannoli.
Ich will nichts außer ins Cafe gehen
und ein Buch lesen, vielleicht
über einen Markt laufen, an einem Wasser entlang,
ins nächste Cafe, und weiterlesen.
Ein bisschen was schreiben möglicherweise,
ein wenig durch die Läden gehen und shoppen,
eine Ausstellung anschauen
vielleicht,
etwas wunderbares Kleines essen, einen Drink nehmen
mit einem Freund,
in einer Bar,
an einem Platz,
vielleicht ins Kino gucken oder kochen für Freunde,
die Küche, der Balkon.
So riecht es gut.
so fühlt es sich satt an, richtig und frei.
Die Menschen machen mich wahnsinnig. Sie husten und schniefen und schnupfeln und räuspern sich, sie schmatzen und schmieren. Sie drängeln und drücken, sie halten die Tür nicht auf. Sie blinken nicht beim Autofahren, sie lassen ihre Hunde auf den Gehweg scheißen. Sie sprechen laut und playen games ohne Kopfhörer, sie hindern ihre Kinder nicht daran, im Cafe Wettrennen zu spielen. Sie scheißen selbst. Auf den Sitz in der U – wait for it – 5. Sie füttern Tauben und Spatzen. Das soll man nicht!
Wer hat behauptet, der Traum sei zur Verarbeitung da, der Traum hält das Trauma aufrecht, er füttert die alte Erzählung, füllt sie mit Varianten, damit sie auf ewig bleibt, der Traum will geträumt werden, also träumt er mich, ich bin sein Wirt, warum erzählt er mir keine andere Geschichte, der Traum, eine, die mich erleichtert, mir sagt, wie gut und schön alles ist, eine Geschichte, die mich tröstet und beruhigt. Bin ich schuld an meinen Träumen, sind meine Träume schuld an mir, ich träume nicht meine Träume, meine Träume träumen mich.
Ich bin nicht meine Träume.
Im Büro vermacht mir jemand einen alten Schreibblock aus der DDR. Die Seiten sind vergilbt, eher in einem Karamell-Ton als in einer gelblichen Sepiafarbe. Das Cover ist in einem schönen Design gehalten. Schwarz mit goldenen Querstreifen, nach links und rechts gekippt, zusammen bilden sie kleine Rauten. Der Geruch des Papiers als ich das Cover hebe, irritiert mich. Ich finde ihn eigen. Ich kenne ihn nicht.
Ich frage mich, ob sich Menschen aufgrund dieses Geruchs in die DDR zurückversetzt fühlen, so Proustsche Madeleine-mäßig. Und sagen:
So hat die DDR gerochen.
Cafe in Mitte, morgens, Schlange. Zwei Frauen mit kleinem Hund, eine Frau mit großem Hund.
Der größere beschnuppert den kleinen. Verzückte Blicke auf die Hunde.
Der größere schiebt seine Nase full frontal an den Hintern des kleinen.
Ist das ein Männchen? fragt die Besitzerin des kleinen.
Ja. sagt die mit dem großen.
Ah – Sie ist grade läufig.
(Ich kotze fast in meinen Kaffee.)
Der macht nichts, sagt die Frau vom großen.
Ich bin der Meinung, der weiß nicht wies geht.
Alle drei Frauen lachen laut und kräftig.
Mir reichts schon wieder für heute.
Wo und wann geht es dir gut? schreibe ich auf einen Zettel.
Immer wieder begegnet er mir, über Tage, Wochen.
Das Vermissen von Menschen, die mir einmal nah waren
oder soll ich sagen, nie nah genug
ist ein so großer Anteil meines Gefühlshaushalts, dass ich mich frage, aus was ich sonst noch bestehe.
Die Wäsche schaukelt sacht
wie das Pendel einer Uhr
U. ist weg.
Er war schon die ganze Zeit weg.
Erst war er in einem Weg in der Nähe.
Dann war er auf dem Weg ins Weg.
Jetzt ist er ganz weg. Dort, wo er hinwollte,
ins Weg.
Weg von mir.
Ich bin hier. Im Hier und Jetzt.
Denn das Weg ist ja schon besetzt.
Von starken Männern.
Im Hier ist die Luft jetzt rein. Ich kann mich frei bewegen.
So frei, wie jemand,
der den Bauch mit Wackersteinen voll hat.
Die sieben Geißlein tanzen um mich herum.
Oft sehe ich sie, irgendwo auf der Straße, an der Ampel, im Getümmel, T. und U
Ich sehe sie, weil irgendjemand mich für einen stechenden Moment an sie erinnert, weil Silhouette, Gangart, Gesichtszug, Kleidungsstil ihr Bild in mir aufruft. Ich sehe sie, weil diese anderen Männer in Situationen sind, in denen sie einmal waren, in denen sie vielleicht gerade sind, in denen sie irgendwann sein könnten. U mit einem kleinen blonden Mädchen auf den Schultern, das andere an der Hand, T. mit seiner Tour-de-France-Cap auf dem Rennrad, U im Auto auf dem Weg zum See, im Radio deutsches Songwriting, T., alt geworden, im weißen Hemd in einer Ausstellung, charmant parlierend neben einer gutaussehenden Frau, U, älter geworden, im Gespräch mit einem Enkelkind.
Was ich nicht finde, nie, in den Silhouetten, Gangarten, Gesichtszügen, Kleidungsstilen, T.s Wachheit, Radikalität und Traurigkeit, Us Ruhe, Eigensinn und Zurückgenommenheit.
Nun vermisse ich also schon zwei Männer.
Was ist die Aufgabe, mir einen dritten suchen?
Im ICE nach Berlin. Eine Durchsage des Zugführers:
Der Zug muss leider über Hannover umgeleitet werden. Grund ist ein Suizidversuch auf der Strecke.
Ein Fahrgast laut irgendwo weiter vorne im Abteil:
Einfach drüber fahren!
1 Dass ein voll besetzter ICE als Telegram Kanal für ungefiltert rausgehauene Hassposts herhalten muss, dass ein vor Verachtung und Würdelosigkeit strotzendes Statement nicht mehr von irgendeinem hugo_21 auf der Toilette getippt werden muss, sondern es lautstark am helllichten Tag in aller Öffentlichkeit geäußert wird, könnte mich und alle anderen schockieren, aber dazu sind wie alle schon zu abgebrüht. Das ist das eigentlich Schockierende.
2 Warum formuliert der Zugchef das so explizit? In der DBApp steht: Wegen eines Notfalleinsatzes, das scheint mir angemessen. Warum scheint mir aus der faktischen Formulierung, die er wählt, dennoch sein Ärger zu klingen. So, jetzt waren wir mal so schön pünktlich – denn in diesem Kontext hat der Suizid für ihn und die Bahn natürlich Bedeutung als Topos mit dem man regelmäßig umgehen, Protokolle abarbeiten muss – und nun wieder so einer. Hat seine explizite Formulierung, den Mann mit dem mündlich vorgetragenen Hasspost ermutigt? Geht es irgendjemand was an, ob ein Herzinfarkt, Schlaganfall oder Suizidversuch der Grund für den Notfalleinsatz ist? Ist es eine Indiskretion, das zu erwähnen? Fakt ist doch, jemand braucht Hilfe. Und wenn die Hilfe zu spät kommt, auch.
3 Hat der Suizid eines Menschen an Bedeutung, an Dramatik verloren? Der Aufwand, der auf institutioneller Ebene betrieben wird, um den Suizid zu verhindern, und ihn, wenn er passiert, zu be- arbeiten und zu verarbeiten, scheint mir hoch. Wieso hat man den Eindruck, die Institution hält hier einmal mehr etwas aufrecht, was einmal mühsam erarbeiteter Werte-Konsens war. Für die meisten scheint der Suizid vor allem ein narzisstischer, egoistischer Akt zu sein. Der Abläufe stört und Menschen verstört. Warum soll man den Suizidalen retten, wenn er doch gar nicht gerettet werden will. Ist doch eine freie Entscheidung. Außerdem, andere, also wir hier, stellen uns doch auch nicht so an, halten die ganze Scheiße aus, zum Beispiel die ewigen Bahnverspätungen, aber irgendeiner muss sich ja immer wichtig machen.
4 Hat der begleitete, freiwillige, sozusagen saubere Suizid, dem regulären seine Dramatik genommen, der deshalb jetzt noch eher als Ärgernis, Unverschämtheit, Rücksichtslosigkeit wahrgenommen wird?
Dann wieder Nachrichten, die mich glücklich machen. Ich bin so begeistert. Alles ist gut heute, life is beautiful:
Es gibt einen neuen Kontinent: Zealandia. Er hat sich versteckt gehalten, im Wasser, nicht mal besonders tief. Wir haben nur nicht verstanden, dass er ein Kontinent ist.
Es gibt eine neue Farbe. Sie heißt Olo. Wir konnten sie nur nicht sehen. Bis jetzt!
Der quälende Gedanke, dass ich den letzten netten Mann über fünfzig in die Flucht geschlagen habe.
Mal wieder ein Paket bei der Nachbarin gelandet. Es dauert lange, bis sie öffnet. In letzter Zeit war sie oft nicht da, ihre Schwiegertochter hat aufgemacht. Ich sehe: Sie hat kaum noch Haare. Der Krebs ist zurück. Ihr Körper ist schwer, sie sucht im Kämmerchen nach dem Paket. Während ich warte, überlege ich, was ich sagen könnte, wie geht’s Ihnen?
Ich sage nichts.
Ein paar Tage später sehe ich sie wieder. Zwei Sanis bringen sie mit dem Transporter zurück. Bringdienst? Wahrscheinlich kommt sie von der Chemo. Ich schaue rüber zu ihr, die Straße hinunter, so lange, bis sie mich entdeckt. Dann hebe ich die Hand zum Gruß. Sie lächelt und winkt zurück.
Lindner hat einen Hund überfahren. Der Hund gehört einem Filmproduzenten und war klein. Sehr klein. Der Hund war so klein, etwa 1 Meter 67, dass Lindner ihn in seinem SUV übersehen musste. Die Filmrechte wurden vom Produzenten noch vor Ort erworben. Nachdem er seine Tränen getrocknet hatte. Blöd ist, dass Lindner gerade ein Baby bekommen hat. Was jetzt schlecht zusammen passt, schlagzeilentechnisch.
Interessant an der Sache: noch nie war ich Lindner so nahe. Das Menschliche tropft nach dieser Sache aus ihm, wie das Gedärm aus dem Hund.
Der Produzent wird sich das nächste Mal einen größeren Hund anschaffen. Ein edleres Tier. Vom Geld aus der Klage.
Ich wünsche mir ja nicht mal mehr jemand, der mich liebt. Von Minute zu Minute scheint das weniger möglich zu sein. Ich sehe es,
in allem, was sich spiegelt.
Ich wünsche mir jemand, der bereit wäre, mich zu lieben. Allzeit bereit. Der dieser Frage also mit permanenter Offenheit begegnet.
Ich denke darüber nach, wer je zu mir Ich liebe dich gesagt hat. Darüber, wie oft ich diesen Satz gehört habe, in meinem Leben. Ich erinnere mich an zweimal.
Und wie oft ich ihn gesagt habe. Öfter, aber nicht viel öfter. Mit Bedacht und ohne Drogeneinfluss.
Man soll ja nicht verschwenderisch sein damit, und es nicht so machen, wie die in den amerikanischen Serien. Aber so ist es auch nicht gut. Ein bisschen wenig für ein ganzes Leben.
Ein Kollege erzählt mir von der Tracking App, die er fürs Handy seiner 11jährigen Tochter installiert hat. Sie weiß nichts davon. Ich weiß, sagt er, und checkt, ob sie in der Sporthalle angekommen ist, in die sie mit dem Rad unterwegs war, das ist mega scheiße. Aber was willst du machen, ey. Heute
Schon wieder eine OP. Nichts Wildes, so ein ewig verschobenes Muss-halt.
Meine Laune ist mega schlecht. Wieder stochert die Schwester in meinen Venen herum, ich fühle schon beim ersten Mal, dass es nicht klappen wird, wie ich das hasse, wenn die das nicht können und sie dann Drüberweglabern über ihre Unfähigkeit, auf dem Op-Tisch werde ich robust platziert, obwohl ich sage, dass ich meinen Arm nicht so verdrehen kann, weil die Schulter leider kaputt ist, als jemand anderes dazu kommt, ist es plötzlich kein Problem mehr, den Arm nicht derart anzuwinkeln, aber ich bin sowieso nicht mehr vorhanden, ich bin ein Bein, das jetzt fertig gemacht werden muss, weil die Ärztin gleich da ist, ich bin ein Unterschenkel, ein Unterschenkel von vielen, ein Unterschenkel der desinfiziert wird, ein Unterschenkel, der winzig fein aufgeschnitten wird, ich bin OP-Vieh, die Narkose, diesmal ein sogenannter Dämmerschlaf, wirkt mal wieder nur halbgar und ich habe starke, brennende Schmerzen, formuliere das auch, fragend, zweimal im Laufe der OP mit der vorsichtigen Intonation von: Ist das normal, ohne weitere Reaktion der Narkoseschwester, ich halte die Augen geschlossen, die Tränen laufen mir sanft und leise aus den geschlossenen Augen, wie das Blut aus dem Bein.
Habe ich schon gesagt, dass ich erschöpft bin? Das stimmt nicht mehr, ich bin aggressiv.
C. holt mich ab,
das ist so gut.
Wie schafft sie das nur immer.
Eine junge Frau auf der Straße spricht mich an, Sorry, ob ich zufällig einen Tampon habe?
Sehr schmeichelhafte Frage.
Suchend,
fragend,
entsetzt?
Wirr, irre, wirrirre
Wahrnehmend:
Geräusch, Licht, Berührung.
Erinnernd, denkend?
Ich weiß es nicht.
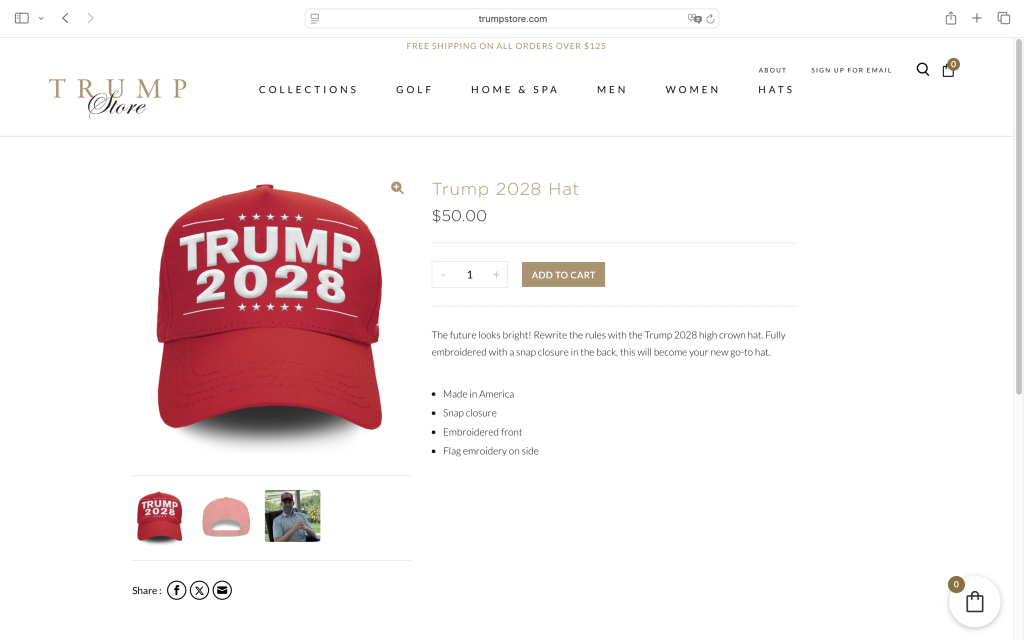
NPC: Non-playable character.
Thats me. Ich steh am Rand und wippe. Rede irre vor mich hin.
Dann bekomme ich eine Beförderung nach unten (Trennung; Alter; Kündigung)
und werde vom NPC
zum NVC: Non-visible character.
Wieder liegt ein Sommer vor mir.
So wie manchmal auch ein Jahr vor mir liegt.
Asl wäre er eine Bürde, etwas, das es zu tragen, zu stemmen gilt.
Dabei liebe ich den Sommer. Im Sommer habe ich am ehesten eine Chance.
Warte doch mal ab. Hab doch mal ein bisschen Geduld.
Wenn ich nichts tue, passiert nichts, versteht ihr das nicht? Da sind die Tage, die Abende, und die Wochenenden! Die Nächte, die Morgen, die Stunden, die Wochen, die Feiertage, die Brückentage! und
all diese Sekunden.
Dauernd passiert was. In den Nachrichten. Von dem ich froh bin, dass es mir nicht passiert. Aber es passiert mir ja doch.
Wo ist das gute, das richtige Passieren?
Im Kontakt.
In der Berührung, im Austausch, im selbstgewählten, temporären Rückzug.
Was, wenn der Kontakt verboten ist.
Das Cafe. Mit dem perfekt versteckten Blick auf die Promenade.
Der Sand. Ich ziehe die Schuhe aus.
Die Kantine mit den Piroggen. Sie heißt irgendwas mit Babicka.
Der Supermarkt, bei dem man nie weiß, ob er offen hat oder zu, so verschlossen ist alles.
Das hübsche weiße Haus in Bäderarchitektur, das zum Verkauf steht.
Der Mann vor den Garagen, tiefgetaucht in den Kofferraum seines Autos. Im Hintergrund die Platten.
Ich fahre trotzdem
Das gute alte Trotzdem
Man weiß nie, ob das gut ist
Die Gefahr ist groß
Aber das ist sie zuhause auch
Und ich wollte doch
(Raus hier),
ich hab mich doch
(Darauf gefreut),
das war doch
(Lange geplant).
Ich wollte das Meer sehen
Warum seh ich eigentlich nie das Meer.
Das Meer ist die Ostsee, naja
Ich arbeite alles ab. Zugfahren. Ankommen. Einchecken. Loslaufen.
Dies anschauen. Und das. Ach, guck mal. Dann noch dahin.
Ich komme klar. Ich komm schon klar.
Klarkommen ist was anderes als.
So verlaufen die Tage.
Es geht
Es geht nicht
Es geht nicht gut
Es geht mir nicht gut
Glücklicherweise kommt C.
Ich nehme ihre Hand und spreche es aus.
Wie gleich hätte alles ausgesehen, wie anders wäre alles gewesen.
Was für eine Verschwendung.
Im Zug
Der Pullover der Frau
Grau mit winzigen Glitzersteinchen
Die Sonne macht ein Lichtspiel draus, wirft es für uns alle an die Decke.
Der eine, ein Vater, ruft an, ich nehme nicht ab, die Voice Mail nett, hilflos.
Ein anderer, T., meldet sich nicht, und hat wie immer die Oberhand.
Ein dritter, U, meldet sich, nett und warm und ohne begriffen zu haben, dass er sich vor ein paar Tagen von mir getrennt hat und nicht alles haben kann.
Egal wie, ob oder nicht. Alle bereiten mir Schmerzen.
Ich will allein sein.
Wie die Sätze sich wiederholen.
Von Mann zu Mann zu Mann.
Ich könnte mir wie andere Leute einen Hund kaufen.
Und ihn Volker nennen.
Nach T
und U
kommt V
Zwei Prolls in ihren 30ern (!) ziehen johlend um die Ecke. Ein obdachloser Mann liegt in seinem Schlafsack an einer Hauswand und schläft. He! Uffwachen brüllt der eine ihn unvermittelt an. Lautes Proll-Gelächter.
Ihr Arschlöcher, sage ich zu ihnen. Hilflos steht das im Raum, verhallt irgendwo zwischen mir und einer lachenden Wand, die mir sagt, ich bin draußen.
Ist das abgebrochen oder ist das so gebaut? fragt eine junge Frau mit Kind ihren Freund. Sie meint die Gedächtniskirche.
Ich sehe schlimm aus, die Rosazea treibt mal wieder ihre Blüten auf meinem Gesicht, rot, entzündet, demütigend, ich habe keine Creme mehr, ich suche die ganze Stadt und die einschlägige Arzttermin-Plattform nach einem Termin beim Hautarzt ab , es gibt keinen. Oder genauer: Es gibt keinen, der umsonst ist. Genau wie die Orthopäden und die Augenärzte haben die Hautärzte nämlich aufgerüstet. Sie sind jetzt moderne Dienstleister mit shiny-schick eingerichteten Praxen in denen die Mieten so teuer sind, dass die Armen gucken müssen wo sie bleiben und deshalb listig behaupten, auf ihren Webseiten und auf der einschlägigen Arzttermin-Plattform, dass sie offen für Kassenpatienten sind, dann aber leider nur noch Termine für Privatpatienten haben oder vereinzelte, in weiter Zukunft liegende für Selbstzahler, die allerdings nur schrittweise freigegeben werden.
Der Selbstzahler ist der neue Kassenpatient.
Ich gebe irgendwann klein bei. Ich zahle knapp 100 Euro für den Hautarzt-Besuch, bei dem ich über die Rosazea erfahre, was ich schon weiß und endlich das Rezept bekomme für die Salbe, die ich brauche, für die ich in Worten sechzig Euro bezahle, weil ich ja nicht über die Kasse da bin. Die angestellte Ärztin gibt mir sozusagen an ihrer Arbeitgeberin Schrägstrich Arzt-Unternehmerin vorbei den Tipp, das nächste Mal eine Krebsvorsorge zu bezahlen, (die man laut Kasse alle zwei Jahre machen soll, um eine der aggressivsten Krebsarten zu bekämpfen, nicht umsonst gibt, bei keinem Hautarzt mehr, weil die Kasse den Ärzten, so erfahre ich von einer Ärztin, nur etwas mehr als 20 Euro pro Untersuchung dafür gibt), dann wäre ich nämlich drin im System und sie könne mir dann auch ein reguläres Rezept für die Salbe geben mit dem ich nur die Zuzahlung für die Krankenkasse zahlen muss. Das mach ich natürlich. Baldiger Hautkrebstermin für knapp 100 Euro, bitte. Denn ich will ja rein, ins System.
Die Narbe am Handgelenk sieht aus wie ein Suizidversuch.
Passt ja.
Null Uhr.
Meine Nachbarin von schräg gegenüber
allein auf dem Balkon
In jeder Hand eine brennende Wunderkerze.
Sie wedelt mit ihnen
als wären sie zwei Rührhaken
N. erzählt von einem Freund, der sich in die Badewanne legt und aus dem Fenster das Feuerwerk betrachtet.
Mein Unbewusstes weiß,
weiß ganz genau,
dass Weihnachten/Silvester ist. Es schickt mir einen Traum mit T.
Diesmal taucht er nicht mal mehr selbst auf, stattdessen ein gemeinsamer Freund. Er erklärt mir T., erzählt mir, wie es ihm geht und was er macht. Als ich aufwache, kann ich mich an nichts davon erinnern. Nur mein Körper weiß, was geschehen ist.
Teil 1
Zu meinem Geburtstag, genau genommen dem Geburtstag meines Spitznamens und Pseudonyms, zu meinem Pseudonatalis sozusagen, beschließe ich, etwas Schönes zu machen, zusammen mit U, und endlich mal wieder ein bisschen rauszufahren, was anderes zu sehen als Berlin, um wegzukommen von der viel zu vielen Arbeit und der Jahreszeit des letzten Quartals ein bisschen Wärme und Entspannung entgegenzusetzen. Wir fahren nach Bad Saarow für eine Nacht im Hotel mit Aufenthalt in der Therme.
Im Hotel ist alles wundervoll. Ich komme sofort runter, entspanne mich, wir reden, lesen, essen. Abends machen wir den Fernseher an, für mich etwas Besonderes, seit ich keinen mehr habe. Zufällig schalten wir in den Brennpunkt ein.
Der ganze Tag schon überschattet und gedrückt vom zu erwartenden nicht ansatzweise knappen Wahlsieg Donald Trumps. Der Eindruck, am Beginn einer sich in zweiter Runde nun endgültig verwirklichenden Dystopie zu leben.
Und wir hier, ins Hotelbett gekuschelt.
Der Brennpunkt geht im Laufe der Sendung über in eine aktuelle Berichterstattung zum Bruch der Ampelkoalition. Die Regierung ist aufgelöst. Lindner hat endlich bekommen, woran er von Anfang an gearbeitet hat wie ein verzogenes Kleinkind. Mehr Milei und Musk wagen hat er kürzlich noch gesagt, und damit endgültig klar gemacht, welche Strömung er als moderner FDPler vertritt, dass der Liberale bei den Libertären angekommen ist.
Teil 2
Am nächsten Morgen ziehen wir um in die Therme. Das warme Wasser, die Sauna ist vielleicht kein direkter Trost, aber eine Erinnerung daran, dass ich und mein Körper da sind. Ich baue die Erfahrung ein in meine Zellen, auch wenn sie nur eine äußere Schicht erreicht und komme erholt und ein bisschen weniger geschunden, weniger abgelenkt von oder genauer: hingelenkter zu mir aus der Therme.
Wir kommen aus dem Gebäude, ich laufe neben U schwatzend über den Vorplatz. Das Wetter ist ein wenig klamm, es regnet nicht, aber es ist, als hingen viele feine Tröpfchen in der Luft, die der See absondert. Als ich die vier Stufen der Treppe vom Vorplatz hinunter gehe, rutsche ich mit meiner Sneakers-Sohle an der metallbeschlagenen Kante ab, falle und breche mir das Handgelenk. Ich weiß es sofort. Alles weiß ich sofort. Ich weiß, dass sich mein Leben für die nächsten Stunden, Tage, Wochen und Monate ändern wird und ich weiß auch wie.
Das Erste, was ich sage ist, Nein, ich muss doch arbeiten! Ich kämpfe, am Boden kauernd, gegen die Ohnmacht, ich vermeide, auf das gebrochene Gelenk zu sehen, ich bitte U um Wasser, um einen Krankenwagen, denn ich weiß, ich werde nicht ins Krankenhaus laufen können, zu schwarz ist mir vor Augen. Gesichter erscheinen vor mir, erschrocken, Gutes wollend, U tut mir leid.
Mein Arm fühlt sich an wie Matsch, von unten links Zeigefinger Ringfinger über den Unterarm, den Ellbogen bis zur Schulter ist, so mein Eindruck, alles kaputt.
Erst seit ein paar Wochen kommen wieder Aufträge zu mir, Projekte sind angeleiert, und in Aussicht, gute Projekte, gerade eben habe ich eine gute Chance ergattert, in ein neues Format hinein zu schreiben, was mir nach langer Flaute die Möglichkeit geben würde, vielleicht einmal im Jahr einen Batzen Geld zu verdienen, was meine Chancen erhöhen würde, endlich eine Agentur zu finden.
Das Rettungsteam ist eine sympathische kleine Gurkentruppe. Die Anführerin sagt, der steht schlecht, als sie den Bruch sieht, was nicht gerade zu meiner Entspannung beiträgt, weil ich nicht sicher bin, was sie damit meint und will mir unbedingt in ihrer adrenalingesteuerten und actionorientierten Macherart den Pulli aufschneiden, fasst meinen Arm viel zu oft an und herrscht U an, wo der Medikamentenplan sei. Mit ruppigem Schwung werde ich auf eine Liege gelegt und in den Notarztwagen geholpert. Wer eine Rückenfraktur hat, hat danach noch eine.
Der eine Sani, Mitte 40, dicker Bauch, liebes, rundes Gesicht, Jens, dem ich sein Mitleid, seine Überforderung und seine Unsicherheit ansehe, und den ich deswegen irgendwie mag, versucht, mir einen Zugang zu legen. Das gelingt nicht. Er stochert dreimal in meinen Venen herum, denn auch Anfänger haben ja manchmal Glück bzw. müssen was lernen, erst die Anführerin schafft es, die Kanüle zu platzieren. Sie injizieren mir irgendwelche Mittel, ich erzähle ihr, dass ich es nicht so mit den Opiaten habe, sie gibt mir was, was sie auch mal bekommen hat, als sie sich das Bein gebrochen hat, ich bilde mir ein, es klingt irgendwie nach Ketamin. Irgendwann bin ich eher weg, dann wieder halb da, dann ist alles sehr, sehr weiß und filmreif als die Tür zur Rettungsstelle der glücklicherweise nahe gelegenen und großen Klinik aufknallt.
Ich werde hier insgesamt 8 Stunden verbringen, die meiste Zeit wartend. Auf Ärzte, auf Behandlung, auf Bilder, auf Entscheidungen. Pfleger Leroy gibt mir ein Opiat, verspricht mir eine rosa Wolke. Wie immer nichts. Stattdessen ängstliche Nervosität und Schmerzen. Die Kochsalzlösung, die in meinen Arm fließt, führt dazu, dass ich alle halbe Stunde auf Toilette muss. Dennoch bin ich froh, sie zu haben. Sie stabilisiert mich, ich muss nicht mehr gegen die Ohnmacht kämpfen. Der Schieber, so heißt die Bettpfanne inzwischen, den Pfleger Leroy mir bringt, ist nicht für Frauen gemacht. Ich setze mich möglichst weit hoch, damit der Urin mir nicht Richtung Po und Rücken läuft.
Neben mir all die anderen Kranken. Eine ältere Dame, die unaufhörlich jammert und jeden, der vorbeikommt, um Hilfe bittet, sie habe solche Schmerzen und niemand kümmere sich. Anfangs frage ich mich, ob ich aktiv werden muss, aber dann verstehe ich, dass sie dement ist. Deshalb ignorieren sie auch alle.
Ein älterer Mann, der, wie ich später erfahre, denn ich erfahre alles!, Blut gepinkelt hat, nachdem er tagelang gar nicht pinkeln konnte und nun irgendwie durchgespült wird. Pfleger Leroy ist zufrieden mit der Klarheit des Urins im Beutel, ich auch, und auch der Urologe, der sehr viele Stunden später kommt und von Pfleger Leroy angekündigt wird als einer der wenigen Ärzte, die es hier auf der Urologie gibt und über die wir alle froh sein können, dass es sie überhaupt gibt, scheint zufrieden mit dem Verlauf.
Überall Schmerzen. Pfleger Leroy entscheidet irgendwann pragmatisch, mir einfach Paracetamol zu geben. Ich bin froh, dass ich ihn habe. Er ist eindeutig der beste Pfleger hier. Eine Schwester mit dunklen Haaren um die 50, hat etwas überraschend Brutales, Sadistisches an sich. Ich traue ihr alles zu. (Vor allem natürlich das AfD wählen.) Aber wie muss es auch sein, wenn man jeden Tag diese jammernden Menschen und fordernden Situationen um sich hat. Sie spricht übertrieben barsch mit dem Oberschenkelhalsbruch, der älteren dementen Dame neben mir. Sie fasst sie auch so an.
Die Dame hebt immer wieder mal den Vorhang zwischen uns, und schaut irgendwie lieblich darunter hervor. Sie spricht mit mir, lächelt, fragt, was ich habe, reagiert empathisch und erzählt mir klagend, dass sich niemand kümmert und sie mit niemandem sprechen konnte, nicht mit ihrem Mann, nicht mit der Schwiegertochter. Ich weiß, dass das nicht stimmt, weiß es sehr genau, denn sie hat mit allen gesprochen, ich habe alles gehört, immer wieder, jedes Wort, das sie gewechselt hat, mit dem Pfleger, der ihre Schmerzmedikation überprüft hat, der Pflegerin, dem Mann am Telefon, der Schwiegertochter, nur mit ihrer Schwester nicht, vielleicht war das, bevor sie neben mich geschoben wurde oder die Schwester lebt nicht mehr. Sie alle waren nur genervt von ihr.
Eine Ärztin steckt den Kopf zur Tür raus, ruft in den Gang, kann mir mal jemand den Papa aus dem Wartezimmer holen, die Mama kollabiert mir hier gerade. Sie behandelt ein kleines Mädchen, ich sehe es durch die Tür auf dem Untersuchungstisch, irgendwas mit Bruch oder Schnitt. Der junge Vater kommt, die Mutter wird kreidebleich aus dem Zimmer geführt, ich kann sie so gut verstehen.
Ich bin maximal erschöpft. Ich bin nicht mal müde, ich bin was anderes, ich weiß nicht was, drüber, durch, ich komme nicht zur Ruhe, weil alles zu laut und zu deutlich ist und ich keine Filter habe, überhaupt keine Filter, ich bin bei allen: dem sein Bestes gebenden junge Pfleger, der in ein paar Jahren verschlissen sein wird, dem jungen Assistenzarzt, vermutlich irgendwas mit Migration in zweiter Generation mitten im AfD-Osten, der bestimmt nicht geschlafen, seit Stunden nichts gegessen hat und hier Dinge macht, die er eigentlich noch gar nicht richtig kann und die ihm auch niemand solide beibringen wird, bei der alten demenzkranken Frau, deren Mann eine gruselige Gleichgültigkeit in der Stimme hat, dem Prostata-Mann, der aus dem Schwanz blutet und still und zurückgezogen seine Schmerzen erträgt, der jungen Mutter, die angesichts ihres leidenden Kindes fast das Bewusstsein verliert, ich komme nicht zur Ruhe, weil ich sie alle höre und verstehe und erkenne und mir das System entgegen kommt, in dem alle nur versuchen durchzukommen, ohne allzu grobe Fehler zu machen oder geduldig zu warten, bis es besser wird, bis sich jemand kümmert, vor allem aber,
weil es kein verdammtes Medikament gibt,
das es schafft, die Schmerzen, die Angst, das Mitleid, das Chaos, die Überforderung der Ärzte und Pfleger und Patienten irgendwie von mir wegzuhalten.
Nach dem Röntgen beschließt der junge Assistenzarzt, meinen Handgelenksbruch zu strecken. Dazu muss der Arm, erklärt er mir, in eine Streckapparatur. Die Finger werden bei nach oben ausgestreckter Hand einzeln in Schraubzwingen gesteckt und fixiert, der Arm hängt locker im 90-Grad-Winkel nach unten. Dann werden Gewichte auf den Oberarm gelegt. So soll das Gewebe, also Blutbahn, Nerven, Sehnen, die vom Bruch möglicherweise gequetscht worden sind, entlastet werden. Ich gehe davon aus, dass ich bei der Prozedur schreckliche Schmerzen haben werde. Der Arzt betäubt meine Hand mit ein paar Nadelstichen, und ich merke gar nichts, absolut gar nichts, alles geht sehr gut. Ich bin sehr erleichtert. Der Arzt kommt mir zurecht stolz vor.
Die nächste Haltestelle ist das CT, auf dem überprüft wird, ob die Streckung soweit erfolgreich war. Wenn nicht, muss das Handgelenk noch heute Nacht operiert werden. Wenn doch, dann muss ich mir einen OP-Termin besorgen. In Berlin. Und zwar gleich am nächsten Tag, sagt der Arzt, denn allzu lang sollte man mit der OP in diesem Fall nicht warten. Da ich nicht weiß – der Arzt verschwindet über Stunden im OP, kann also nicht aufs CT gucken – ob ich heute noch operiert werde oder eben nicht, und sich alles quälend lange hinzieht, telefoniere ich mit U., der im Wartezimmer und in Cafés herumsitzt. Er soll besser mal nach Hause fahren.
Ziemlich genau um 22:00 Uhr, nach 8 Stunden Rettungsstelle, kommt die Entwarnung. Die Streckung hat gebracht, was sie bringen soll, ich muss nicht hierbleiben und notoperiert werden, sondern ich muss raus. Ich dachte, sage ich, ich kann für eine Nacht hierbleiben. Der Arzt schüttelt den Kopf, sie sind kein Notfall mehr, und stationär würde ich auch nicht empfehlen, wir haben Corona.
Für einen Moment bin ich total überfordert, denn der letzte Zug nach Berlin ist praktisch gerade eben gefahren, beziehungsweise es gibt noch einen späteren, der eine Dreiviertelstunde Aufenthalt in Fürstenwalde hat. Auf dem Gleis in Fürstenwalde, bei Dunkelheit, Kälte, den Arm in Gips, den Medikamentencocktail noch nicht verdaut? Und wie komme ich überhaupt von hier zum Bahnhof? Vor der Klinik gibt es keine Taxis, sagt man mir.
Ich rufe U an, und bitte ihn, in dem Hotel, in dem wir waren zu fragen, ob sie noch ein Zimmer frei haben. Eins ist noch frei! Ich muss den Schlüssel allerdings aus einem Safe holen, an der Rezeption ist niemand mehr.
Ich beschließe, ins Hotel zu laufen, 27 Minuten. Richtig wohl ist mir bei dem Gedanken nicht. Ich trete vor die Klinik, beziehungsweise man schickt mich zum Hinterausgang hinaus, froh, dass wieder jemand weg ist, der einem ab sofort egal sein kann. Es ist kalt, nass und dunkel. Google Maps schickt mich in Richtung eines unwirklichen stockdunklen Weges. Ich laufe ein paar Meter, der Weg endet vor einem Gitter. Ich bin so durch, zittrig, wirke auf mich selbst verwirrt. So geht das nicht.
Ich gehe zurück in die Klinik und bitte eine Frau am Empfang, mir bei der Organisation eines Taxis zum Hotel zu helfen. Ich bekomme eine Liste mit Taxiunternehmen, telefoniere sie durch, niemand geht dran. Ich gehe zurück zum Tresen. Der Assistenzarzt isst im Hintergrund irgendein Fast Food. Mir muss jetzt mal jemand helfen, höre ich mich in Richtung der beiden Frauen am Empfang sagen. Eine erbarmt sich, greift zum Telefonhörer und ruft jemanden von der Taxi-Liste an, den sie offensichtlich kennt. Schwatzt.
Ich warte eine halbe Stunde, den Gipsarm im Schoß, im Wartezimmer. Eine Frau kommt herein, sie hat beide Handgelenke im Gips. Nein!, sage ich, unser absurder Anblick erheitert die Wartenden, auch mich und sie, wenn auch deutlich weniger, so sehr sind wir noch damit beschäftigt zu realisieren, was das jeweils für die nächsten sechs bis acht Wochen im Alltag bedeuten wird. Eine andere Wartende weist sie grob darauf hin: Da könnse sich jetzt aber nicht mal mehr alleine den Arsch abwischen.
Ich suche das Weite und setze mich in den Gang auf einen der Stühle.
Der Taxifahrer kommt zur Tür herein. In seinem Gesicht prangt – ungelogen – ein Hitlerbart.
Er fährt mich freundlich, die Anfahrt aus Fürstenwalde auf den Fahrpreis dazu addierend, ins Hotel und spricht irgendwann von Adolfs Zeiten in Bezug auf irgendein Gebäude, an dem wir vorbeifahren. Alles klar.
Ich bekomme den Safe mit dem Schlüssel nicht auf. Der Code funktioniert nicht. Mein Herz klopft, mein Arm pocht. Ich unterdrücke meine Panik, niemand ist mehr auf der Straße, ich bin hier mitten in einem Wohngebiet, ich laufe zurück auf den Parkplatz. Dort stehen glücklicherweise zwei Personen. Glücklicherweise ist es jemand vom Hotel und weiß den Code.
Den Schlüssel in der Hand, steige ich die zwei Treppen hoch bis zu meinem kleinen Zimmer. Ich lege mich und den Arm irgendwie und so wie ich bin ins Bett, stehe nochmal auf und hole alles an Decken, Handtüchern, was ich finde und lege sie auf mich drauf und um mich herum. Ich zittere. Ich habe zuletzt heute morgen was gegessen, fällt mir auf.
Teil 3
Am nächsten Morgen stehe ich um 5 auf und fahre von Bad Saarow aus direkt die ganze Strecke durch bis in die Unfallklinik Berlin Marzahn, um mir einen OP-Termin zu besorgen. Mit meinem Gipsarm links und einer Riesenplastiktüte mit dem Aufdruck Rettungsstelle rechts, betrete ich die Rettungsstelle.
Bei der Anmeldung schildere ich die Situation und dass man mir gesagt habe, ich solle mich umgehend um einen OP-Termin kümmern. Die Frau an der Rezeption lässt sich den Zettel geben, den man mir in Bad Saarow mitgegeben hat. Genau genommen den Befund. Dann fragt sie nach den Bildern. Die habe ich nicht bekommen, sage ich. Wir brauchen die Bilder, sagt sie. Ja, sage ich, klar, könnten Sie da nicht anrufen, damit die die schicken? Das geht nicht, sagt sie, Sie müssen da anrufen. Okay, sage ich. Und wohin sollen die die dann schicken? Gibt es eine Mail-Adresse? Nein, sagt sie, die müssen das mit einem Kurier schicken. Manche schicken einen QR-Code. … Okay, sage ich, ich ruf dort an.
Ich gehe zurück ins Wartezimmer und rufe in der Rettungsstelle Bad Saarow an. Man gibt mir die Nummer der Radiologie. Dort geht niemand dran. Ich rufe, unruhig im Wartezimmer auf und ab laufend 20mal dort an. Die Nummer muss falsch sein, oder liegt es an der schlechten Verbindung hier und ich komme einfach nicht durch?
Irgendwann werde ich zu einem Bett geleitet. Um mich herum Vorhänge, die beiseite oder wieder zugezogen werden, schon wieder jede Menge Geschichten, Prozeduren links und rechts, diesmal eine schwerhörige demente alte Frau, die nicht versteht, was los ist, die Pflegerinnen haben es schwer, sie umzuziehen, ein alter Mann von dem ich mir nicht sicher bin, ob er noch lebt, so weg ist er.
Abrupt wird mein Vorhang zur Seite geschoben, eine Ärztin steht vor mir und meinem Arm. Wo sind die Bilder? fragt sie ohne weitere Einleitung, ohne Bilder kann ich Ihnen keinen OP-Termin geben. Ich frage, ob sie mich nicht zumindest schon mal ins System aufnehmen könnte für einen OP-Termin, Sie habe doch den Befund, und dann vielleicht in Bad Saarow anrufen könnte bei ihrem Kollegen (oder in der Radiologie, die Nummer hab ich rausgefunden, sage ich)
– um ihn zu bitten, die Bilder zu schicken. Ja, wie denn, pfeift sie mich an, mit der Pferdekutsche?
Ich bin erschöpft. Ich bin erstaunt darüber, wie erschöpft ich bin. Ich bin nicht mehr zupackend, pragmatisch, nach vorne gehend, geduldig, wie ich in solchen Situationen sein kann, wie ich mich in solchen Situationen schon erlebt habe. Ich habe plötzlich wahnsinnig schlechte Laune. Inzwischen bin ich auch hier schon seit 5 Stunden. Ich will einfach nur, dass es vorbei ist, dass es nicht passiert ist. Aber es geht weiter und es ist passiert.
Ich dachte, digital, sage ich.
Manche schicken uns einen QR-Code, sagt sie. (Es geht also digital – verkneife ich mir zu sagen). Aber mit Bad Saarow haben wir keine Kooperation. So ist das, sie ist bei Konzern A angestellt und der Kollege bei Konzern B und weil die Konzerne nicht kooperieren, kann ein Arzt nicht den anderen anrufen.
Ich wundere mich nur, sage ich, dass ich jetzt die Krankenhausorganisation übernehmen muss, soll ich mich jetzt um die Bilder kümmern? frage ich die Ärztin.
Ja klar, sagt sie. Es ist doch ihr Arm.
Dieser Satz bleibt mir hängen. Wow, denke ich, Maggie Thatcher. Wie ein Ballon schwebt Maggies Kopf mit Frisur plötzlich zwischen mir und der Ärztin. Aber vielleicht sind das auch die Medikamente.
Ich meine, wirklich, ist es mein Arm?
In den letzten Stunden war mein Arm nicht mein Arm. Er hat dem System gehört, das mit dem Arm gemacht hat, was es will, soll und muss. Es hat ihn nach vorgeschriebenen Algorithmen bearbeitet. Vom eingehenden Notruf, über den Rettungswagen, in der Klinik, bei der Abrechnung, die im Hintergrund angelaufen ist, hat der Arm im System Prozesse ausgelöst. Der Arm ist in die Statistik eingegangen, hat seine Daten hinterlegt, ist Teil von Gesundheitspolitik, Versicherung, medizinischer Ausbildung, Bettenbelegung, Krankenhausabläufen und Personalhierarchien geworden, und jetzt, wo ein Fehler aufgetreten ist, ein Glitch in der Matrix, weil sich eine Lücke im System aufgetan hat, die das System produziert hat, weil es ein kapitalistisches ist,
jetzt also, wo der Arm dem System nicht in den Kram passt,
ist es plötzlich mein Arm.
Dabei mache ich doch mit dem Arm eben in diesem Moment, in dem ich vor ihr stehe, den fürs Elitekrankenhaus Marzahn offenbar zu läppischen Befund aus Bad Saarow (distale Radiusfraktur, Punkt) in der Hand, genau das:
Ich kümmere mich, wie geheißen und unter Aufwendung all meiner Kräfte, darum, meinem Arm einen zeitnahen OP-Termin zu organisieren,
was von ihr aber gerade aktiv verhindert wird!
Warum nur, so ärgere ich mich über mich selbst, habe ich nicht besser mitgedacht, und dem scheiß Assistenzarzt – der im Übrigen auch an die Medikamente nicht gedacht hat, die hab ich mir Maggie-Thatcher-Style am Ende noch schnell selbst beim Pfleger besorgt – gesagt, er soll mir die Bilder mitgeben! Ich weiß doch, wies läuft! Aber was soll ich denn noch alles machen, an was soll ich denn noch alles denken? Und was machen eigentlich Menschen, die ohne deutsche Sprachkenntnisse oder mit Demenzerkrankung in der gleichen Situation sind?
Sie erbarmt sich, warum weiß ich nicht, vielleicht Angst vor schlechten Bewertungen im Internet, und führt mich zu einer Art Annahmestelle, wo ich nun, wie mir scheint problemlos, einen Termin zum Vorgespräch (!) für eine OP bekomme. Doch bis dahin müssen die Bilder da sein, schärft sie mir ein und sagt:
Da fahren sie einfach morgen nochmal hin und holen die. Bad Saarow ist doch ein hübsches Städtchen.
Café in Mitte.
Ich bestelle einen Cappuccino am Tresen. Als ich ihn an der Ausgabestelle abhole, frage ich, ob ich ein bisschen Zucker haben kann. Die Barista schaut mich an und sagt:
We don’t work with sugar.
Schon wieder ein Baby-Traum. Was will mir mein mittelalter menopausaler Körper damit sagen. Denn der ist es, der hier spricht, mein Hormonkörper, mein Torschlusskörper. Ich habs geahnt, ich habs vorhergesagt, ein paar Jahre ist das schon her: der Gedanke an ein Kind kommt dann nochmal, wenn man aus dem Gröbsten raus ist. Wenn der Körper sowieso unattraktiv geworden, Sex nicht mehr gar so wichtig ist, bzw. aus Mangel an Gelegenheit einfach nicht stattfindet, man viel von dem gemacht hat, was man machen wollte, und das, was übrig ist, auf der Liste, sich vielleicht gar nicht mehr so brennend anfühlt, und man sich mental vielleicht zum ersten Mal im Leben soweit aufgestellt fühlt, dass man denkt, jetzt würde ich fertig werden mit so einem Kind. Jetzt könnte ich mir vorstellen, all die bindenden Aufgaben, die es mit sich bringt, zu bewerkstelligen. Bei gleichzeitigem Wissen darum, dass der Körper keines mehr bekommen kann. Er längst darüber hinaus ist, Schlaflosigkeit, Lärm, emotionalen Stress und hohe körperliche Anstrengung auszuhalten. Und der Gedanke, den die Träume wie auf einer Welle tragen, ist nicht das gleiche wie ein Wunsch.
Eine junge Kollegin, Anfang dreißig, Theaterautorin, berichtet von nächtlichen Alpträumen und ihrer Angst, nicht feministisch genug zu sein und demnächst gecancelt zu werden.
Ich erkunde die Stadt, meist allein. Die anderen sind oft nicht da. Ich laufe, ich fahre mit dem Rad. Ich fahre durch Parks, über alte Brücken, am Wasser entlang. Ich arbeite alle Museen ab, alle Plätze, alles was es zu besichtigen und zu entdecken gibt. Bibliotheken, Führungen, Rathausfeste, Sportveranstaltungen, Märkte. Ich lasse nichts aus, nichts unversucht.
Ich registriere den Leerstand – Foto, Standort – den ich insgesamt nicht so schlimm finde wie befürchtet. Die Wochenenden und Abende sind nicht leicht. Wann waren sie das je, wenn ich allein war. Ich habe zu tun, schreibe ein Hörspiel im Co-Working-Space. Beim Projekt muss viel organisiert, es müssen viele Leute getroffen werden, Kontakte zu Initiativen gesucht, eigene Initiativen ins Leben gerufen werden. Ich staune und bin sehr froh, wie gut ich in der Gruppe klarkomme. Ich klappere die Cafés ab und fange sehr schnell wieder von vorne an. Ich staune, wie teuer essen gehen hier ist, ich stöhne unter den Preisen. Wie können die Leute sich das leisten? Die Restaurants sind voll. Ich dachte, die sind hier alle arm und arbeitslos. Die Radwege sind super ausgebaut. Die Tramlinien fahren in hohem Takt, es gibt ein sinnvoll-pragmatisches Nachtfahrsystem mit Großraumautos. Nur auf Google Maps zu finden ist der ÖPNV nicht. Ähnlich wie bei den nicht vorhandenen Schildern am Bahnhof hat man den Eindruck, die Leute denken, wir wissen ja eh, wo was ist bzw. was wann fährt. An die von außen denkt man nicht. Aber das ist ja vielleicht überall so.
Am Ende bin ich froh über die Erfahrung. Froh über meinen Mut. Wie so oft bei diesen Flöhen, die ich habe, den Abenteuern, die ich eingehe, den kleinen und größeren Challenges, die ich annehme, und ziehe ich weiter. Es bleibt nichts. Andere aus der Gruppe finden über die vier Wochen Jobs, Perspektiven, Freunde, Wohnungen, es baut sich was auf, es entsteht und verändert sich etwas. Ich habe mich wie meistens mit der Position der teilnehmenden Beobachterin auf Zeit identifiziert.
Meine Idee, Leute zu interviewen, einfach so, auf der Straße, ich habe extra ein Aufnahmegerät dafür mitgenommen, habe ich nicht realisiert. Zu scheu, zu schüchtern. Nicht in der Lage, mich dazu mit jemandem aus der Gruppe zu verbünden, was vielleicht geholfen hätte.
H. wird in meinem Leben bleiben, so hoffe ich, und dass ich mir genug Mühe geben werde, dass es so kommt. Eine neue, wenn auch lose Freundin, das ist viel.
Als U kommt, um mich nach den vier Wochen mit Sack und Pack abzuholen, er war drei Wochen an der Atlantikküste, ist er mir zunächst fremd. Das war ja klar.
Zurück in Berlin bin ich froh zu erleben, dass sich – anders als in der Kleinstadt, wie ich jetzt erst begreife – in meinem Inneren keine Langeweile oder Dumpfheit ausbreitet.
Ich gehe essen, klappere alle Cafés ab.
Ich
bin in dieser Stadt
trotz meines häufigen Leidens an ihr
viel
möglicher.
Der winzig kleine Strand an der Mulde. Urbanes Feeling, so mit der Stadtkulisse im Hintergrund, bisschen abhängen, bisschen kiffen und trinken. Einmal nackig rein in die Mulde. Die Dessauer leben ihre Flüsse nicht. Elbe und Mulde, so viel herrliches Wasser mitten in der Stadt und keine richtigen Zugänge, Strände, Badestellen. Keine Boote.
Später erzählt mir jemand, dass die Flüsse bei der Bevölkerung noch immer mit von der Industrie eingeleiteter Chemie assoziiert sind, man früher manchmal nur Schaum darauf gesehen hat und der Gestank durch die Stadt gezogen ist. Heute gelten Mulde und Elbe als sauber. Aber kann man der Sache trauen?
—
Sehr viele sehr patente Frauen machen hier sehr patente Arbeit. Im Café, bei der Stadt, im sozialen Bereich, wahnsinn, was die rocken. Die können quatschen, denken, organisieren bis zum Burnout und sind dabei herzlich, ruppig – und manchmal zu dominant.
Sie arbeiten sich alle ab, an der Bürokratie, die alles ausbremst, aussitzt, was an Energie aus der Stadtgesellschaft kommt, an den Netzwerken, denen sie eigene entgegen zu setzen versuchen, an den Verteilungskämpfen, in die sie sich werfen, am System, das sie verschleißt, an den grundsätzlichen Motzereien, die hartnäckig bleiben, egal was man alles auf die Beine stellt und obwohl hier so viel Tolles passiert,
Immer wieder staune ich, was es hier alles gibt, wer hier alles lebt und sich wie einbringt. Immer wieder werde ich mit den eigenen Vorannahmen konfrontiert, die sich als falsch erweisen.
—
Natürlich liegt es an meiner aktuellen Perspektive auf die Stadt, am Framing meines kuratierten Aufenthalts, aber ich habe noch nie so nah mitbekommen, wie eine Stadt und ihre Menschen sich in einer Demokratie organisieren.
—
Im Hausflur begegnet mir eine Frau, Moment, sagt sie, und stutzt irritiert, geht’s jetzt hier durch oder wie? fragt sie. Ich frage zurück, wo sie hinwill, denn es ist hier wirklich etwas labyrinthisch, mit einem Zwischengang und einem Fahrradraum, dessen Tür man für einen weiteren Eingang zum Treppenhaus halten kann.
Sie entschuldigt sich, erzählt mir, dass sie eine Rücken OP hatte, sie immer noch ein bisschen verwirrt ist, wie schlimm die Schmerzen waren vorher, wie unerträglich, dass es nun, so langsam, besser wird. Ich erwähne kurz, dass ich das kenne, mit dem Rücken und den Schmerzen. Sie fragt mich, ob ich jetzt hier wohne? Ich erzähle, dass ich nur vier Wochen da bin und berichte kurz vom Projekt – Stadtentwicklung, Gruppe Freiwilliger, möglicherweise um zu bleiben. Sie nickt, irgendwie erfreut, wie alle, die hören, dass man sich für Dessau interessiert, gleichzeitig etwas verständnislos und distanziert. Warum genau finde ich nie heraus. Ist es: Hier ist doch eh nichts mehr zu retten oder Hier ist doch alles okay oder Wer seid ihr, dass ihr, wahrscheinlich Großstadt-Wessis, von außen die Stadt verbessern wollt (der Kolonialismus-Vorwurf, den ich von Freunden höre und selbst problematisch finde) oder Tss, da seid ihr nicht die ersten? Wie sich herausstellt wohnt sie direkt über mir, mit ihrem Mann. Wieder orientiert stapft sie die Treppe hoch.
—
„Schmecken lassen!“ sagt der Mann am Wurststand als er mir die Wurst rüber reicht. Das ist nett, ich weiß.
Diese Promptheit oder Ruppigkeit in der Sprache, was ist das, herzliches Militär.
—
Auf dem Flohmarkt eine Tupperbox. Darauf ein Indianer.
—
Ein mittelaltes Ehepaar, das über drei Radfahrer motzt. Die fahren nicht auf dem Radweg, sondern auf der elend breiten Straße an ihnen vorbei.
Ach, herrlich, Kleinstadt, deine Probleme.
—
Im Kartoffelhaus
Ein Mann isst seine Folienkartoffel
mit einer Umsicht für das Aufschieben der Alufolie und einer Hingabe an das Ablösen des dampfenden Kartoffelinneren von ihrer groben Schale
als habe er sich die ganze Woche darauf gefreut.
—
Eine aufgedrehte Gruppe von Kids, vielleicht so zwölf, dreizehn? Neiiin, kräht einer der Jungs, die sind aus Japan! Wer gemeint ist, ist unklar, eine Band vielleicht, irgendwelche Leute, die sie gesehen haben? Ching chang chong macht er, um die Sache zu veranschaulichen, tänzelt mit erhobenen Armen herum und zieht sich die Augen zu Schlitzen.
—
Zwei aus der Gruppe berichten, dass sie mit ihrem Baby in der Kinderklinik waren. Die Ärztin habe, um sie zu beruhigen, von ihrem eigenen Kind berichtet. Das sah auch einmal, als es schweren Durchfall hatte, aus wie ein Buchenwaldmaskottchen
Ich schaffe es beinahe nicht, das hier aufzuschreiben.
Wie lange habe ich nicht in einer WG gewohnt. Wie schwer es mir gleich wieder fällt, die Übergänge hinzubekommen. Zusammen sein, auseinander gehen, in den Kontakt gehen, soziales Leben (Nähe, Kennenlernen) vs Rückzug, allein sein. Das Warten, Hoffen, Fantasieren ist sofort wieder da. Beim anderen sein, nicht bei mir. Sehnsucht empfinden, Enttäuschung Traurigkeit, Einsamkeit, Melancholie, Anflüge von Depression mit denen es umzugehen gilt. Wie sehr ich gleich wieder leide.
Ich fahre nach der Arbeit noch ein bisschen rum. Das Wetter ist schön. Vielleicht ist sie ja da, wenn ich nach Hause fahre. Dann könnten wir auf dem Balkon abhängen. Vielleicht kauf ich auf dem Nachhauseweg was ein dafür? Einen Wein vielleicht. Eigentlich könnte ich auch einen Salat machen. Oder gleich ne Pasta? Aber wenn sie schon gegessen hat. Wenn sie ihre Ruhe habe will.
Ich komme nach Hause, habe Wein, Pasta, Salat besorgt, schadet ja nichts, kann man ja auch noch morgen. Ich stecke den Schlüssel ins Schloss, muss zweimal drehen und weiß, sie ist nicht da. Ich räume die Sachen in die Schränke, gehe in mein Zimmer. Vielleicht kommt sie ja gleich. Oder später. Ich mach irgendwas, aber ich bin unruhig. Ich bin bei ihr, vielleicht hat sie sich verabredet, vielleicht fährt sie Rad, das macht sie gerne, ich bin in der sozialen Fantasie, beim Kochen, Sprechen, auf dem Balkon, ich bin nicht hier, bei mir, ich kämpfe dagegen an, gegen das Abhängigkeitsgefühl an, gegen die needyness, nichts hasse ich mehr, was macht sie mit mir, das lass ich mir nicht gefallen. Ich gehe selber wieder raus. Denn ich bin stark und unabhängig. Dabei bin ich müde, ruhebedürftig. Doch jetzt ist es ein Wettbewerb. Wer kommt später nach Hause. Wer hat mehr zu erzählen, wer hat mehr Kontakt mit Menschen gehabt.
Sie ist so autark, so bei sich (Überhöhung) Wahrscheinlich mag ich sie deswegen. Sie entzieht sich wie sie will, sie lässt sich nicht einfangen, lässt sich nicht täuschen von meinen Manövern.
Auf solche Typen steh ich. Die müssen so sein, damit ich mich nicht komplett verliere. (Verschmelzungsfantasie). Seltsam wie viel man weiß (Therapie) ohne etwas zu wissen.
Die Montagsdemo. Leute denen man es ansieht, Leute, denen man es ganz und gar nicht ansieht, so etwa 20 bis 30. Jede Woche. Oben ist jetzt unten links ist jetzt rechts alles mäandert verkehrt herum durcheinander alle Kategorien sind aufgehoben, bedeuten nicht mehr was sie bedeutet haben sondern etwas anderes oder gar das Gegenteil. (Freiheit, Frieden)
Man hat sich in der DDR schon gegen den Staat gewehrt (oder waren das womöglich andere und man traut sich nur jetzt auf die Straße, wo man von nichts und niemand was zu befürchten hat?), also lässt man sich auch von diesem Staat nix sagen.
Freiheit! Klingt irgendwie immer wie: Prost. Aufrechte (anständige, siehe oben) Menschen versammeln sich hier. Die wachsamen, rebellischen, die, die schon einmal die Revolution gemacht haben (really?), die, die sich nichts bieten lassen, nichts sagen lassen, schon gar nicht von einer Ideologie, die sie enteignet und entrechtet hat. Wir im Osten. Hier bei uns. Ihr könnt ja machen, was ihr wollt, aber. Mit uns hat das nichts zu tun. Die Bastion wird verteidigt, das Leid weitervererbt, kultiviert und genährt.
Auf der Terrasse eines Cafés in der Innenstadt. Am Nachbartisch sitzt ein Mann mit zwei anderen Leuten, Mann und Frau, und spricht laut und in einem schärfer werdenden Empörungston als ich die Terrasse betrete. Er spricht so wie Leute sprechen, die unbedingt wollen, dass sich jemand an den anderen Tischen provoziert fühlt, dass jemand aufschaut, von seinem Laptop, den er gerade erst aufgeklappt hat, und widerspricht. Ich zum Beispiel.
Der Mann, dem das Café gehört – und der eine ältere, asiatisch aussehende Bedienung hat, die regungslos ihrer Arbeit nachgeht, und mich fragt, was ich möchte, ich kenne sie schon – war offenbar gerade schon mit den dreien im Gespräch. Er fragt ihn: Woher kommen Sie denn. Ausm Osten! schnaubt der Mann. Wir ham noch Anstand gelernt! Er haut auf den Tisch.
Der Anstand wählt nur eine Woche später zu 32 Prozent die AfD
Auf der langen Autobrücke, die neben der Zuckerfabrik über eine breite Schienentrasse führt, gibt es einen Mahnort. Ich werde darauf aufmerksam, weil ich zwischen den ganzen touristischen Flyern rund ums Bauhaus, die Wörlitzer Gärten und das Junkers Technikmuseum in der Touristeninformation einen finde, der von der Machart her ein wenig amateurhafter wirkt.
Die Geschichte geht so: In flüssiger Form wurde Zyklon ursprünglich als Schädlingsbekämpfungsmittel verwendet. Mit dem später entwickelten Blausäuregas Zyklon B, das in nur geringen Dosen zur Lähmung der Atmung führt, wurden in den Konzentrationslagern von 1941 bis 1945 eine Million Menschen fabrikmäßig ermordet. Die Dessauer Werke für Zucker und Chemische Industrie waren Hauptproduktionsort von Zyklon B, von hier wurde es via Schiene in die Vernichtungslager transportiert.
1996 (zu meiner Überraschung nicht zu DDR-Zeiten, sondern erst nach der Wende, in einer Zeit von Pogromen und wachsendem Rechtsradikalismus, wieso denke ich immer, die DDR war so aufgeklärt mit dem NS, ist das alles falsch …?) hat sich eine Gruppe von Dessauerinnen und Dessauern zusammengetan, um sich mit dem Thema zu beschäftigen.
Ihre historische Forschung haben sie 1999 dem Stadtrat vorgestellt und 2000 ein Projekt für einen Informations- und Mahnort vorgeschlagen. Viele Ausschussmitglieder haben das Projekt abgelehnt, so ist es im Flyer zu lesen, woraufhin sich andere Unterstützergruppen und Einzelpersonen aus der Zivilgesellschaft hinter das Projekt gestellt haben.
Im Rahmen eines Design-Wettbewerbs wurden Vorschläge zur Umsetzung erarbeitet und der jetzt installierte ausgewählt. Nach weiteren vier Jahren Finanzierungssuche wurde das Projekt 2007 vor allem mit Spendengeldern realisiert.
Soweit der Flyer. Aus dem man gerade mal erahnen kann, welche Diskussionen in den 11 Jahren bis zur Realisierung von einer kleinen Gruppe engagierter Menschen ausgehalten, aufgefangen und durchgehalten werden musste. Auf offene Ohren und Unterstützung seitens der Stadt scheinen sie jedenfalls nicht gestoßen zu sein.
Ich fahre auf die Brücke, um mir den Mahnort anzuschauen. Die Brücke ist lang, steil und von Autos dominiert. Ab und an radelt mal jemand auf dem Radweg vorbei.
Ich finde keinen Hinweis auf den Ort, suche mal wieder nach Schildern, schaue nach unten Richtung Schienen, dann auf das alte Gebäude, die Zuckerfabrik – da vielleicht? Dann verstehe ich, dass ich erstens auf der falschen Seite der Brücke bin. Und zweitens, dass das Mahnmal in das Geländer der Brücke eingearbeitet ist.
Mehrere Tuben aus Metall, etwa 40 Zentimeter lang, sind auf den Holm des Metallgeländers aufgezogen, so dass sie drehbar sind. Darin eingraviert sind Informationen zur Geschichte von Zyklon B. Um sie zu lesen, müssen die Tuben gedreht werden. Als ich den ersten Tubus drehe, höre ich ein Geräusch, ein leises, Rauschen, das das Lesen begleitet. Es klingt wie Sand, der sich im Innenraum des Tubus mit dreht. Zyklon B wurde als körnerförmiges Material in Dosen verpackt.
Selten habe ich so ein fein durchdachtes Konzept gesehen.
Ich rege mich sofort darüber auf, wie ignorant man damit in dieser Stadt umgeht. Kein Hinweis, keine Erwähnung, damit auch ja niemand was davon mitbekommt und nur die völlig Verrückten auf die Brücke fahren und aktiv danach suchen, nur weil ein paar engagierte Menschen bereit sind, sich seit Jahrzehnten an der institutionalisierten Ablehnung abzuarbeiten und wahrscheinlich auch noch auf eigene Kosten Flyer drucken und in der Touri-Info vorbeibringen. Ich hab sofort den Impuls denen zu schreiben und mich zu bedanken.
In meiner EG-Wohnung stinkts nach Abfluss. Besonders wenn ich dusche scheint das Wasser sich eine direkte Verbindung in die Kanalisation zu bahnen, das Tor zur Hölle und zurück zu öffnen.
Ich fühle mich nicht wohl. Ich putze. Es gibt unfassbar viele Spinnen in Dessau. Warum? Sie hängen in meiner Wohnung rum und ich versuche, sie zu ignorieren, aber das geht nicht immer. Eine sitzt direkt über mir, wenn sie sich geradeaus runterlässt, landet sie direkt auf meinem Gesicht.
Ich verschiebe das Bett.
Irgendwann sehe ich eine sehr hübsch geformte kleine Fliege am Rand der Spüle sitzen, die Flügel in einem zarten Grau, das Körperchen schwarz. Ich frage bei Google Lens nach, wer sie ist. Eine Schmetterlingsfliege. Ihr natürliches Habitat ist der Abfluss. Dort legt sie ihre Eier. Nach weiteren Recherchen schütte ich einen Liter Essig in den Abfluss. Das bringt kurz Befriedigung, aber kein durchschlagendes Ergebnis.
Für die beiden letzten Wochen ziehe ich zu H., die wohnt im fünften Stock. Da gibt’s keine Schmetterlingsfliegen, aber erstaunlicherweise immer noch haufenweise Spinnen. Aber H. macht die Spinnen für uns weg.
Ein älterer Mann, obdachlos, hager, noch ganz manierlich zurecht. Ich assoziiere Rumänien vom Aussehen her, aber was weiß man schon. Er trägt seine Sachen in einem alten Koffer mit sich herum. Das macht ihn zu einem Filmstar. Auch das abgerissene Sakko, die Anzughose, die lange getragene Lederschuhe.
Er dreht seine Runden, schaut in Mülleimer, hat dabei etwas Ruhiges, Vorsichtiges. Er ist auf der Hut, hält sich im Hintergrund, ist beinahe unsichtbar.
—
Eine Gruppe ukrainischer Frauen trifft sich regelmäßig auf den Sitzmöbeln. Sie reden laut und viel. Ich verstehe nur Putin.
—
Drei im Boden verankerte Tisch-Stuhl-Kombinationen, sie gehören den black guys. Refugees, I suppose. Sie hängen hier ab, spielen, hören Musik, quatschen. Ab und zu mal wird es laut, es gibt Streit, man macht sich Sorgen, dann ebbt es wieder ab. In welchen Sprachen sie sprechen, wer woher kommt, inwiefern das eine Rolle spielt, von außen ist es nicht zu verstehen. die Polizei fährt regelmäßig durch, Präsenz zeigen, aber alles wirkt friedlich, Co-Existenzen im Park.
—
Hinter dem Bauhausmuseum an den Cafétischen, hier bleibt man recht unbehelligt. Ein älterer Mann, einer dieser Spazierradler, parkt sein Discounter-Rad, setzt sich, guckt immer, will mit mir ins Gespräch kommen. Ich lege schließlich mein Buch weg und lasse es zu.
Seine Frau ist gestorben, 2021, er hat dort drüben gewohnt, in einem der Y-Häuser, im 13. Stock. Die Hochhaus-Platten in Y-Form sind, genau wie die längste Platte Deutschlands, die auch hier in der Dessauer Innenstadt steht, berühmt und quasi ikonisch für Dessau. Jetzt wohnt er woanders, im Parterre.
Er zeigt mir Fotos, von seiner Küche, von seinem Enkelsohn, Noah, der Lehrer werden will. Alles zu intim, aber was solls.
Er erzählt, dass er wie sein Vater Schlosser war, und beim VEB Waggonbau gelernt und gearbeitet hat. Dessaus Hauptarbeitgeber. Der nach der Wende die üblichen Verkaufs- und Abwicklungsphasen bis zur Schließung mitgemacht hat. Er wiederholt sich, hört nicht zu, fragt nichts. Nach einer Weile verstehe ich, dass er Anzeichen von Demenz hat.
Ich werde ihn in den nächsten Wochen beinahe jeden Tag mit dem Rad herumgurken und immer mal irgendjemand vollquatschen sehen. Kein ganz schlechtes Leben.
Filterkaffee bei Bäckerei Lantzsch in der Mini-Mall – Cafe Lily hat heute wohlverdienten Ruhetag. Ich schreibe eine Mail an H., weil ich in Dessau wegen Chemnitz an ihn denken muss. H. kommt aus Chemnitz und wir haben mal gemeinsam zwei Drehbücher geschrieben, die er verfilmt hat. Thema: Junge Frau aus dem Osten trifft junge Frau aus dem Westen, sie freunden sich an. Der erste Film spielt in Berlin, wo sie sich kennen lernen. Der zweite in Chemnitz. Wo die junge Frau aus dem Westen, die aus dem Osten besucht. Es gab noch einen dritten, aber bei dem war ich nicht mehr beteiligt. Viele unserer Ost-West-Gespräche, ein wiederkehrendes Thema für uns bis heute, ist in die Bücher eingeflossen.
Ich mache ein Foto, weil ich den Blick in den sonnigen Stadtpark gegenüber so schön finde: Die Parkaufräumer in ihrer orangenen Kleidung machen vor der grünen Kulisse eine Pause vor ihrem orangenen Gefährt. Sie schwatzen mit einer Anwohnerin.
Eine der Brunnenfiguren ist mit offenen Armen in ihre Richtung ausgerichtet, als begrüße sie sie alle oder wolle auf sie zugehen.
Vor einer der Parkbänke sitzt ein älterer Mann lässig auf einem schicken, fast Mofa artigen Rollgefährt, so eins für Menschen mit mobiler Beeinträchtigung. Die rote Karosserie glänzt in der Sonne. Er unterhält sich flirtend mit einer Frau in seinem Alter.
Die langen Bänke und sonstigen Sitzmöbel, haben alles andere als ein Hostile Design. Es gibt sie zuhauf in dieser Stadt – ich streiche das Thema, wie im Lauf der Zeit noch viele andere Problemthemen, derer man sich im Rahmen des Projektes vielleicht annehmen könnte, von meiner Liste. Ich schaue zurück auf meine Mail an H. – Sie ist weg. Nein! Entwürfe-Ordner: Leer! Papierkorb: Empty. Meine Mail, verschluckt in Dessau.
Mein Kaffee ist alle. Ich gehe los, einen Bodenwischer und Kehrblech kaufen. Die Mail schreibe ich später nochmal. Jetzt erstmal: Aktion Bude putzen. Dieses Loch im Erdgeschoss ist nämlich alles andere als in der Sauberkeitswohlfühlzone.
August 2024 – Dessau im August – Ankommen
Als ich zum ersten Mal ankomme, verstehe ich, wie so oft im Osten nicht, wie der Bahnhof und die Stadt zusammenhängen. Der Bahnhof ist irgendwie draußen, in die Stadt muss man erstmal rein. (Noch spezieller in Dessau: Die Schienen teilen die Stadt in zwei Teile, aber das verstehe ich erst später). Vor dem Bahnhof ein architektonisch unsortierter, aufgrund fehlender Beschilderung undurchschaubarer Ausgangsort. Später wird jemand aus der Gruppe, das als Frage nach der Willkommenskultur bezeichnen.
Als ich in der Innenstadt ankomme und den Veranstaltungsort nicht finden kann, spreche ich eine Postbotin an, die gerade ihre Runde macht. Hallo, guten Tag, Entschuldigung, wissen Sie wo die Soundso-Straße Hausnummer Soundso ist?
Stadt! bellt sie. Mehr nicht. Ich verstehe nicht, was meint sie? Ich frage vorsichtig nach. Stadt! bellt sie erneut und wedelt mit der Hand um sich. Wie, Stadt? frage ich, so langsam genervt von ihrem Einwortsatz. Dann dämmert mir, was sie meint. Eine Adresse von der Stadt, vom Rathaus, der Kommune. Ich schlage ihr das vor, ach, Sie meinen von der Stadt, vom Rathaus? Wir stehen nämlich direkt an der Längsseite des Rathauses. Aber wo ist die Hausnummer? Sie zuckt mit den Achseln. Müssense gucken.
Ich irre zweimal um das Rathaus und seine angrenzenden Neubauten mit diversen Eingängen, die, wie sich herausstellt, alle dieselbe Hausnummer haben und finde irgendwann durch Zufall den richtigen Eingang.
Jemand erzählt seinem Kumpel an der Ampel:
Stellt sich raus, ich hab das Paket von Amazon mit den Airpods zurückgeschickt an Sixpm, und den Pulli von Sixpm zurück an Amazon!
Im Café. Drei Tische weiter eine Dreierrunde junger Expats, zwei Männer, eine Frau, in ihren late twenties, Start-up-Leute?, vielleicht noch Studis. Sie unterhalten sich im Lästermodus über die Germans und ihre Eigenheiten. Einer der Jungs, ich schätze Australier, erzählt, dass er jemanden kennt, der bei seinen Eltern wohnt und dort Miete zahlen muss. Er geht voll darauf ab, kann es nicht fassen. Die anderen schütteln ebenfalls verständnislos den Kopf, aber er ist wirklich maximal empört: Das sind seine Eltern! And he has to pay rent!!!
Sie scheinen alle drei insgesamt nicht besonders angetan zu sein von der weird German culture.
Ich bin irritiert. Ich ertappe mich bei dem Gedanken, dass ich das unter bestimmten Umständen nur richtig finde, dass so ein Lümmel oder so eine Lümmeliene Miete zahlt, wenn er oder sie Geld verdient und den Alten noch immer auf der Pelle hockt, sie als Eltern sieht, an denen man nuckeln kann, statt als Menschen.
Ich staune einmal mehr, wie German ich bin. Very German. Soziale Kälte, voll mein Ding.
Mir gehen diese Prenzlberg-Kinder ja eher auf die Nerven oder vor allem ihre Eltern, die sich nicht abgrenzen können und ihre selbstgefälligen, auf maximale Bequemlichkeit des eigenen Egos trainierten Kinder im Nest behalten, um sich selbst zu schonen und sich den Herausforderungen ihrer Midlife-Crisis zu verweigern.
Jedoch. Frage ich mich. Warum meine eigene Familien- und Lebenserfahrung inklusive meiner politischen Haltung, mich dazu bringt, so zu denken. Statt sich zu freuen, wenn es jemand für selbstverständlich hält, dass man sich kümmert, no matter what. Care-Manifesto. Lese ich gerade.
Ich habe in den letzten Jahren gelernt, dass man Familie auch anders sehen und denken kann. Warum denn nicht, sollen sie doch in Berlin bleiben, ist ja auch toll hier, wir wollten schließlich auch hier leben. Warum denn nicht, soll er wieder bei uns einziehen, wenns in der WG nicht mehr geht, ist doch schön, zusammen frühstücken, und mit seiner Freundin verstehen wir uns auch so gut.
Doch wenn ich jetzt genauer drüber nachdenke: In einem Fall war am Ende jemand tot (Elternteil, Suizid), im anderen Fall wurde dem herzigen Bub durch permanentes Schnittchen schmieren das Leben verkackt, weil er irgendwann vor lauter Schonwaschgang nur noch zum Gamen in der Lage war.
Vielleicht ist das aber auch einfach eine Geschichte über die Wohnungskrise.
Muss ich jetzt in meinem Leben auch noch einen Krieg erleben, sagt ein Freund.
Ein anderer erzählt mir von Wasserflaschen und Vorratsdosen.